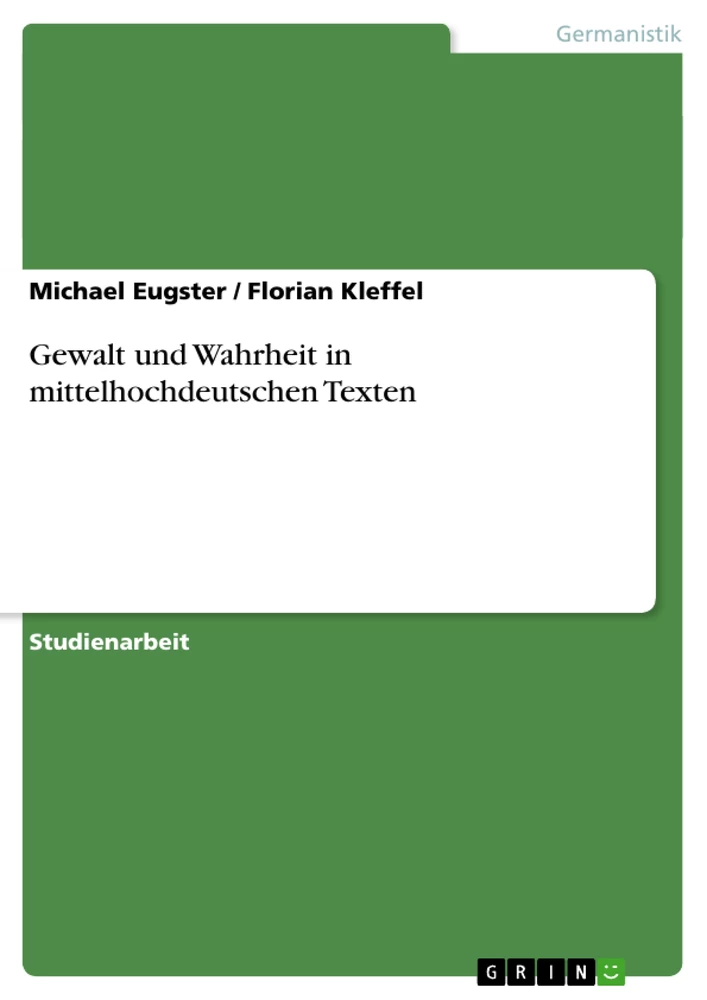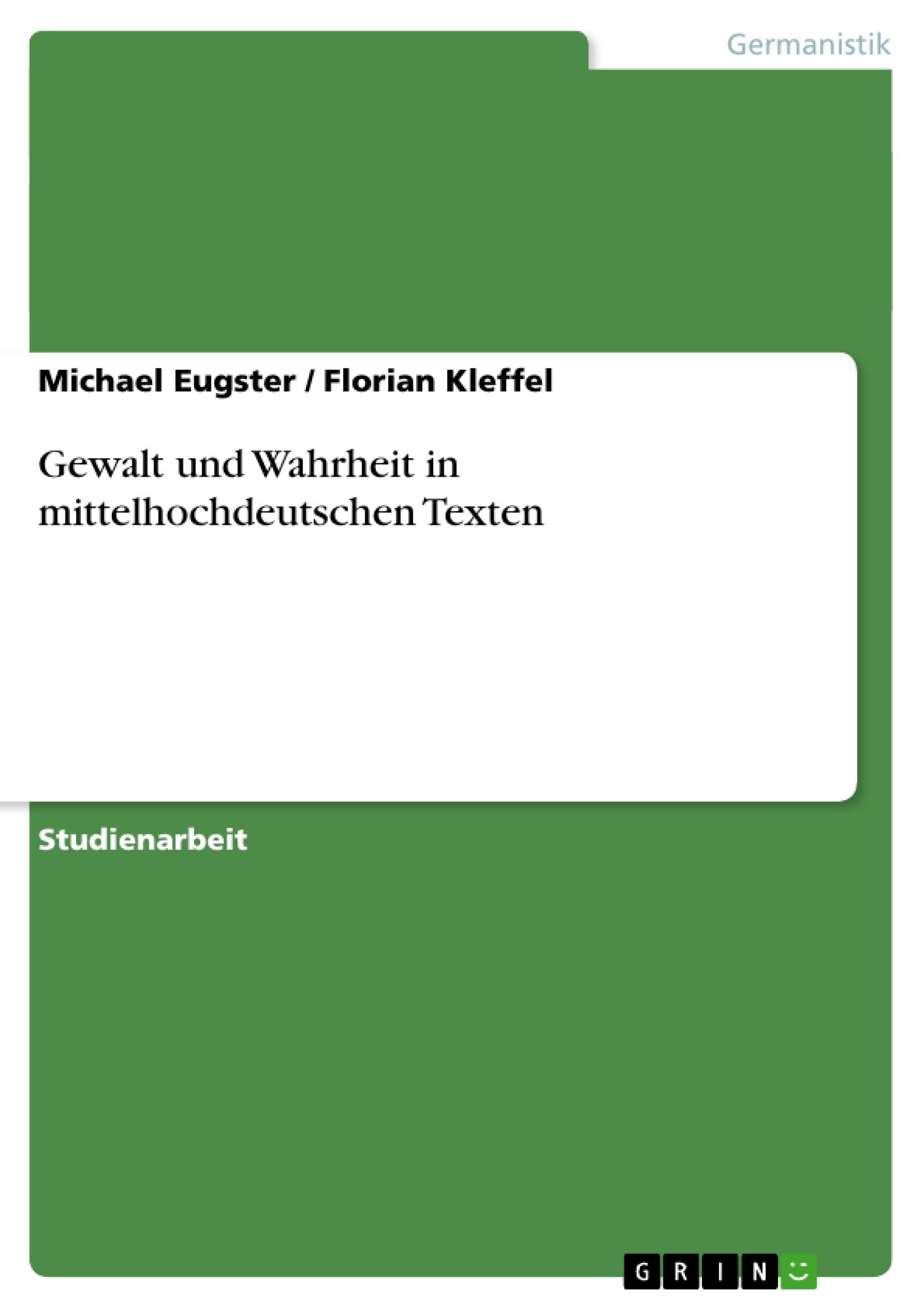Heinrich Kaufringer gilt als ein Musterbeispiel der deutschen Märenerzählung um das Ende des 14.
Jahrhunderts. Allerdings ist es beinahe unmöglich, seine persönlichen Überzeugungen anhand von
Indikatoren in seinen Texten näher zu bestimmen. Darin nämlich reduziert er die Prinzipien des
Lebens auf völlig einfache Schemata. Diese kombiniert er mit solch kühler Konsequenz und ohne
Rücksicht auf eine eventuelle emotionale Betroffenheit des Lesers, dass jegliche kleinen
Einzelhandlungen der Erzählung klar geplant und offen dazuliegen scheinen. Dasselbe gilt für den
gesamten Text, der wie vorkonstruiert wirkt. Diese Eigenheit der mittelhochdeutschen
Märendichtung steht (wie der Terminus Dichtung schon verrät) den meisten Stücken aus jener Zeit
anheim. Allerdings verarbeitet Kaufringer diese Handlungskonstellationen weiter mit implizit
sozialen Normen hin zu wesentlich komplexeren Formen der Literatur (Kasus, Novelle). Natürlich
wurde damals auch unter eben diesem Deckmantel der fiktiven Literatur heftige Kritik geübt an den
bestehenden sozialen und politischen Systemen. Ob sich Kaufringer in diese Reihe der Kritiker
einfügt, wollen wir nachstehend behandeln.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Analyse mittelhochdeutscher Mären unter den Gesichtspunkten von Ordnung, Spiel und Gewalt
2.1 Ordnung & Unordnung
2.2 Spiel & Metaphorik
2.3 Gewalt & Wahrheit
3. Abschliessende Bemerkungen zu Kaufringers Märenliteratur
1. Einleitung
Heinrich Kaufringer gilt als ein Musterbeispiel der deutschen Märenerzählung um das Ende des 14. Jahrhunderts. Allerdings ist es beinahe unmoglich, seine persönlichen Uberzeugungen anhand von Indikatoren in seinen Texten näher zu bestimmen. Darin nämlich reduziert er die Prinzipien des Lebens auf vollig einfache Schemata. Diese kombiniert er mit solch kilhler Konsequenz und ohne Rilcksicht auf eine eventuelle emotionale Betroffenheit des Lesers, dass jegliche kleinen Einzelhandlungen der Erzählung klar geplant und offen dazuliegen scheinen. Dasselbe gilt filr den gesamten Text, der wie vorkonstruiert wirkt. Diese Eigenheit der mittelhochdeutschen Märendichtung steht (wie der Terminus Dichtung schon verrät) den meisten Stilcken aus jener Zeit anheim. Allerdings verarbeitet Kaufringer diese Handlungskonstellationen weiter mit implizit sozialen Normen hin zu wesentlich komplexeren Formen der Literatur (Kasus, Novelle)[1]. Natilrlich wurde damals auch unter eben diesem Deckmantel der fiktiven Literatur heftige Kritik geilbt an den bestehenden sozialen und politischen Systemen. Ob sich Kaufringer in diese Reihe der Kritiker einfilgt, wollen wir nachstehend behandeln.
Anhand der Texte „Die Suche nach dem glilcklichen Ehepaar" (SE) und „Die Rache des Ehemanns" (RE) von Heinrich Kaufringer wollen wir insbesondere die Themen der Ordnung und des Spiels untersuchen, unter dem Gesichtspunkt von „Gewalt & Wahrheit" in mittelhochdeutschen Mären. Wir werden dabei auch auf die Texttiefenstruktur eingehen, das heisst auf Metaphorik und Metonymie. Wie stehen (Kaufringers) Mären zu den damalig vorherrschenden Ordnungsprinzipien und wie werden diese von den Protagonisten gehandhabt? Wie die Handlungen filr oder zuwider der Ordnung legitimiert werden und was genau die Funktion des Spiels ist, sowie die der vermeintlichen Ordnung und Rache, die sich darin spiegeln, wollen wir im zweiten Teil untersuchen. Zieht sich das Spiel und dessen Metaphorik wie ein roter Faden durch die ganze Erzählung? Wir werden ausserdem darauf eingehen, in welchem Verhältnis Gewalt, Spiel und Ordnung stehen. Zur gewaltsamen Wahrheitsförderung oder deren Verschleierung, sowie zur Frage ob die Gesellschaft einer idealisierten Vorstellung entspräche, werden wir ebenfalls im Hauptteil zurilckkehren.
2. Analyse mittelhochdeutscher Mären unter den Gesichtspunkten von Ordnung, Spiel und Gewalt
2.1 Ordnung & Unordnung
Kaufringer zeigt in den Texten (RE und SE) zu Beginn eine Welt in Unordnung („eine von Grund auf böse Welt"[2] ), die vom jeweiligen Protagonisten in eine ordentliche Gesellschaft ilberf hrt werden soll. Die gängige Vorstellung der damaligen Zeit eines gliicklichen Ehepaares (zwuo sel und ainen leib[3] ) in einer heilen Welt wird nicht romantisiert, sondern als Wunschbild demaskiert. Während far Kaufringer die gesellschaftliche Ordnung auf der körperlichen Ebene nur unter Gewaltanwendung hergestellt werden kann (Scheinlösung), ist eine wirkliche Harmonie und Ordnung nur auf dem geistigen Level von Toleranz/Akzeptanz möglich (auch in diversen anderen Schriften aus der damaligen Zeit wird starken Bezug auf die edle geistige Gesinnung genommen[4] ). So werden in RE dem Pfaffen die Genitalien abgeschnitten (körperliche Ebene), wodurch erst die kirchliche Ordnung des Zölibats fur den Pfarrer (wieder) hergestellt wird. Die Ehefrau wiederum wird durch das Abtrennen ihrer Zunge far ihren Fehltritt dem gesellschaftlich korrekten Umgang beraubt: Durch diesen zweiteiligen Racheakt ist die soziale Stellung des Ehegatten wieder intakt (Unterbindung des Ehebruchs) und die Frau bleibt unfähig sich zu verteidigen. Die ordnungsstiftende Funktion der Gewalt in RE ist also offensichtlich. Auch in SE setzen die Ehemänner Gewalt ein, um die gesellschaftliche Ordnung in der Beziehung (vor allem gegen aussen) zu gewährleisten: Das allabendlich erzwungene Trinken der Frau aus dem Schädelbecher des erschlagenen Pfaffen sowie die gewaltsame Entf hrung und Instrumentalisierung des starken Bauern um der gesellschaftlichen Ordnungsfähigkeit der Frau willen zeigen dies deutlich. In einer Kultur, die sich weitgehend tiller körperliche Signale definiert −oder allgemeiner, sich tiller den Körper definiert (l i b = Körper, Leben)−, muss auch Gerechtigkeit auf der körperlichen Ebene ausgetibt werden. Als Gegenpart zu einer wirklich herrschenden Ordnung auf der körperlichen Ebene, die nach Kaufringer nicht existiert, durchläuft der grossziigige Ehemann (SE) einen längeren Lebensabschnitt von körperlicher Enthaltsamkeit und Einsamkeit, welche ihm das Vermögen Ordnung zu schaffen auf dem geistigen Level vermittelt. Dies sieht man an seiner Entwicklung, da er das Laster seiner Frau (den Geiz) zu Beginn als grosses Leiden betrachtete, zum Schluss jedoch weder ordnungswidrig noch bekilmmernswert:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um die angestrebte Ordnung innerhalb der Mären wieder herzustellen, entwirft Kaufringer einen Freiraum, der eine Diskussion der Normen und ein Durchspielen neuer Alternativen zulässt. Dies erreicht er durch ein Verfahren der Literarisierung einerseits und der sozialen Referenz andererseits[7]. Hierfilr kombiniert er verschiedene Gattungsschemata und stellt unterschiedliche Konfliktlösungen unter gesellschaftlichem Licht einander gegenilber. Diese Konflikte werden vom Autor auf der Basis damals gängiger Stereotypen kreiert, um das Problem der Ordnung/Unordnung zu präsentieren: der „falsche" Pfaffe, der den negativen Einfluss auf die Ordnung verkörpert; der Ehemann verletzt auf der körperlichen Ebene (RE), der die Ausweglosigkeit filr die Wiederherstellung der Ordnung repräsentiert; der Ehemann verletzt im Geiste (Stolz), welcher die Hoffnung auf Ordnung darstellt.[5][6]
Die Gewalt als ordnungsstiftende Instanz wird in RE vom gemeinen Volk legitimisiert[8]: Erst anhand dieser Binnenerzählung in RE wird klar, dass Kaufringer die mittelalterliche Rechtsordnung des Kollektivs als letztlich verantwortliche Instanz der öffentlichen Rechtssprechung nicht in Frage stellt. Sie steht im Dienste des edlen Ritters und dient zur (Wieder-)Herstellung der richtigen Ordnung, obschon die Ausfilhrung des Rechtsspruches dem Geschädigten selbst obliegt. So wenig die Eheschliessung ohne das Einverständnis der Verwandten ordnungsmässig ist, so kann diese auch nur mit deren Erlaubnis wieder aufgelöst werden.
[...]
[1] U. Friedrich, Metaphorik des Spiels und Reflexion des Erziihlens bei H. Kaufringer, S. 2
[2] F. Kleffel, 2 002
[3] H. Kaufringer, Die Suche nach dem gliicklichen Ehepaar, S. 768/69, Z. 4
[4] siehe die Reihe der Artusromane; geeignete Eingangslektfire: Hartmann von Aue, Erec
[5] H. Kaufringer, Die Suche nach dem gliicklichen Ehepaar, S. 768/69, Z. 29-39
[6] H. Kaufringer, Die Suche nach dem gliicklichen Ehepaar, S. 794/95, Z. 488-491
[7] U. Friedrich, Metaphorik des Spiels und Reflexion des Erziihlens bei H. Kaufringer, S. 5
[8] H. Kaufringer, Die Rache des betrogenen Ehemannes, S. 762/63 f., Z. 437-487
Häufig gestellte Fragen
Wer war Heinrich Kaufringer?
Heinrich Kaufringer war ein bedeutender Autor mittelhochdeutscher Mären am Ende des 14. Jahrhunderts, bekannt für seine kühle Konsequenz und die Analyse sozialer Normen.
Welche Rolle spielt Gewalt in Kaufringers Mären?
In seinen Erzählungen fungiert Gewalt oft als ordnungsstiftendes Instrument, um gesellschaftliche oder moralische Fehltritte zu sühnen und die soziale Ordnung wiederherzustellen.
Was wird in "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar" thematisiert?
Der Text demaskiert das Idealbild der Ehe und zeigt, dass wahre Harmonie weniger auf körperlicher Gewalt als vielmehr auf geistiger Toleranz und Akzeptanz beruht.
Wie wird Gerechtigkeit auf körperlicher Ebene dargestellt?
In "Die Rache des Ehemanns" wird Gerechtigkeit durch drastische körperliche Strafen (Abschneiden der Zunge/Genitalien) vollzogen, was die damalige Rechtsauffassung widerspiegelt.
Was bedeutet "Metaphorik des Spiels" bei Kaufringer?
Kaufringer nutzt literarische "Spielräume", um gesellschaftliche Normen zu hinterfragen und alternative Konfliktlösungen innerhalb der fiktiven Erzählung durchzuspielen.
Kritisierte Kaufringer die politischen Systeme seiner Zeit?
Unter dem Deckmantel fiktiver Literatur verarbeitete Kaufringer implizit soziale Kritik, indem er die Unordnung der Welt und die Fragwürdigkeit bestehender Ordnungsprinzipien aufzeigte.
- Arbeit zitieren
- Michael Eugster (Autor:in), Florian Kleffel (Autor:in), 2002, Gewalt und Wahrheit in mittelhochdeutschen Texten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139684