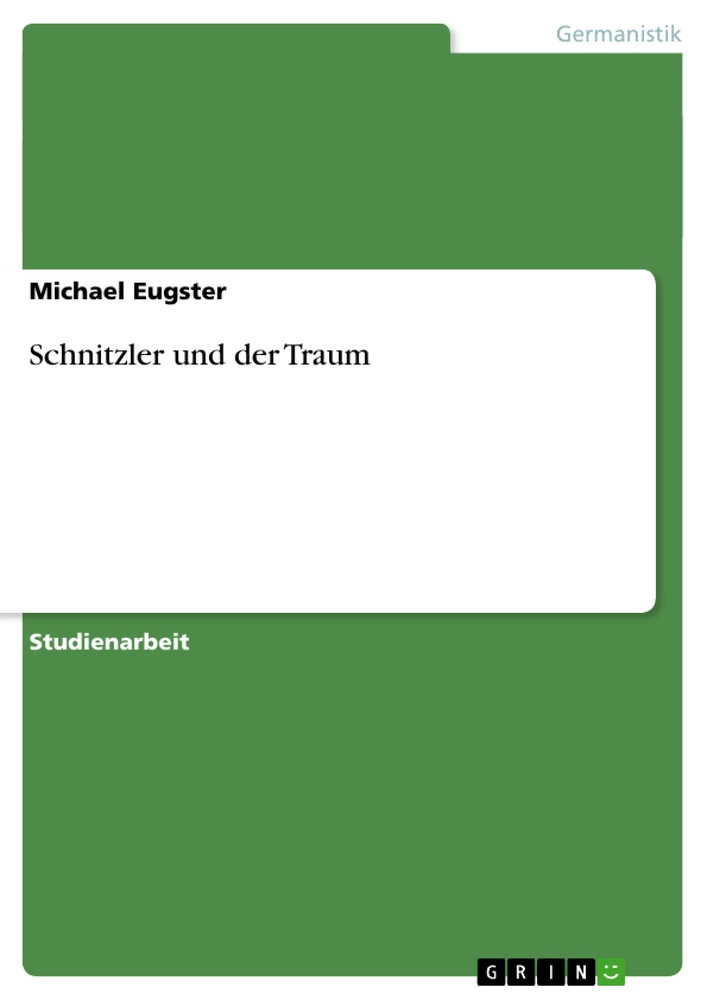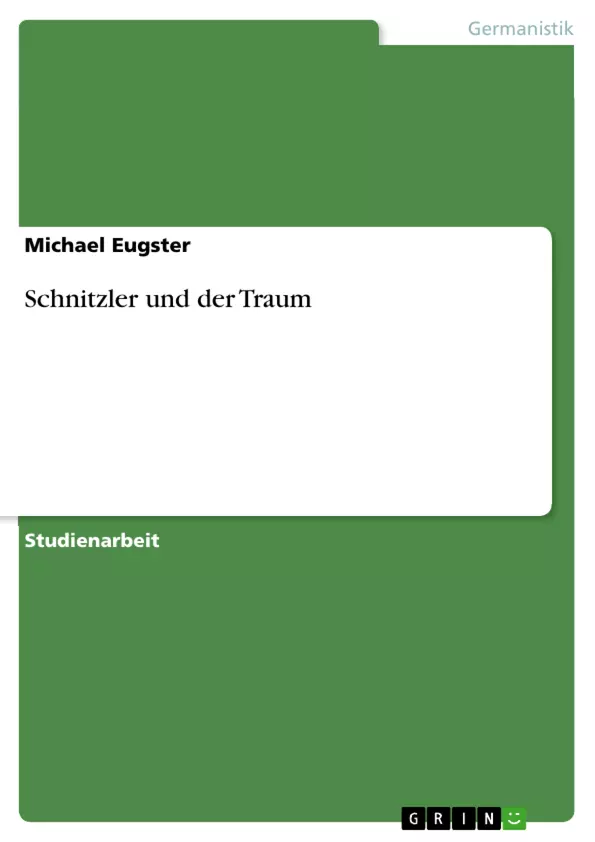Arthur Schnitzler wurde 1862 in Wien als erstes von drei Kindern geboren. Trotz der Ausbildung
zum Arzt war Schnitzler seit jeher vom Schreiben fasziniert und veröffentlichte zahlreiche Werke
während seiner ärztlichen Laufbahn. Im Alter von 69 Jahren verstarb der berühmte Schriftsteller
und geschätzte Arzt, womit sein Leid und seine Qualen endlich ein Ende fanden. Obwohl sich
Schnitzler zwar zeitlebens sehr tapfer verhielt und nichts anmerken lassen wollte, so wurde er
doch innerlich zerfressen von Hypochondrie.1 Schnitzler war sich seines Problems der
Hypochondrie sehr wohl bewusst und suchte fachlichen Rat. Doch eine ständige panische Angst
vor Krankheit und Tod ist auch ein verkapptes Verlangen nach Auflösung, oder gar Erlösung. So
wird der echte Hypochonder erst durch wirkliche Krankheit ‚geheilt’, denn dann ist er am Ziel
seiner geheimen, verbotenen Wünsche und der Leidensdruck fällt von ihm ab.2 Diese
Kombination von Lebenslust und Todeswunsch durchzieht auch beinahe alle Texte von Schnitzler
und eröffnet überhaupt erst das Verständnis für diesen schreibenden Arzt. Seine latente
Todesbesessenheit ist keine typische Einstellung des Jahrhundertwechsels, sondern repräsentiert
sein Innenleben, seine Gefühlswelt. Hier wird auch die therapeutische Funktion des Schreibens
ersichtlich: „Ich verurteile mich gewissermassen zum Tode – um mich ausserhalb des Stückes um
so sicherer begnadigen zu können“ (Schnitzler 1902). Die Vorwegnahme des eigenen Todes in der
Phantasie wird zur Bedingung des Lebens.3 So bin ich geneigt zu behaupten, dass Schnitzlers
gesamtes Leben sich in einer Traumwelt abgespielt hat. In welchem Verhältnis steht also seine
Traumliteratur zur Wirklichkeit? Eben diese Traumwelt polarisiert sich an zwei Enden: Liebe und
Tod/Sterben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kleine Analyse der schnitzler'schen Traumliteratur unter dem Lichte von Liebe, Tod und Träumen
- 2.1 Das Ende allen Anfangs: der Tod
- 2.2 Der Anfang allen Endes: die Liebe
- 2.3 Das Leben, ein Traum? (oder: Träume, der Stoff der uns erst lebensfähig macht)
- 3. Abschliessende Bemerkungen zu Schnitzlers Traumliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Arthur Schnitzlers Traumliteratur, insbesondere in Bezug auf die wiederkehrenden Motive von Liebe, Tod und Träumen. Sie untersucht, wie diese Motive in seinen Werken "Der Sekundant", "Sterben" und "Traumnovelle" dargestellt werden und welche Rolle sie in Schnitzlers Gesamtwerk spielen. Die Analyse beleuchtet den Zusammenhang zwischen Schnitzlers persönlichem Leben und seinen literarischen Werken.
- Die Rolle der Todesangst in Schnitzlers Werk
- Die Ambivalenz von Liebe und Tod in Schnitzlers Erzählungen
- Der Einfluss von Hypochondrie auf Schnitzlers Schaffen
- Die therapeutische Funktion des Schreibens bei Schnitzler
- Die Polarität von Realität und Traum in Schnitzlers Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Leben und Werk Arthur Schnitzlers ein, hebt seine Ausbildung zum Arzt und seine gleichzeitige Leidenschaft fürs Schreiben hervor. Sie betont Schnitzlers Hypochondrie als zentralen Aspekt seines Lebens und seiner Werke, verknüpft diese mit einem latenten Todeswunsch und beleuchtet die therapeutische Funktion seines Schreibens als Verarbeitung dieser inneren Konflikte. Die Einleitung deutet bereits die zentrale Rolle von Liebe und Tod in seiner Traumliteratur an und kündigt die Analyse der Werke "Der Sekundant" und "Sterben" an, um die allgegenwärtige Todesangst und deren Unüberwindbarkeit durch Leben und Liebe zu belegen.
2. Kleine Analyse der schnitzler'schen Traumliteratur unter dem Lichte von Liebe, Tod und Träumen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Analyse und untersucht die Motive von Liebe, Tod und Träumen in Schnitzlers Werk. Es gliedert sich in drei Unterkapitel, die sich jeweils einem dieser zentralen Motive widmen. Durch die detaillierte Auseinandersetzung mit "Sterben" und "Der Sekundant" wird die komplexe Beziehung zwischen Leben, Tod und Liebe in Schnitzlers Schaffen veranschaulicht. Die Kapitel erläutern die therapeutische Funktion seines Schreibens als Verarbeitung seiner inneren Konflikte und zeigen, wie sich diese in seinen Werken manifestieren.
2.1 Das Ende allen Anfangs: der Tod: Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf die Thematik des Todes in Schnitzlers Erzählung "Sterben". Die Analyse beleuchtet die Figur des Felix als Projektionsfläche für Schnitzlers eigene Todesangst und Hypochondrie sowie den Bezug zu seinem Freund Richard Tausenau. Der fatale Verlauf der Hypochondrie bei Felix, seine Beziehung zu Marie und die Reise in die Berge werden als Metaphern für die Auseinandersetzung mit dem Tod interpretiert. Die Ambivalenz von Lebensverachtung und Lebenslust, das ständige Wechselspiel von Annäherung und Abstoßung zwischen Felix und Marie, sowie der letztendliche tragische Ausgang werden umfassend diskutiert. Die Analyse betont die Bedeutung der Polarität von Leben und Tod, Liebe und Hass, als wesentliche Elemente in Schnitzlers Werk.
2.2 Der Anfang allen Endes: die Liebe: (Dieses Kapitel fehlt im vorliegenden Text. Die Inhaltsangabe legt aber nahe, dass es sich hier um eine Auseinandersetzung mit dem Thema Liebe im Kontext der Todesthematik handeln würde. Eine Zusammenfassung müsste auf Basis der gegebenen Informationen spekulativ ergänzt werden.)
2.3 Das Leben, ein Traum? (oder: Träume, der Stoff der uns erst lebensfähig macht): (Dieses Kapitel fehlt im vorliegenden Text. Die Inhaltsangabe legt aber nahe, dass es sich hier um eine Auseinandersetzung mit der Rolle von Träumen als Flucht- und Verarbeitungsmöglichkeit handeln würde. Eine Zusammenfassung müsste auf Basis der gegebenen Informationen spekulativ ergänzt werden.)
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Traumliteratur, Tod, Liebe, Hypochondrie, Todesangst, "Der Sekundant", "Sterben", therapeutische Funktion des Schreibens, Realität und Traum, Polarität, Melancholie.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Schnitzlerschen Traumliteratur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Traumliteratur von Arthur Schnitzler, insbesondere die wiederkehrenden Motive von Liebe, Tod und Träumen in seinen Werken. Der Fokus liegt auf der Darstellung dieser Motive in "Der Sekundant", "Sterben" und "Traumnovelle" und deren Rolle in Schnitzlers Gesamtwerk. Der Zusammenhang zwischen Schnitzlers persönlichem Leben und seinem literarischen Schaffen wird ebenfalls untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse beleuchtet die Rolle der Todesangst in Schnitzlers Werk, die Ambivalenz von Liebe und Tod in seinen Erzählungen, den Einfluss seiner Hypochondrie auf sein Schaffen, die therapeutische Funktion seines Schreibens und die Polarität von Realität und Traum in seiner Literatur.
Welche Werke von Schnitzler werden analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Werke "Der Sekundant" und "Sterben", um die allgegenwärtige Todesangst und deren Unüberwindbarkeit durch Leben und Liebe zu belegen. "Traumnovelle" wird ebenfalls erwähnt, aber weniger detailliert analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel mit drei Unterkapiteln (Tod, Liebe, Traum) und abschließende Bemerkungen. Die Einleitung führt in das Leben und Werk Schnitzlers ein und hebt seine Hypochondrie und die therapeutische Funktion seines Schreibens hervor. Das Hauptkapitel analysiert die zentralen Motive in den ausgewählten Werken. Die abschließenden Bemerkungen fassen die Ergebnisse zusammen.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Das Ende allen Anfangs: der Tod"?
Dieses Unterkapitel analysiert die Todesangst in Schnitzlers "Sterben", interpretiert die Figur des Felix als Projektion Schnitzlers eigener Ängste und beleuchtet die Beziehung zwischen Felix, Marie und Richard Tausenau. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz von Lebensverachtung und Lebenslust sowie dem tragischen Ausgang.
Was ist der Inhalt der Kapitel "Der Anfang allen Endes: die Liebe" und "Das Leben, ein Traum? (oder: Träume, der Stoff der uns erst lebensfähig macht)"?
Die Zusammenfassung dieser Kapitel fehlt im vorliegenden Text. Es wird jedoch angedeutet, dass sie sich mit der Thematik der Liebe im Kontext des Todes und der Rolle von Träumen als Flucht- und Verarbeitungsmöglichkeit befassen würden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arthur Schnitzler, Traumliteratur, Tod, Liebe, Hypochondrie, Todesangst, "Der Sekundant", "Sterben", therapeutische Funktion des Schreibens, Realität und Traum, Polarität, Melancholie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Quote paper
- Michael Eugster (Author), 2002, Schnitzler und der Traum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139692