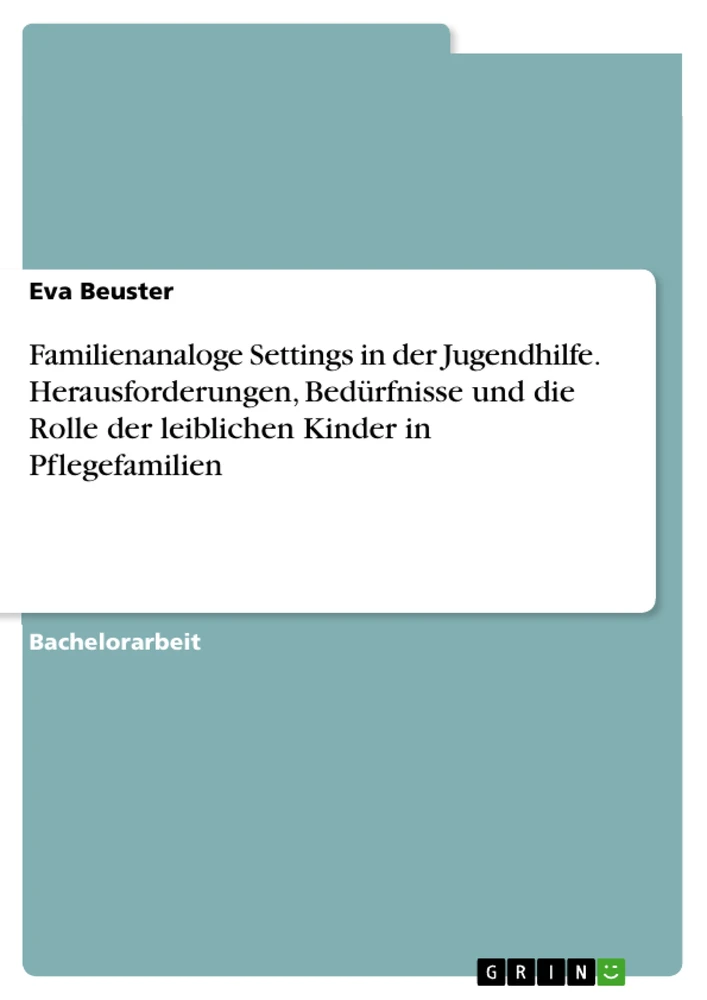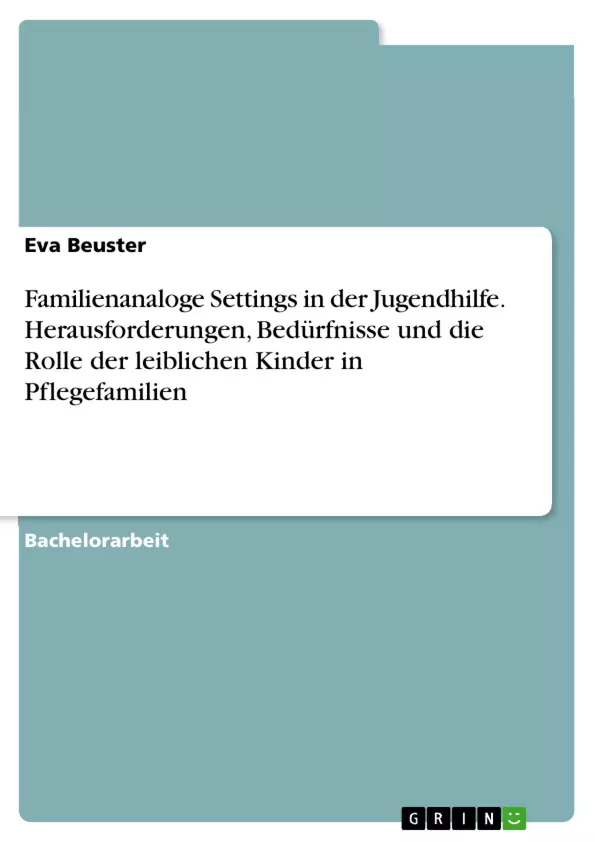Diese Arbeit bietet eine systemische Sicht auf das Leben aller Mitglieder einer Pflegefamilie und eine Betrachtung ihrer Leistungen und Herausforderungen im Hinblick ihrer Grundbedürfnisbefriedigung. Hier finden Studierende so wie Doktorandinnen Ideen für ihre Masterarbeit oder Forschungen. Hier finden Pflegefamilie, SPLGs und Erzieungsstellen Hintergründe im Spagat ihrer Rollen.
Ziel dieser Arbeit ist es zu verdeutlichen, dass es die Vielschichtigkeit im Beziehungsgeflecht aller in familienannalogen Settings zusammenlebender, handelnder, fühlender und sich entwickelnder Menschen zu beachten, zu verstehen und zu unterstützen gilt, damit alle Akteure und Adressaten der HzE ihre diesbezüglichen Entwicklungsaufgaben gesund meistern können. Besondere Beachtung findet hierbei das Zusammenleben mit leiblichen Kinder der Pflegeeltern. Die damit verbundene Darstellung der Notwendigkeit weiterer Evaluation quantitativer und qualitativer Forschungsfragen ist ebenso Bestandteil dieser Arbeit.
Zu Beginn wird die heutige Familie in ihrer Formenvielfalt und Alltagsstruktur dargestellt. Mit der Bedeutung der Grundbedürfnisse eines jeden Individuums der Familie, wird auf die Notwendigkeit ihrer Erfüllung Bezug genommen, bevor dann auf die Bedeutung der Geschwisterbeziehung für die Entwicklung beider Kinder und die Arbeit der Maßnahmeneltern eingegangen wird.
Die Relevanz außerfamiliärer Einflüsse auf die Pflegefamilie darf nicht außer Acht gelassen werden, weswegen die gesetzliche und strukturelle Einordnung familienanaloger Settings in Deutschland hier anschließt. Die unterschiedlichen parallel-wissenschaftlichen Erkenntnisse werden dann in Hinblick auf eventuelle Differenzierung der Settings von Familien "mit" und "ohn" leibliche Kinder analysiert. Im Zuge des Qualitätsdiskurses wird nach einer Generalisierbarkeit bedeutsamer Wirkfaktoren für Pflegefamilien gefragt.
Aufgrund des formellen Rahmens einer BT können alle einbezogenen Theorien nur begrenzt dargestellt werden. Ausführlichere Informationen sind unter den Quellenangaben und im Anhang zu finden. Dort finden sich auch div. Abbildungen und Tabellen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- I Die Rolle der Familie
- 1.1 Familienformen
- 1.2 Familienkulturen
- 1.3 Familiärer Alltag
- 1.4 Psychische Grundbedürfnisse
- 1.5 Zusammenfassung
- II Geschwisterbeziehungen
- 2.1 Geschwisterbeziehungen - das beeinflussende und beeinflusste Gefüge
- 2.2 Bedeutung der Geschwisterbeziehung füreinander
- 2.3 Besondere Geschwisterbeziehungen
- 2.4 Zusammenfassung
- III Institutioneller und gesetzlicher Rahmen familienanaloger Settings der Jugendhilfe
- 3.1 Rechtliche Regelungen
- 3.2 Qualitätsdiskurs
- 3.3 Zusammenfassung
- IV Leben, Entwickeln und Scheitern familienanaloger Settings mit leiblichen Kindern
- 4.1 Ursprungseltern, Herkunftseltern
- 4.2 Maßnahmenkinder, Pflegekinder, Erziehungsstellenkinder
- 4.3 Pflegefamilien/ Erziehungsstellen-/ Kinderhaus-/ Betreibereltern
- 4.4 Leibliche Kinder der Maßnahmeneltern
- 4.5 Sicheres, konstantes Zuhause versus unsteter Lebensabschnitte u. Heimkarrieren
- V Familie sein mit leiblichem Kind und Pflegekind ist mehr als die Addition von Kindern
- 5.1 Innerfamiliäre Ebenen
- 5.2 Ebene der Jugendhilfe/ des Auftrages
- 5.3 Resümee, Konsequenz
- VI Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss leiblicher Kinder auf die Qualität von familienanalogen Settings in der stationären Jugendhilfe. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration leiblicher Kinder in diese Settings verbunden sind. Das Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die besonderen Bedürfnisse und Dynamiken in solchen Familienkonstellationen zu entwickeln und daraus Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten.
- Die Rolle der Familie in verschiedenen Formen und Kulturen
- Die Bedeutung von Geschwisterbeziehungen in familienanalogen Settings
- Der rechtliche und institutionelle Rahmen der Jugendhilfe
- Die Lebensbedingungen und Herausforderungen von Familien mit leiblichen und Pflegekindern
- Die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen der Integration von leiblichen Kindern in familienanalogen Settings
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I beleuchtet die Rolle der Familie in ihren verschiedenen Formen und Kulturen, die Bedeutung des familiären Alltags und die psychischen Grundbedürfnisse von Familienmitgliedern. Kapitel II untersucht die vielfältigen Aspekte von Geschwisterbeziehungen und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Kapitel III widmet sich dem rechtlichen und institutionellen Rahmen der Jugendhilfe, insbesondere den Qualitätsstandards und Herausforderungen im Bereich der familienanalogen Settings. Kapitel IV analysiert die Lebensbedingungen und Herausforderungen von Familien mit leiblichen und Pflegekindern, die in familienanalogen Settings leben, sowie die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen der Integration von leiblichen Kindern in diese Settings.
Schlüsselwörter
Familienanaloge Settings, Jugendhilfe, Leibliche Kinder, Pflegekinder, Geschwisterbeziehungen, Familienformen, Familienkulturen, Rechtliche Regelungen, Qualitätsdiskurs, Lebensbedingungen, Integration, Herausforderungen, Chancen, Handlungsempfehlungen, Psychische Grundbedürfnisse
- Quote paper
- Eva Beuster (Author), 2017, Familienanaloge Settings in der Jugendhilfe. Herausforderungen, Bedürfnisse und die Rolle der leiblichen Kinder in Pflegefamilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1397733