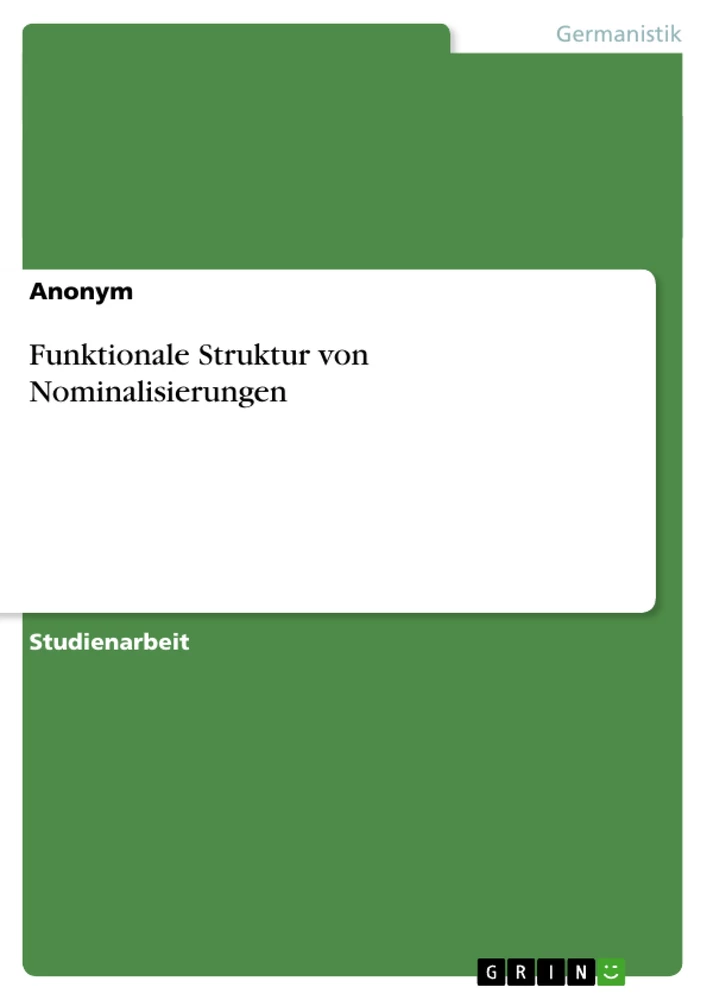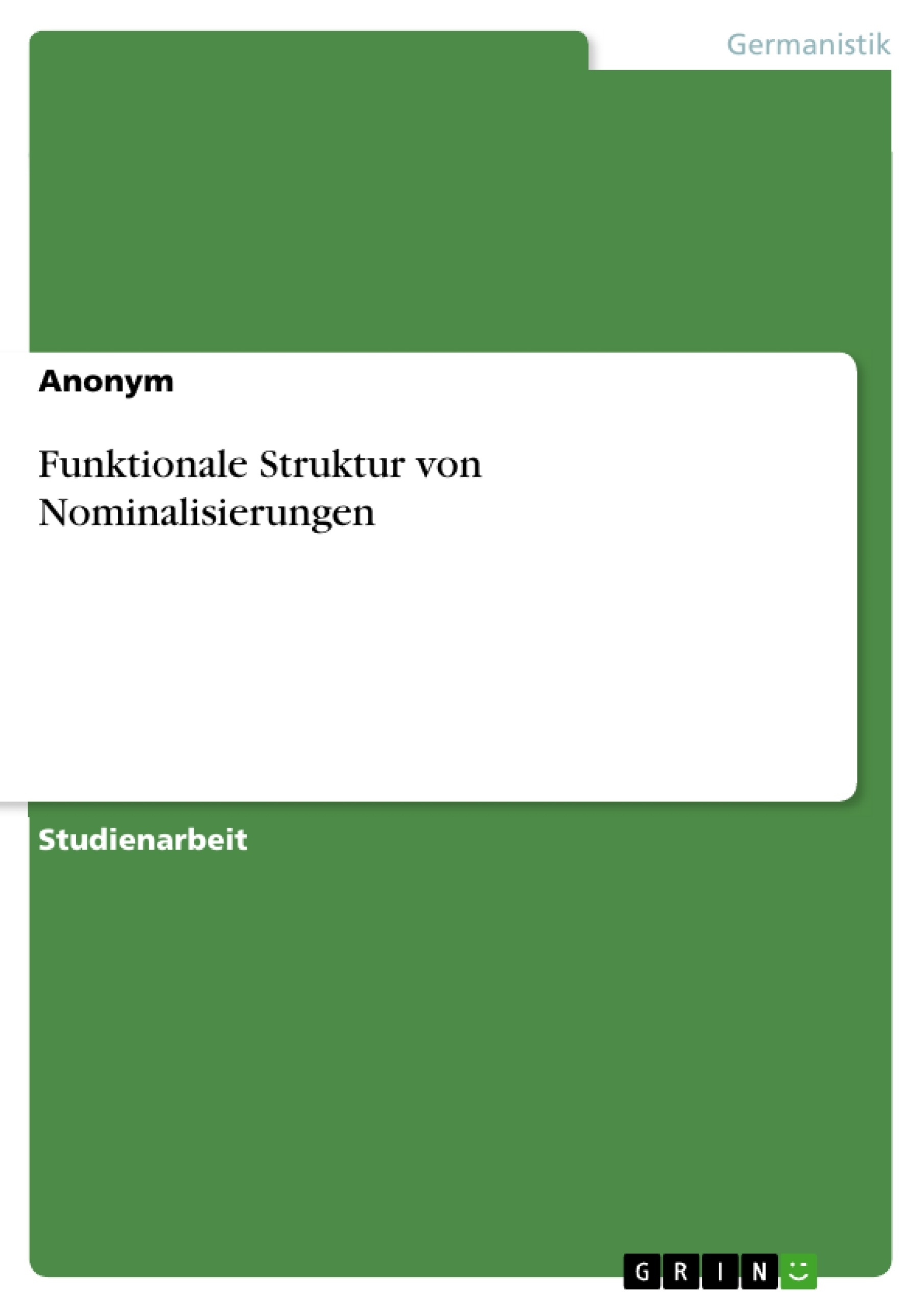Die Forschungen zum Verhalten von Nominalphrasen in verschiedenen Sprachen führen zu dem Schluss, dass Nominalphrasen eine ähnliche (funktionale) Struktur haben wie Sätze. Da Sätze von einer funktionalen Projektion dominiert werden, wird das auch für Nominalphrasen angenommen. Seit Abney (1987) wird die funktionale Struktur, die die Nominalphrase dominiert, standardmäßig Determiniererphrase genannt (DP-Hypothese). Die Konstruktionen, in denen die NP einem Satz am ähnlichsten ist, sind die Gerundien (im Englischen V+-ing). Außerdem ist zu beobachten, dass Nomen die Eigenschaft haben können, Argumente zu nehmen. Die Frage, woher die Nomen diese Eigenschaft haben und wie die Bildung der Nomen stattfindet, führte zu einer Diskussion bzw. Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Ansätzen. Hierbei gibt es den syntaktischen und den lexikalischen Ansatz. Wie Alexiadou et al. (2007) schreiben, gab es zu Beginn der Debatte um die beiden Ansätze nur eine syntaktische Erklärung. Lees (1960) ging dabei von einem syntaktischen/transformationellen Prozess aus, der bei Sätzen und somit auch bei satzähnlichen Nomen abläuft. Er ging dabei davon aus, dass gemeinsame Eigenschaften nur über die Struktur gezeigt werden können. Erst Chomsky (1970) hat im Lexikon gespeicherte Merkmale ([N], [V]) eingeführt, durch die Ähnlichkeiten ausgedrückt werden können. Seit dem gibt es auch Ansätze, nach denen die Wortformation in der Syntax stattfindet und außerdem Ansätze, bei denen die Formation im Lexikon und der Syntax erfolgt. Grimshaw (1990) vertritt den lexikalischen Ansatz. Sie unterscheidet result, simple event und
complex event Nominale (result: dog (R); simple event: trip(R); complex event: destruction (EV)). Für für die result und simple event Nominale nimmt sie ein (R) im Lexikoneintrag an. Dies ist ein externes Argument, dass benötig wird, um die NP in den Satz einzubinden. Das externe Argument der complex event Nominale ist (EV). Ist das EV-Argument im Lexikoneintrag vorhanden, führt dies zu einer Event- bzw. Prozess-Lesart und dazu, dass das Nomen ein Argument nimmt. Borer (1999) äußert Kritik an Grimshaws Annahmen und unterscheidet nur noch zwischen referentiellen (R-)Nominalen, die keine Argumente nehmen und Argumentstruktur(AS)-Nominalen, die Argumente nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verbale Struktur in der DP
- 3. Evidenzen für eine Aspektphrase (AspP) innerhalb der DP
- 3.1 Adverbien
- 3.2 Aspekt in der Morphologie
- 3.3 Aspektuelle Unterschiede in Nominalisierungen
- 3.3.1 -ing und -ion Nominalisierungen
- 3.3.2 -ung-Nominalisierungen im Deutschen
- 3.3.3 Passiv-Nominalisierungen im Englischen
- 3.3.4 -ma/mo- vs. nicht -ma/mo-Nominalisierung im Griechischen
- 4. Evidenzen für eine Numberphrase (NumP)
- 5. Evidenz für eine Klassifiziererphrase (ClassP)
- 6. Weitere Projektionen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die funktionale Struktur von Nominalphrasen (DPs) in verschiedenen Sprachen. Ziel ist es, die syntaktische Struktur von deverbalen Nominalisierungen zu beleuchten und die Debatte um syntaktische versus lexikalische Ansätze in der Wortbildung zu diskutieren.
- Funktionale Struktur von Nominalphrasen
- Syntaktische vs. lexikalische Ansätze in der Wortbildung
- Evidenz für funktionale Projektionen innerhalb der DP (AspP, NumP, ClassP)
- Analyse deverbaler Nominalisierungen
- Vergleich verschiedener Sprachen (Deutsch, Englisch, Griechisch)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung legt die Grundlage der Arbeit dar, indem sie die DP-Hypothese (Determiniererphrase) einführt und die These aufstellt, dass Nominalphrasen eine ähnliche funktionale Struktur wie Sätze besitzen. Die Arbeit vergleicht syntaktische und lexikalische Ansätze zur Erklärung der Eigenschaften von Nominalisierungen, insbesondere Gerundien und deverbalen Nominalen, die die Fähigkeit besitzen, Argumente zu nehmen. Dies führt zur zentralen Frage nach dem Ursprung dieser Fähigkeit und der Bildungsprozesse dieser Nominalisierungen.
2. Verbale Struktur in der DP: Dieses Kapitel argumentiert für das Vorhandensein verbaler Struktur innerhalb der DP, indem es sich auf die Analyse deverbaler Prozess-Nominalisierungen konzentriert. Es stützt sich auf die Arbeiten von Fu et al. (2001), die den syntaktischen Ansatz vertreten und die Existenz einer VP (Verbphrase) innerhalb der DP postulieren. Als Evidenz werden das Auftreten von VP-Adverbien und die Verwendung der "do so"-Anapher innerhalb dieser Nominalisierungen angeführt, die als Indikatoren für die verbale Natur dieser Konstruktionen dienen.
3. Evidenzen für eine Aspektphrase (AspP) innerhalb der DP: Dieses Kapitel erweitert die Analyse, indem es argumentiert, dass die verbalen Eigenschaften von Prozess-Nominalen nicht nur durch das Vorhandensein von VP-Struktur, sondern spezifischer durch eine Aspektphrase (AspP) erklärt werden können. Es werden verschiedene Evidenzen präsentiert, darunter das Auftreten von Adverbien, Aspekte der Morphologie und aspektuelle Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Nominalisierungen in verschiedenen Sprachen, um die Existenz der AspP zu untermauern. Die unterschiedlichen Nominalisierungstypen (z.B. -ing, -ion, -ung) und ihre jeweiligen Aspektmerkmale werden detailliert verglichen und analysiert.
Schlüsselwörter
Nominalphrase, DP-Hypothese, Deverbale Nominalisierungen, Wortbildung, Syntaktischer Ansatz, Lexikalischer Ansatz, Aspektphrase (AspP), Prozess-Nominale, Result-Nominale, Adverbien, do so-Anapher, Griechisch, Englisch, Deutsch.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Funktionale Struktur von Nominalphrasen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die funktionale Struktur von Nominalphrasen (DPs) in verschiedenen Sprachen, insbesondere die syntaktische Struktur deverbaler Nominalisierungen. Sie diskutiert die Debatte zwischen syntaktischen und lexikalischen Ansätzen in der Wortbildung.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Nominalphrasenstruktur im Deutschen, Englischen und Griechischen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die syntaktische Struktur deverbaler Nominalisierungen zu beleuchten und die Debatte um syntaktische versus lexikalische Ansätze in der Wortbildung zu diskutieren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Evidenz für funktionale Projektionen innerhalb der DP (AspP, NumP, ClassP).
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Hauptthemen sind die funktionale Struktur von Nominalphrasen, syntaktische vs. lexikalische Ansätze in der Wortbildung, die Analyse deverbaler Nominalisierungen und die Evidenz für funktionale Projektionen (AspP, NumP, ClassP) innerhalb der DP.
Was ist die DP-Hypothese?
Die Arbeit basiert auf der DP-Hypothese, die besagt, dass Nominalphrasen eine ähnliche funktionale Struktur wie Sätze besitzen.
Welche Evidenzen werden für eine Aspektphrase (AspP) innerhalb der DP angeführt?
Die Existenz einer AspP wird durch das Auftreten von Adverbien, Aspekte der Morphologie und aspektuelle Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Nominalisierungen (z.B. -ing, -ion, -ung Nominalisierungen) in verschiedenen Sprachen gestützt.
Welche Arten von Nominalisierungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Arten von Nominalisierungen, darunter -ing und -ion Nominalisierungen im Englischen, -ung-Nominalisierungen im Deutschen, Passiv-Nominalisierungen im Englischen und -ma/mo- vs. nicht -ma/mo-Nominalisierungen im Griechischen.
Wie wird die verbale Struktur in der DP begründet?
Die verbale Struktur in der DP wird durch die Analyse deverbaler Prozess-Nominalisierungen begründet, wobei das Auftreten von VP-Adverbien und die Verwendung der "do so"-Anapher als Evidenz dienen.
Welche Rolle spielen syntaktische und lexikalische Ansätze in der Wortbildung?
Die Arbeit vergleicht und diskutiert die syntaktischen und lexikalischen Ansätze zur Erklärung der Eigenschaften von Nominalisierungen, insbesondere die Fähigkeit deverbaler Nominalisierungen, Argumente zu nehmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Nominalphrase, DP-Hypothese, Deverbale Nominalisierungen, Wortbildung, Syntaktischer Ansatz, Lexikalischer Ansatz, Aspektphrase (AspP), Prozess-Nominale, Result-Nominale, Adverbien, do so-Anapher, Griechisch, Englisch, Deutsch.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Funktionale Struktur von Nominalisierungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139774