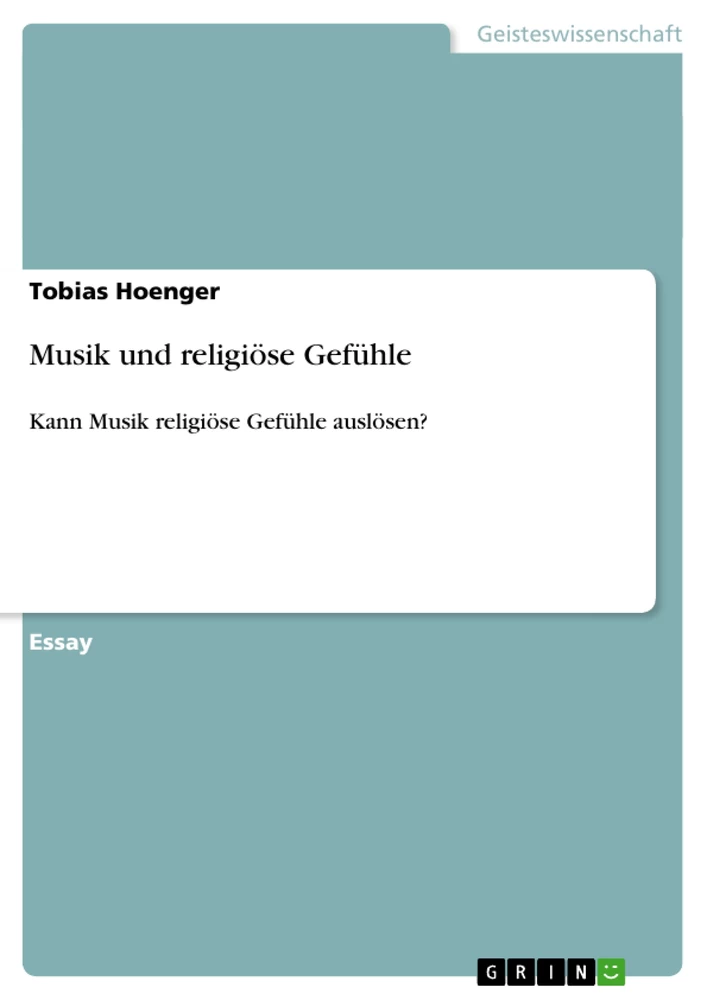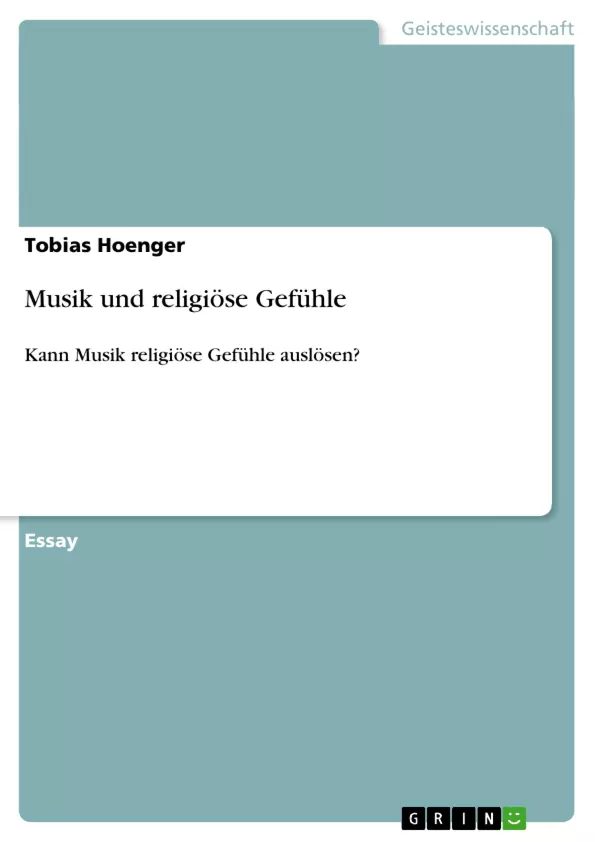Dass Schleiermacher einen Bezug hat zur Musik ist in der Literatur nicht unbekannt. In seinen Predigten an Gottesdiensten war der zentrale Punkt, Theologie und Musik zu vereinen.
Auch in zwei seiner Bücher fällt ein gewisser Enthusiasmus zur Musik auf. In der vierten Rede schreibt er: „So wie eine solche Rede Musik ist auch ohne Gesang und Ton, so ist auch eine Musik unter den Heiligen, die zur Rede wird ohne Worte, zum bestimmtesten, verständlichsten Ausdruck des Innersten.“
Musik braucht keine Worte, die Musik alleine erklärt sich selbst und sagt mit dem Ton, mit dem Klang, das aus, was sie aussagen möchte. Vergleichend zu dieser Textstelle in der vierten Rede, ist mir eine Stelle aufgefallen in der Weihnachtsfeier, er schreibt: „… Eduard sagte, […] es ist auch gewiss wahr, was jemand gesagt hat, dass die Kirchenmusik nicht des Gesanges, wohl aber der bestimmten Worte entbehren könnte. […] Es ist verständlich genug durch seinen Charakter; und niemand wird sagen, es sei ihm etwas entgangen, wenn er die untergelegten Worte nicht vernommen hat. Darum müssen beide fest aneinander halten, Christentum und Musik, weil beide einander verklären und erheben.“
So stellt Schleiermacher schon hier klar, dass Musik und Religion nicht nur miteinander in Verbindung stehen, sondern einander ergänzen, dass geradezu eine Abhängigkeit der beiden besteht.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Weihnachtsfeier
2.1 Das Szenario
2.2 Das Gespräch
2.3 Die Rolle der Musik
3. Religiöse Gefühle durch Musik
3.1 Von Bach bis Bruckner
4. Fazit
1. Einleitung
Zu Beginn möchte ich kurz erläutern, wie ich zu meiner Themenwahl gekommen bin.
Es war ziemlich schnell klar, dass es Schleiermacher sein muss. Sein Text, „über das Wesen der Religion“, hat mich fasziniert und zum Nachdenken angeregt. Zugegeben, ich musste den Text oft reflektieren und ich bin auch über einige Worte gestolpert. Dennoch ist Schleiermachers Art über die Religion und die damit verbundenen Gefühle zu schreiben, einmalig. Als ich seine „zweite Rede“ durchlas auf der Suche nach einer Idee, geriet ich an eine markierte Stelle: „Alles eigentliche Handeln soll moralisch sein und kann es auch, aber die religiösen Gefühle sollen wie eine heilige Musik alles Tun des Menschen begleiten; er soll alles mit Religion tun, nichts aus Religion.“[1]
Nach dem Lesen dieses Satzes bestünde die Möglichkeit, etliche Seiten zu füllen über das Thema, Fanatismus innerhalb der Religion(en). Es ist mir jedoch etwas anderes aufgefallen; „… die religiösen Gefühle sollen wie eine heilige Musik alles Tun des Menschen begleiten; …“ Schleiermacher bringt die Musik ins Spiel. Genauer, die heilige Musik. Was ist für ihn eine heilige Musik? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Musik und religiösen Gefühlen? Wenn ja, welches Musik Genre würde am ehesten religiöse Gefühle auslösen?
Diese Fragen haben mich zu meiner Hauptfragestellung geführt:
Kann Musik religiöse Gefühle auslösen?
Um es gleich vorwegzunehmen, diese Fragestellung kann unmöglich sachlich und rein objektiv behandelt werden, darum werden meine Beantwortungsversuche grösstenteils subjektiv ausfallen. Dennoch gibt es eine Möglichkeit das Thema, religiöse Gefühle und Musik, philosophisch sachlich anzugehen und dabei den Bezug zu Schleiermacher zu bewahren. Nämlich mit dem Buch, „Die Weihnachtsfeier“. Innerhalb von drei Wochen von Schleiermacher geschrieben und im Januar 1806 veröffentlicht.
Meine Arbeit ist daher in zwei Teile gegliedert. In einem ersten Versuch werde ich „Die Weihnachtsfeier“ behandeln, um so Schleiermachers Verständnis von Musik im Zusammenhang mit religiösen Gefühlen besser zu verstehen. Im zweiten Teil werde ich mich behutsam an verschiedene Musikstücke herantasten und versuchen diese in Verbindung zu bringen mit religiösen Gefühlen.
2. Die Weihnachtsfeier
2.1 Das Szenario
Das Szenario, das Schleiermacher beschreibt, ist einfach, (im Gegensatz zum Inhalt der Gespräche). [2] Es kommt eine Gemeinschaft, die sich kennt, an Weihnachten zusammen, um in geselliger Runde zu feiern. Aus dem anfänglichen Geschenke Austausch, der in heiterer Stimmung geschieht, wird eine Gesprächsrunde. Die Kommentare der Einzelnen sind manchmal scherzhaft, manchmal ernst. Der Mittelpunkt der Diskussionen ist oft die kleine Sofie, Tochter von Ernestine und Eduard, die wahrscheinlich auch die Gastgeber sind. Weitere Personen in der Runde sind: Anton der Schüler, Agnes, seine Mutter, Friederike und Ernst, Karoline und Leonhardt, der gerne kritisiert aber mit seinen provokativen Fragen auch den Gesprächsfluss aufrecht erhält. Auf den letzten Seiten kommt dann noch ein Freund der der Familie hinzu, Josef.
2.2 Das Gespräch
Schleiermacher legt in seiner Erzählung fast keinen Wert auf die Handlungen. So zieht zum Beispiel das Nachtessen, (eigentlich ein zentraler Punkt bei einer Weihnachtsfeier), mit nur einem Satz vorüber. Das Wichtigste sind die Reden der Personen.
Leonhardt bringt das Gespräch erstmals in Gang, als er seine Bedenken in Bezug auf Sofies Frömmigkeit äussert. Sofie, die sehr musikalisch ist und von der Kirchenmusik angetan, lenkt das Gespräch der Erwachsenen auf die Kunst und die Religion und so auch auf die Musik und die Religion. Es wird jedoch nicht allzu lang bei diesem Thema verharrt. Es geschieht ein fliessender Übergang, wieder von Sofie ausgehend, über das kindliche Dasein zu einer längeren Diskussion über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mann und Frau bezüglich des Christentums. Ernestine verspürt plötzlich den Drang über vergangene Weihnachtsfeste zu berichten, dies untermalt Friederike musikalisch. Auch hier ist der zentrale Punkt, wie schon oft in vorherigen Abschnitten erwähnt, das Marienbild in einer liebenden Mutter. Es meldet sich einmal mehr Leonhardt zu Worte, mit dem Einwand das Gesprächsthema endgültig festzulegen. Es geht von nun an um die Weihnachtsfeier an und für sich. Die drei Männer in der Runde, Leonhardt, Ernst und Eduard, geben ihre Ansichten preis über das Fest zu Weihnachten, wobei das Christentum nunmehr den Gesprächskern bildet. Die Frauen stimmen zu und geben ab und zu kleinere Kommentare ab. In erster Linie haben sie das Privileg zuzuhören. Die Reden der Männer ziehen sich hin, bis am Schluss Josef erscheint, der dem Ganzen ein Ende bereitet. Er sieht den Sinn von Weihnachten nicht in Reden und Worten, sondern das einzige wahre Weihnachtsgefühl, sagt er, kommt hervor, wenn man in guter Gesellschaft zusammen musiziert. Oder wie es die letzten Worte von Schleiermachers Buch sagen, „… etwas Frommes und Fröhliches singen.“
2.3 Die Rolle der Musik
Dass Schleiermacher einen Bezug hat zur Musik ist in der Literatur nicht unbekannt. In seinen Predigten an Gottesdiensten war der zentrale Punkt, Theologie und Musik zu vereinen.[3]
Auch in zwei seiner Bücher fällt ein gewisser Enthusiasmus zur Musik auf. In der vierten Rede schreibt er: „So wie eine solche Rede Musik ist auch ohne Gesang und Ton, so ist auch eine Musik unter den Heiligen, die zur Rede wird ohne Worte, zum bestimmtesten, verständlichsten Ausdruck des Innersten.“[4]
Musik braucht keine Worte, die Musik alleine erklärt sich selbst und sagt mit dem Ton, mit dem Klang, das aus, was sie aussagen möchte. Vergleichend zu dieser Textstelle in der vierten Rede, ist mir eine Stelle aufgefallen in der Weihnachtsfeier, er schreibt: „… Eduard sagte, […] es ist auch gewiss wahr, was jemand gesagt hat, dass die Kirchenmusik nicht des Gesanges, wohl aber der bestimmten Worte entbehren könnte. […] Es ist verständlich genug durch seinen Charakter; und niemand wird sagen, es sei ihm etwas entgangen, wenn er die untergelegten Worte nicht vernommen hat. Darum müssen beide fest aneinander halten, Christentum und Musik, weil beide einander verklären und erheben.“[5]
So stellt Schleiermacher schon hier klar, dass Musik und Religion nicht nur miteinander in Verbindung stehen, sondern einander ergänzen, dass geradezu eine Abhängigkeit der beiden besteht.
Nun geht es einen Schritt weiter. Es gilt die Frage zu klären, was Musik mit einem religiösen Gefühl zu tun hat. Hierzu bietet uns Schleiermacher in der Weihnachtsgeschichte eine weitere, viel zitierte, Textstelle. Es spricht Eduard: „Denn jedes schöne Gefühl tritt nur dann recht vollständig hervor, wenn wir den Ton dafür gefunden haben; nicht das Wort, dies kann immer nur ein mittelbarer Ausdruck sein, nur ein plastisches Element, wenn ich so sagen darf, sondern den Ton im eigentlichen Sinne. Und gerade dem religiösen Gefühl ist die Musik am nächsten verwandt.“[6]
[...]
[1] Schleiermacher, Friedrich: Über die Religion, Reclam, Stuttgart 2007, 47.
[2] Schleiermacher, Friedrich: Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch, Darmstadt 1984.
[3] vgl.: Schmidt, Bernhard: Lied – Kirchenmusik – Predigt im Festgottesdienst Friedrich Schleiermachers. Zur Rekonstruktion seiner liturgischen Praxis (Band 20), Berlin 2002.
[4] Schleiermacher, Friedrich: Über die Religion, Reclam, Stuttgart 2007, 123.
[5] Schleiermacher, Friedrich: Die Weihnachtsfeier, Darmstadt 1984, 24.
[6] Schleiermacher, Friedrich: Die Weihnachtsfeier, Darmstadt 1984, 23.
Häufig gestellte Fragen
Kann Musik religiöse Gefühle auslösen?
Laut Schleiermacher besteht eine enge Verwandtschaft zwischen Musik und Religion. Musik kann das "Innerste" ausdrücken und religiöse Gefühle oft unmittelbarer wecken als Worte.
Welche Rolle spielt die Musik in Schleiermachers "Die Weihnachtsfeier"?
In dem Buch wird deutlich, dass das wahre Weihnachtsgefühl nicht durch lange Reden, sondern durch das gemeinsame Musizieren und Singen ("etwas Frommes und Fröhliches") entsteht.
Warum brauchen religiöse Gefühle laut Schleiermacher Musik?
Schleiermacher argumentiert, dass Worte nur mittelbare Ausdrücke sind, während der "Ton im eigentlichen Sinne" den vollständigsten Ausdruck für ein schönes, religiöses Gefühl darstellt.
Was ist der Kern von Schleiermachers Verständnis von Kirchenmusik?
Er glaubte, dass Kirchenmusik auch ohne bestimmte Worte verständlich ist, da ihr Charakter allein ausreicht, um das Christentum zu verklären und zu erheben.
Wie hängen Moral, Handeln und religiöse Musik zusammen?
Schleiermacher schreibt, dass religiöse Gefühle wie eine "heilige Musik" alles Tun des Menschen begleiten sollten; man soll alles mit Religion tun, aber nicht zwingend aus Religion.
- Citation du texte
- Tobias Hoenger (Auteur), 2008, Musik und religiöse Gefühle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139784