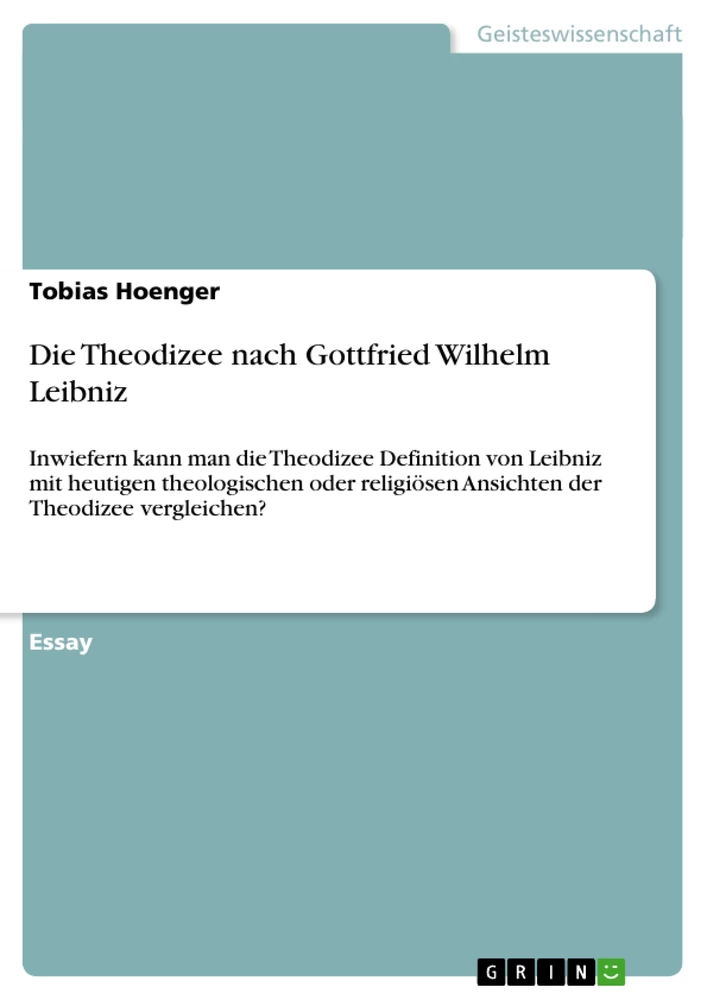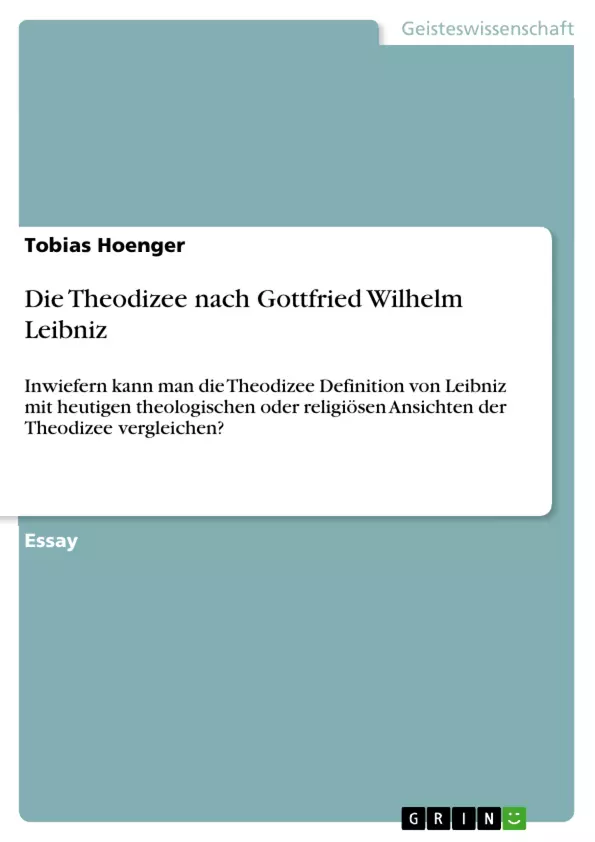Obwohl man die Theodizee schon vor Leibniz kannte, war er mit seinem Werk, „Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal“ (1710), der Erste, der die Begrifflichkeit für die Zukunft prägte.
Leibniz geht davon aus, dass das Übel auf dieser Welt teilweise von Gott erschaffen wurde. Gott hat sich dennoch für die bestmögliche Welt entschieden und das ist die, in der wir leben. Gott konnte gar nicht anders als die bestmögliche Welt erschaffen, denn hätte er eine andere Möglichkeit erkennen können, würde das heissen er wäre nicht allwissend. Hätte er sie erkannt, konnte sie aber nicht umsetzen, so wäre er nicht allmächtig. Hätte Gott die Möglichkeit erkannt, und hätte sie auch umsetzen können, wollte es aber nicht, so wäre er kein guter Gott.
Leibniz unterscheidet drei Klassen des Übels: malum morale (das moralische Übel) wie z.B. die Sünden, malum physicum (das physikalische Übel) wie z.B. das Leiden und das malum metaphysicum (das metaphysische Übel). Wobei die ersten zwei Klassen bereits bei Augustinus auftauchten. Das moralische Übel und das physikalische Übel ergeben sich zwangsläufig aus dem metaphysischen Übel, welches auf die Unvollkommenheitsfrage des Menschen abzielt. Der Schöpfer (Gott) ist vollkommen und hat die Welt mit Absicht nicht vollkommen erschaffen. Hätte er das getan, wäre jedes Streben und somit jedes menschliche Handeln überflüssig. Zudem wäre das Schaffen einer Identität, (etwas Vollkommenes schafft etwas Vollkommenes), nicht das Ziel Gottes gewesen. Er wollte etwas völlig Neues schaffen, so Leibniz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theodizee nach Gottfried Wilhelm Leibniz
- 2.1 Biographischer Abriss
- 2.2 "Essais de théodicée"
- 2.3 Nachwirkungen von Leibniz' Theodizee
- 3. Theodizee heute
- 3.1 Definition
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theodizee-Konzeption Gottfried Wilhelm Leibniz' und vergleicht sie mit heutigen theologischen und religiösen Perspektiven. Das Hauptziel ist es, die Relevanz und Beständigkeit, aber auch die Grenzen von Leibniz' Argumentation im zeitgenössischen Kontext zu beleuchten.
- Leibniz' Theodizee-Konzept und seine zentralen Argumente
- Die drei Übelkategorien bei Leibniz (malum morale, malum physicum, malum metaphysicum)
- Der Einfluss von Pierre Bayle auf Leibniz' Denken
- Die Nachwirkungen von Leibniz' Theodizee auf spätere philosophische und theologische Diskussionen
- Vergleich der Leibnizschen Theodizee mit modernen theologischen Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Entstehungsprozess der Arbeit und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit der komplexen Thematik der Theodizee auseinanderzusetzen. Die Autorin beschreibt ihren Zugang zum Thema über die Werke von Dorothee Sölle und erklärt ihre Entscheidung, sich statt einer direkten Auseinandersetzung mit der Existenz eines gerechten Gottes auf die Begrifflichkeit der Theodizee und die Prägung des Begriffs durch Leibniz zu konzentrieren. Die zentrale Forschungsfrage wird formuliert: Inwiefern lässt sich Leibniz' Theodizee-Definition mit heutigen theologischen oder religiösen Ansichten vergleichen?
2. Theodizee nach Gottfried Wilhelm Leibniz: Dieses Kapitel befasst sich mit Leibniz' Leben und Werk. Es gibt einen kurzen biographischen Abriss, der Leibniz' vielseitige wissenschaftliche und philosophische Aktivitäten beleuchtet. Der Fokus liegt auf Leibniz' "Essais de théodicée", in dem er seine Auffassung von der Welt als der bestmöglichen Welt darlegt und die drei Übelkategorien (moralisch, physisch, metaphysisch) unterscheidet. Leibniz' Argumentation, dass Gott die bestmögliche Welt erschaffen hat und das Böse aus der menschlichen Freiheit resultiert, wird detailliert dargestellt. Der Einfluss von Pierre Bayle auf Leibniz' Denken wird hervorgehoben. Schliesslich wird kurz der Einfluss von Leibniz' Theodizee auf spätere Denker betrachtet.
3. Theodizee heute: Dieses Kapitel beginnt mit der Herausarbeitung der Schwierigkeit, eine allgemein gültige Definition des Begriffs "Theodizee" zu geben, da die Interpretation stark von der jeweiligen Perspektive (philosophisch, religiös etc.) abhängt. Ein kurzer Einblick in die Definition des Begriffs in der Theologischen Realenzyklopädie (TRE) wird gegeben, der jedoch nicht detailliert ausgeführt wird, da der Fokus auf dem Vergleich mit Leibniz liegt. Das Kapitel bereitet den Vergleich zwischen Leibniz’ Theodizee und heutigen Ansichten vor, welcher im nicht mehr im vorliegenden Text vorkommenden Fazit weiter ausgeführt werden würde.
Schlüsselwörter
Theodizee, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gott, Übel, bestmögliche Welt, menschliche Freiheit, moralische Übel, physische Übel, metaphysische Übel, Pierre Bayle, moderne Theologie, katholische Theologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Leibniz' Theodizee im Vergleich zu modernen theologischen Perspektiven"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Gottfried Wilhelm Leibniz' Theodizee-Konzept und vergleicht es mit modernen theologischen und religiösen Perspektiven. Sie untersucht die Relevanz und Grenzen von Leibniz' Argumentation im heutigen Kontext. Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Leibniz' Theodizee, ein Kapitel zur heutigen Auffassung von Theodizee und ein Fazit (welches im vorliegenden Auszug fehlt).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt Leibniz' Leben und Werk, insbesondere seine "Essais de théodicée". Sie erklärt seine Auffassung von der Welt als der bestmöglichen Welt und seine Unterscheidung der drei Übelkategorien (moralisch, physisch, metaphysisch). Der Einfluss von Pierre Bayle auf Leibniz wird diskutiert, ebenso wie die Nachwirkungen von Leibniz' Theodizee auf spätere philosophische und theologische Diskussionen. Schließlich wird ein Vergleich mit modernen theologischen Positionen angestrebt (der im vorliegenden Auszug jedoch unvollständig ist).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel über Leibniz' Theodizee mit Unterkapiteln zu seinem Leben, den "Essais de théodicée" und den Nachwirkungen seines Werkes, ein Kapitel über die heutige Auffassung von Theodizee und ein Fazit (welches im vorliegenden Auszug fehlt).
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern lässt sich Leibniz' Theodizee-Definition mit heutigen theologischen oder religiösen Ansichten vergleichen?
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theodizee, Gottfried Wilhelm Leibniz, Gott, Übel, bestmögliche Welt, menschliche Freiheit, moralische Übel, physische Übel, metaphysische Übel, Pierre Bayle, moderne Theologie, katholische Theologie.
Wie ist die Einleitung aufgebaut?
Die Einleitung beschreibt den Entstehungsprozess der Arbeit und die Motivation der Autorin. Sie erläutert ihren Zugang zum Thema über die Werke von Dorothee Sölle und ihre Fokussierung auf die Begrifflichkeit der Theodizee und deren Prägung durch Leibniz.
Was wird im Kapitel über Leibniz' Theodizee behandelt?
Dieses Kapitel beinhaltet einen biographischen Abriss von Leibniz, eine detaillierte Darstellung der "Essais de théodicée" mit Leibniz' Argumentation für die bestmögliche Welt und die drei Übelkategorien. Es wird der Einfluss von Pierre Bayle hervorgehoben und die Nachwirkungen von Leibniz' Theodizee auf spätere Denker kurz betrachtet.
Worüber handelt das Kapitel zur Theodizee heute?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Schwierigkeit, eine allgemein gültige Definition von "Theodizee" zu finden. Es gibt einen kurzen Einblick in die Definition in der Theologischen Realenzyklopädie (TRE) und bereitet den Vergleich mit Leibniz' Theodizee vor, welcher jedoch im vorliegenden Auszug nicht vollständig ausgeführt wird.
- Quote paper
- Tobias Hoenger (Author), 2008, Die Theodizee nach Gottfried Wilhelm Leibniz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139786