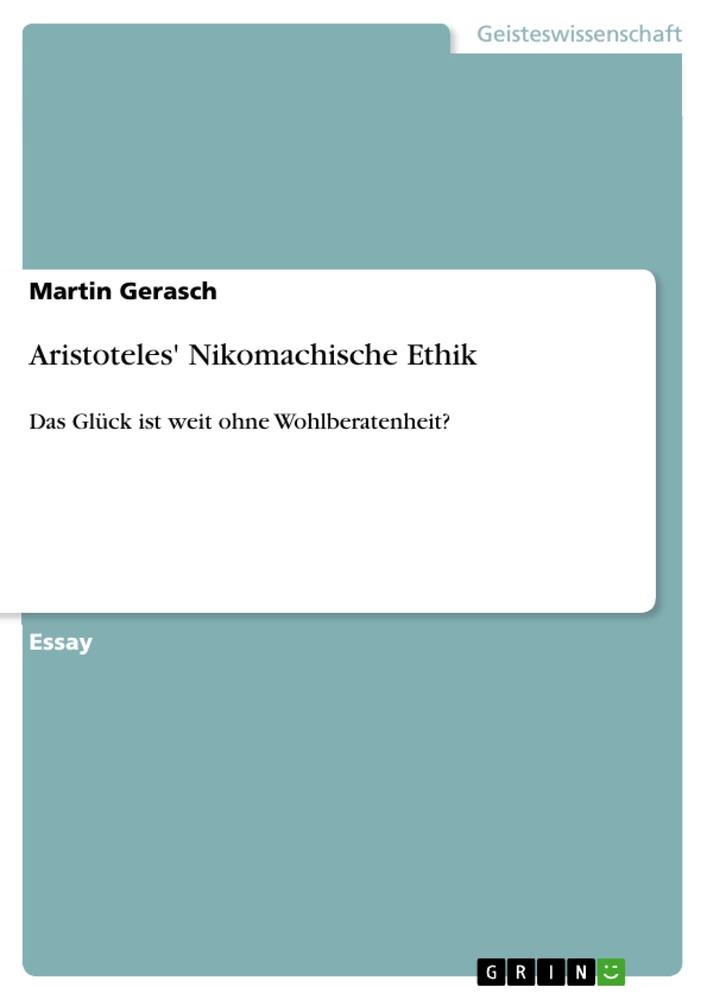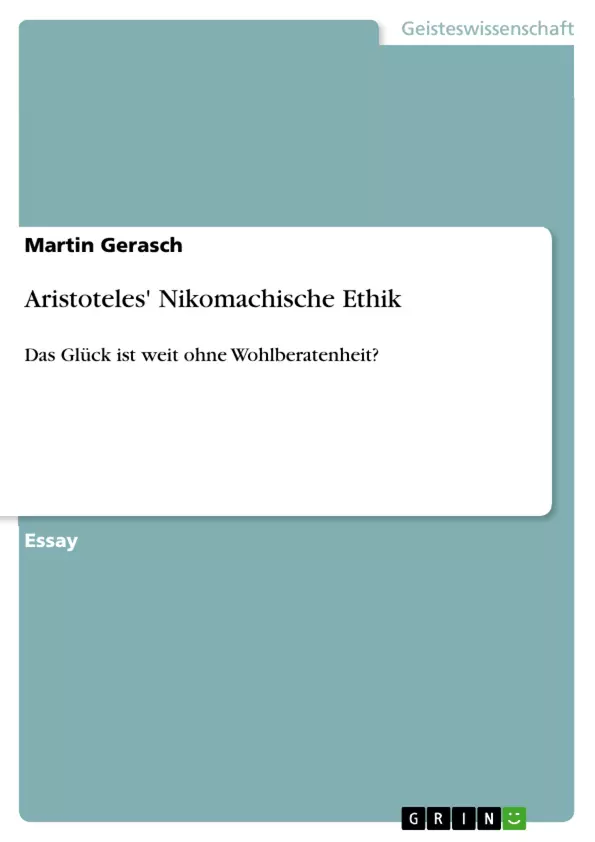Das Glück ist weit ohne Wohlberatenheit?
Was ist das höchste Gut, das der Mensch in seinem Leben durch eigene Aktivität erreichen kann? Dies ist die Frage, die Aristoteles in seiner Schrift „Nikomachische Ethik“ stellt und auf welche er sehr schnell das „Glück“ als Antwort präsentiert. Da dieses von ihm als Tätigkeit der Seele nach der ihr wesenhaften Tüchtigkeit definiert wird, muss also nach diesen Tüchtigkeiten oder Tugenden gesucht werden. Im Buch VI beschäftigt sich Aristoteles nun mit den dianoëtischen, also den Verstand betreffenden Formen der Tugenden.
5 Grundformen der Erkenntnis
Aristoteles stellt nun die These auf, dass es fünf Grundformen gäbe, durch welche die Seele das Richtige erkennen könne. Zunächst das praktische Können, dann die wissenschaftliche Erkenntnis, weiterhin die sittliche Einsicht und abschließend philosophische Weisheit und den intuitiven Verstand. Im nachfolgenden Teil ordnet Aristoteles diese nun danach, ob sie sich auf veränderbare Dinge beziehen (dies ist der überlegende Teil der vernünftigen Seele) oder auf feststehende (der denkende Teil) und charakterisiert sie.
Darauf aufbauend schließt er methodisch jene Teile aus, die auf Ausgangsprämissen basieren, aber über dieselben keine Auskunft geben können. Er ist also auf der Suche nach den Möglichkeiten der Einsicht in den gegebenen Unterbau aller Wissenschaft. Bis zum Abschnitt 10 erläutert Aristoteles noch nicht die richtigen Tugenden, aber schildert den Weg auf dem man zu deren Erkenntnis kommen soll.
Die wissenschaftliche Erkenntnis
Da wir die wissenschaftliche Erkenntnis als etwas, das exakt ist und ein Anderssein ausschließt bewerten, ist sie zum denkenden Teil zu zählen. Es gibt hier kein wahr oder falsch, sondern von der Gegebenheit der Vorgänge, die von den wissenschaftlichen Erkenntnissen differieren, wissen wir nichts. Aristoteles folgert daraus, dass unsere durch Deduktion und Induktion erzielten Ergebnisse notwendig und ewig sind. Diese Methode hilft uns also bei der Erkenntnis unveränderbarer Sachverhalte. So liefert uns die wissenschaftliche Erkenntnis sichere Schlüsse, die als Lehren weitergegeben werden können. Quasi wie im Mathematikunterricht.
Das Glück ist weit ohne Wohlberatenheit?
Was ist das höchste Gut, das der Mensch in seinem Leben durch eigene Aktivität erreichen kann? Dies ist die Frage, die Aristoteles in seiner Schrift „Nikomachische Ethik“ stellt und auf welche er sehr schnell das „Glück“ als Antwort präsentiert.[1] Da dieses von ihm als Tätigkeit der Seele nach der ihr wesenhaften Tüchtigkeit definiert wird, muss also nach diesen Tüchtigkeiten oder Tugenden gesucht werden. Im Buch VI beschäftigt sich Aristoteles nun mit den dianoëtischen, also den Verstand betreffenden Formen der Tugenden.[2]
5 Grundformen der Erkenntnis
Aristoteles stellt nun die These auf, dass es fünf Grundformen gäbe, durch welche die Seele das Richtige erkennen könne. Zunächst das praktische Können, dann die wissenschaftliche Erkenntnis, weiterhin die sittliche Einsicht und abschließend philosophische Weisheit und den intuitiven Verstand.[3] Im nachfolgenden Teil ordnet Aristoteles diese nun danach, ob sie sich auf veränderbare Dinge beziehen (dies ist der überlegende Teil der vernünftigen Seele) oder auf feststehende (der denkende Teil) und charakterisiert sie.
Darauf aufbauend schließt er methodisch jene Teile aus, die auf Ausgangsprämissen basieren, aber über dieselben keine Auskunft geben können. Er ist also auf der Suche nach den Möglichkeiten der Einsicht in den gegebenen Unterbau aller Wissenschaft. Bis zum Abschnitt
10 erläutert Aristoteles noch nicht die richtigen Tugenden, aber schildert den Weg auf dem man zu deren Erkenntnis kommen soll.
Die wissenschaftliche Erkenntnis
Da wir die wissenschaftliche Erkenntnis als etwas, das exakt ist und ein Anderssein ausschließt bewerten, ist sie zum denkenden Teil zu zählen. Es gibt hier kein wahr oder falsch, sondern von der Gegebenheit der Vorgänge, die von den wissenschaftlichen Erkenntnissen differieren, wissen wir nichts. Aristoteles folgert daraus, dass unsere durch Deduktion und Induktion erzielten Ergebnisse notwendig und ewig sind. Diese Methode hilft uns also bei der Erkenntnis unveränderbarer Sachverhalte. So liefert uns die wissenschaftliche Erkenntnis sichere Schlüsse, die als Lehren weitergegeben werden können. Quasi wie im Mathematikunterricht.[4]
Das praktische Können
Nun kommt Aristoteles aber zum wandelbaren Teil. Er trifft hier zunächst einmal die Unterscheidung zwischen Handeln und Hervorbringen und erläutert dies am Beispiel des Bauens. Hierbei handele es sich um die Grundform des praktischen Könnens. Bei jedem praktischen Können aber existiere in uns ein vormals reflektiertes Ziel, das hervorgebracht werden soll. So könnte etwa ein Haus entstehen. Ist das nicht der Fall, so war der gefasste Plan fehlerhaft. Das praktische Können jedoch zähle eindeutig zu den veränderbaren Dingen und weiterhin zum hervorbringenden Teil der Vernunft.[5]
Die sittliche Einsicht
Um diese Grundform zu beschreiben, schaut Aristoteles in die Welt und sucht Menschen, denen er das Prädikat „sittlich einsichtig“ verleihen würde. Zu deren Merkmalen zählt etwa, dass sie Wert und Nutzen einer Sache nicht nur situativ, sondern allumfassend für die Verwirklichung ihres Endzieles z.B. eines glücklichen Lebens erkennen.[6] Das richtige Planen ist nicht zwingend nötig, aber deshalb ein wichtiger Punkt, weil Unlust die Motivation zum Handeln zerstören kann.[7] Daraus kann gefolgert werden, dass derjenige, der die Fähigkeit zur richtigen Überlegung besitzt, sittliche Einsicht hat.[8] Da aber nur dann solche Überlegungen angestellt werden, wenn auch die Möglichkeit der Veränderung gegeben ist, zählt Aristoteles auch die sittliche Einsicht zum überlegenden Teil der Vernunft. Hier jedoch nicht zur hervorbringenden Art, wie das praktische Können, sondern zur handelnden. Der Unterschied zum praktischen Können liegt darin, dass das wertvolle Handeln selbst immer ein Endziel darstellt, während das Hervorbringen keinen Zweck in sich selbst findet. Hier gibt es jedoch etwas wie erreichbare Perfektion und somit Abstufungen. Sittliche Einsicht aber hat man, oder eben nicht.[9] Sie beinhaltet also die Fähigkeit zum Handeln im Terrain dessen was von wert ist.[10] Von der wissenschaftlichen Erkenntnis ist sie schon deshalb verschieden, da sie sich nicht auf unveränderbarem Gebiet bewegt. Das stellt auch ihren Wesensvorzug dar.[11]
Philosophische Weisheit und intuitiver Verstand
Nun zieht Aristoteles ein Zwischenresümee bezüglich der Erkenntnis von gültigen Ausgangssätzen. Diese können nicht durch wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen werden, da das hierbei angewendete deduktive Verfahren bereits Ausgangssätze benötige. Sittliche Erkenntnis sowie praktisches Können liefern ebenfalls nichts dergleichen, weil sich diese Grundformen auf Wandelbares beziehen. Es wird nun deshalb die vierte Grundform - die philosophische Weisheit - in Betracht gezogen. Da aber auch der Philosoph mit Syllogismen hantiere, bleibe nach Ausschlussverfahren nur noch der intuitive Verstand, der uns zum richtigen Ergebnis führen kann.[12]
Aristoteles denkt nun über den Begriff der Weisheit nach und tut das deshalb, weil er Menschen, die als weise bezeichnet werden, so etwas wie Perfektion in ihrem Handeln zuschreibt. Im Bereiche des praktischen Könnens führt er hierbei das Beispiel des Künstlers Phidias an.[13]
Aus dieser vollendeten Form der Erkenntnis ergibt sich, dass der Weise über die obersten Ausgangssätze Wissen hat. Es gibt hier eine Verbindung von „diskursiver Erkenntnis“ und intuitivem Verstand, also einerseits logischem Denken mittels der Begriffe und andererseits durch die Sinne unmittelbar gebotener innerer oder äußerer Anschauung.[14] Wissenschaftliche Erkenntnis oder Staatskunst können nicht als höchste Wissenschaft gesehen werden, da deren Begriffe, wie „gesund“, nicht allgemeingültig, sondern spezifisch auf den Menschen bezogen sind. In Verknüpfung mit anderen Lebewesen verlieren sie ihre Bedeutung. Die Ausdrücke der philosophischen Weisheit weisen hingegen Konstanz auf. Als Beispiel nennt Aristoteles „gerade“ oder „weiß“, deren Belang sich nicht ändert.[15] Leider tut sich ein weiteres Problem auf, das Aristoteles am Beispiel des Mathematikers Thales beschreibt. Philosophische Erkenntnis setzt sich zwar aus dem wissenschaftlichen und intuitivem Verstehen der höchsten Dinge zusammen, liefert aber nicht die praktische Anwendung der Prinzipien, die für den Menschen positiv sind. Thales erkennt komplexe mathematische Zusammenhänge, die jedoch unbrauchbar sind, da sie keine Antwort auf die Frage nach „dem Gut“ für den Menschen liefern.[16]
Mit-sich-zu-Rate-gehen
In diesem praktischen Ressort hat nun wieder die sittliche Einsicht Vorteile. Wie Aristoteles schon vorher klargestellt hat, bezieht sich dieser Teil der Vernunft auf die Veränderbaren Dinge, sodass das Endziel durch kluges Vorgehen erreicht werden kann.
[...]
[1] Vgl. S. 8, Z. 14.
[2] Vgl. S. 154, Z. 1.
[3] Vgl. S. 156, Z. 15- 21.
[4] Vgl. S. 156, Z. 24 - S. 157, Z. 14.
[5] Vgl. S. 157, Z. 22- S.158, Z. 23.
[6] Vgl. S. 158, Z. 24- 31.
[7] Vgl. S. 160, Z. 3- 6.
[8] Vgl. S. 159, Z. 2f.
[9] Vgl. S. 160, Z. 14- 20.
[10] Vgl. S. 159, Z. 15- 23.
[11] Vgl. S. 160, Z. 20f.
[12] Vgl. S. 161, Z. 17ff.
[13] Vgl. S. 161, Z. 20- 26.
[14] Vgl. S. 162, Z. 1- 4.
[15] Vgl. S. 162, Z. 9- 12.
[16] Vgl. S. 163, Z. 1- 8.
Häufig gestellte Fragen
Was ist laut Aristoteles das höchste Gut, das der Mensch erreichen kann?
In seiner Schrift „Nikomachische Ethik“ identifiziert Aristoteles das „Glück“ als das höchste Gut, welches er als Tätigkeit der Seele nach der ihr wesenhaften Tüchtigkeit definiert.
Welche fünf Grundformen der Erkenntnis stellt Aristoteles auf?
Aristoteles nennt das praktische Können, die wissenschaftliche Erkenntnis, die sittliche Einsicht, die philosophische Weisheit und den intuitiven Verstand als Wege, auf denen die Seele die Wahrheit erkennen kann.
Was charakterisiert die wissenschaftliche Erkenntnis nach Aristoteles?
Wissenschaftliche Erkenntnis bezieht sich auf feststehende, unveränderbare Dinge. Sie ist exakt, schließt ein Anderssein aus und liefert durch Deduktion und Induktion notwendige und ewige Ergebnisse.
Wie unterscheidet sich das praktische Können von der sittlichen Einsicht?
Während das praktische Können auf das „Hervorbringen“ (wie beim Bauen) zielt, bezieht sich die sittliche Einsicht auf das wertvolle „Handeln“ selbst, welches ein Endziel in sich darstellt.
Welche Rolle spielt der intuitive Verstand in der aristotelischen Lehre?
Der intuitive Verstand ist die Grundform, die Einsicht in die gültigen Ausgangssätze und den Unterbau aller Wissenschaft ermöglicht, da diese nicht allein durch Deduktion gewonnen werden können.
- Quote paper
- Martin Gerasch (Author), 2009, Aristoteles' Nikomachische Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139836