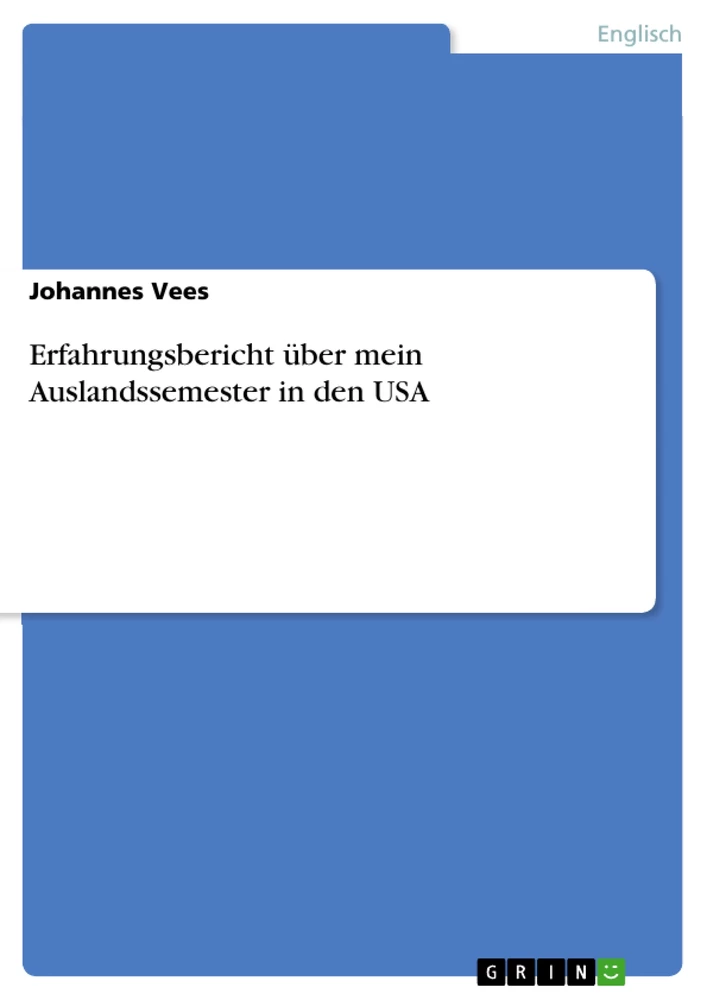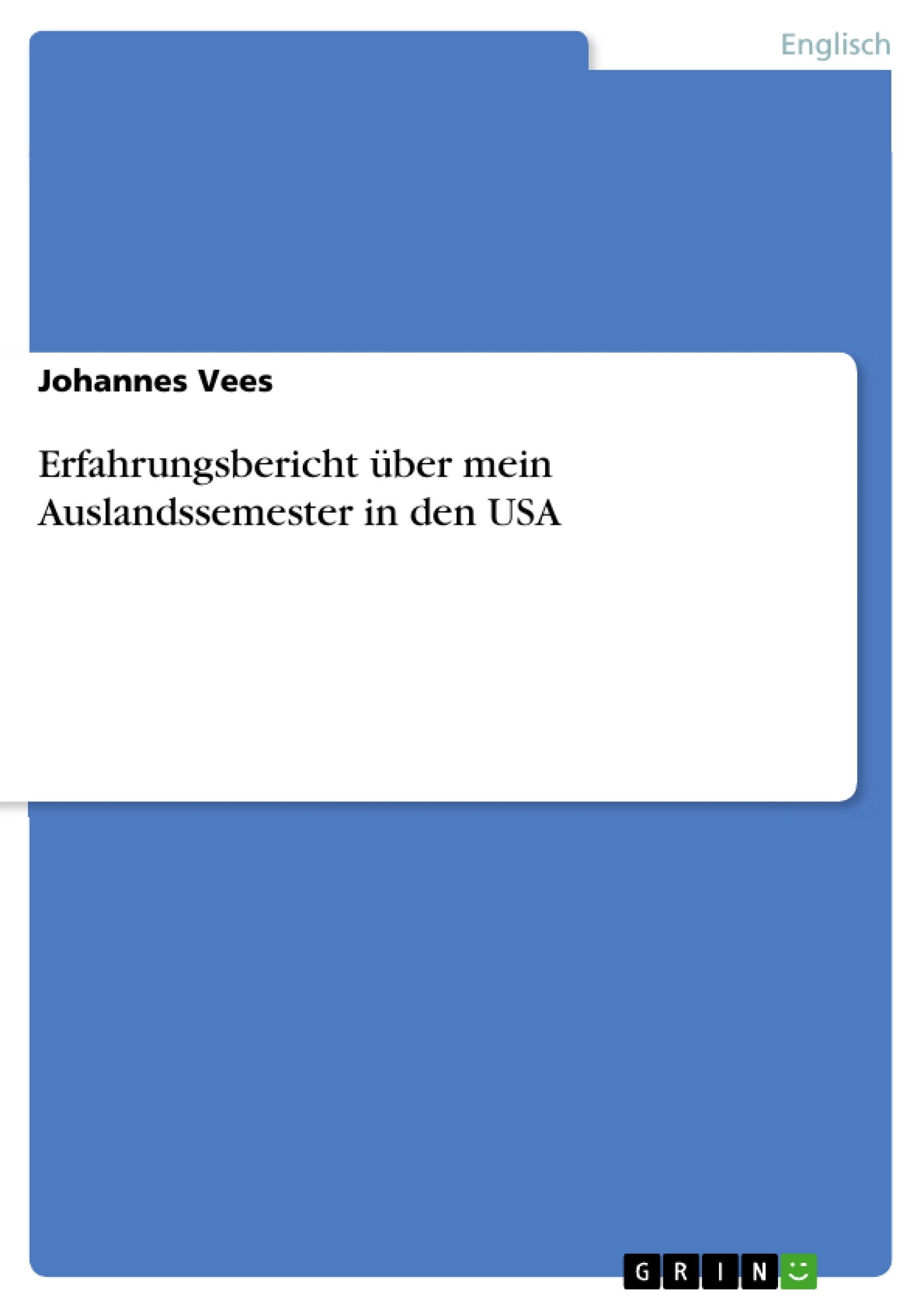Der Bericht über mein 4-monatiges Auslandssemester an der Samford University, Birmingham, Alabama, USA, untergliedert sich in folgende Abschnitte:
Vorbereitung des Aufenthaltes, Studium im Gastland, Aufenthalt im Gastland, Praktische Tipps.
Vorbereitung des Aufenthaltes
Ich habe mich als Englischstudent bewusst für ein Auslandssemester in einem englischsprachigen Land beworben. Die Vereinigten Staaten haben mich nicht nur kulturell, sondern auch sprachlich mehr gereizt, da das Amerikanische Englisch medial präsenter ist und daher auch mehr Einfluss hat. Da ich als Student des Faches Englisch ohnehin bestrebt bin, das beste aus meinen Fähigkeiten herauszuholen und mich daher viel mit der Sprache beschäftige, habe ich sprachlich nicht speziell auf den Aufenthalt vorbereitet. So versuchte ich lediglich, mir spezifisches Vokabular für formelle Angelegenheiten sowie ungewohnte Situationen noch einmal anzuschauen bzw. neu anzueignen.
Kulturell gesehen war eine gesonderte Vorbereitung ebenfalls nicht notwendig. Dies liegt zum einen daran, dass ich zuvor bereits in den USA war und somit erste Eindrücke erfahren habe. Zum anderen aber beruht dies auch auf der Tatsache, dass mein Gastland täglich in den Medien erscheint und auch ansonsten in kaum einer Hinsicht ein Kulturschock zu erwarten war, was sich im Nachhinein auch bestätigte. Meine Gasthochschule sendete mir einige Broschüren zu, die speziell für internationale Studenten angefertigt wurden, jedoch wiesen diese nur auf sehr alltägliche Dinge hin, z.B. Begrüßung, und waren demnach eher für Studenten aus dem asiatischen Raum geeignet, da dort ganz andere Gewohnheiten gepflegt werden. Immer wieder wurde ich darauf hingewiesen, dass der Süden der USA teilweise noch sehr rassistisch sei, worüber ich mir leichte Sorgen machte. Hierauf werde ich später noch mal zurückkommen.
Wie bereits zuvor erwähnt ist die USA in unserer Gesellschaft sehr präsent. Vor allem die Außenpolitik beschäftigt uns Europäer sehr häufig. Es war somit nicht nötig, sich über die politische Lage tiefgehend zu informieren, wenngleich ich mir die innenpolitischen Strukturen nochmal kurz vor Augen geführt habe.
Der aufwändigste Teil der Vorbereitung waren die unzähligen bürokratischen Hindernisse. Beinahe täglich gingen Emails über zusätzlich benötigte Formulare und Informationen ein. Dies reichte von ärztlichen Attesten über mehrere Versicherungsbescheinigungen hin bis zu einem Schreiben, mit dem ich versichern musste, die USA fristgerecht wieder zu verlassen. All dies war zwar nervig, aber zumeist relativ schnell erledigt, was sich über das Visum nicht sagen lässt. Zunächst einmal fallen ca. 100 Euro allein dafür an, dass man einen Visumsantrag stellen kann. Im Nachhinein folgen zum Teil komplizierte Formulare und die Besorgung eines sogenannten Interview-Termins bei einem der drei US-Konsulate in Deutschland. Hierzu muss man unter anderem ein bestimmtes Formular der Gasthochschule vorlegen, das oft erst recht spät ausgestellt werden kann. Somit kann es in der Reisehochsaison schnell dazu kommen, dass man unter Zeitdruck gerät, da die Konsulate in Berlin, Frankfurt und München sehr lange Wartezeiten haben. Für den Termin beim Konsulat geht bei entsprechender Anreise schnell ein Tag drauf, da hier der gesamte Prozess ungefähr drei Stunden geht, obwohl man nur etwa zwei Minuten mit einem Beamten redet.
Studium im Gastland
Als internationaler Student muss man 12 Credit Points erreichen, um als Vollzeitstudent eingeschrieben zu sein. So belegte ich American Literature, was zwar sehr anspruchsvoll, aber folglich auch sehr wertvoll für mich war, da alle vier Kompetenzbereiche (Sprechen, Schreiben, Verstehen, Lesen) abgedeckt wurden und mich sprachlich herausgefordert haben. Überdies nahm ich an einem Kurs im Fach „Education“. Der Kurs hieß „Professional Secondary Language Arts/English Teacher“ und bestand sowohl aus einem theoretischen Seminarteil sowie aus einem praktischen Teil an einer nahe gelegenen High School. So durfte ich über das gesamte Semester hinweg an einem kleinen Forschungsprojekt zur Verbesserung von Hausaufgabenleistungen in einer 9. Klasse im Fach Geschichte arbeiten, den Unterricht observieren sowie auch selber unterrichten, was eine großartige Erfahrung war. Schließlich hört man immer viel über das amerikanische Schulsystem, aber für eine längere Zeit vor Ort zu sein, ist natürlich noch einmal etwas ganz anderes und von enormem Wert für mich gewesen. Da Spanisch in den USA aufgrund des hohen Anteils lateinamerikanischer Menschen immens an Bedeutung gewonnen hat, wird es auch am College von vielen Studenten besucht. Ich schloss mich dem an und schrieb mich für „Elementary Spanish“ ein. Der Kurs war – bedingt durch die fremdsprachlichen Schwächen der US-Studenten – sehr einfach, allerdings war es mir aufgrund eines Online-Programms möglich, bereits vorzuarbeiten und somit nun bereits über zufriedenstellende Spanischkenntnisse zu verfügen. Ferner nahm ich an einem Tenniskurs teil. Alle Studenten müssen an jener Universität gewisse Sportkurse besuchen, so dass es für jeden zum studentischen Alltag gehört, sich sportlich zu betätigen. Dem schloss ich mich an und besuchte diese Veranstaltung, die einfach gestrickt war und somit nicht sehr schwer zu meistern war. Zu erwähnen sei, dass sämtliche Kurse 2-3 Mal die Woche auf der Tagesordnung stehen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den Vorlesungen an deutschen Hochschulen, wo man in der Regel mehrere Kurse besucht, allerdings nur einmal wöchentlich. Teil des Austausches war auch die Unterstützung der deutschen Sprachabteilung an der Universität. So betreute ich als Sprachlaborassistent Deutschkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, was nicht nur sehr viel Spaß bereitete, sondern auch einen großen Nutzen für mich als angehenden Lehrer hatte.
Der oben erwähnte Kurs in „Education“ war quasi ein Praktikum. Neben den bereits genannten Punkten war es besonders wertvoll für mich, mit jungen Leuten zu kommunizieren, da diese sehr umgangssprachlich reden. Als Fremdsprachenlehrer kann man von solch einer Erfahrung selbstverständlich nur profitieren.
In den Vorlesungen waren im Durchschnitt 20 Studenten. Dies liegt daran, dass meine Gasthochschule privat organisiert ist und viel Wert auf kleine Unterrichtsgruppen setzt. Typische Vorlesungen mit einem Professor als Redner gab es im Prinzip nicht. Die gesamte Atmosphäre war sehr mit der Schule zu vergleichen, nicht nur aufgrund der Kursgrößen. So fanden die Seminare 2-3 mal pro Woche statt und es wurden Hausaufgaben aufgegeben. Es herrschte bis auf Ausnahmen eine Anwesenheitspflicht und es wurden regelmäßig Leistungskontrollen durchgeführt. Die Abschlussprüfungen hatten nicht viel mehr Stellenwert als die Prüfungen während des Semesters. Insgesamt hatte all dies zur Folge, dass das Niveau im Vergleich zu deutschen Hochschulen meines Erachtens niedriger war. Die regelmäßigen Leistungskontrollen waren teilweise sehr einfach. Da in den USA keine bzw. nur geringfügig selektiert wird, kann nahezu jeder – sofern die finanziell Mittel da sind – studieren. Viele Studenten bekommen (Teil-)Stipendien, da sie in einer bestimmten Sportart für das College-Team geeignet sind. Viele Gespräche und persönliche Erfahrungen haben mir gezeigt, dass vor allem diejenigen Studenten, die Sportstipendien erhalten, oftmals akademisch ungeeignet und auch unmotiviert sind.
Der Campus der Universität war prächtig und einfach wunderschön. Da ich auch andere Universitäten in den USA mal angeschaut habe, kann ich behaupten, dass sehr viel Wert auf eine gepflegte Hochschullandschaft gelegt wird. Sämtliche Einrichtungen (Studentenwohnheime, Mensa, Sport, Theater, etc.) befinden sich auf dem Campus, welcher kreisförmig organisiert ist und insgesamt wie ein kleines Dorf erscheint. Es gibt sogar eine eigene Polizei, die sogenannte Campus Safety. Da die Studiengebühren bei jährlich ca. 25 000 Dollar liegen, kann man sich die Investitionen erklären. In den Studentenwohnheimen wohnen zwei Personen auf einem Zimmer mit Bad und teilen sich mit einem weiteren Zimmer einen gemeinsamen Raum mit kleiner Kücheneinrichtung. Sämtliche Wohnheime sind strikt geschlechtlich getrennt und Besuche vom anderen Geschlecht sind auch nur zu bestimmten Zeiten erlaubt.
Interessant war auf jeden Fall der Fakt, dass sämtliche Sportarten hochschulintern organisiert und somit auch finanziert werden. Die Ausstattung ist sehr gut. Aber auch ansonsten gibt es unzählige Aktivitäten, die in kleinen Clubs organisiert sind, beispielsweise der International Club. Im Vergleich zu Deutschland sind die Studenten rund um die Uhr auf dem Campus und leben mehr oder weniger auf einem kleinen, von der Außenwelt abgeschirmten Territorium. Alkohol war auf jenem Campus strengstens verboten, selbst wenn man das gesetzliche Mindestalter von 21 Jahren erreicht hat. Dies hat mit dem christlichen Wertesystem der Universität zu tun. Studentenkneipen oder ähnliche sind daher nicht vorfindbar.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie aufwendig ist die Vorbereitung eines US-Visums?
Sehr aufwendig; es fallen Kosten von ca. 100 Euro an, man muss Interview-Termine an US-Konsulaten vereinbaren und zahlreiche bürokratische Formulare ausfüllen.
Wie ist das Studium an einer privaten US-Universität wie der Samford University?
Es herrscht eine schulähnliche Atmosphäre mit kleinen Gruppen, Anwesenheitspflicht und regelmäßigen Hausaufgaben sowie Leistungskontrollen.
Welche Kurse belegte der Student während des Auslandssemesters?
Unter anderem American Literature, Education (mit Praktikum an einer High School), Elementary Spanish und einen Tenniskurs.
Gibt es kulturelle Besonderheiten im Süden der USA?
Der Bericht erwähnt das christliche Wertesystem der Universität, das Alkoholverbot auf dem Campus und die strikte geschlechtliche Trennung in Wohnheimen.
Wie unterscheidet sich das akademische Niveau zwischen Deutschland und den USA?
Der Student empfand das Niveau in den USA aufgrund der geringeren Selektion und einfacheren Tests als etwas niedriger im Vergleich zu deutschen Hochschulen.
Welchen Nutzen hatte das Praktikum an der High School?
Es bot wertvolle Einblicke in das amerikanische Schulsystem und ermöglichte die Kommunikation mit Jugendlichen in ihrer Umgangssprache.
- Citar trabajo
- Johannes Vees (Autor), 2008, Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester in den USA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/139857