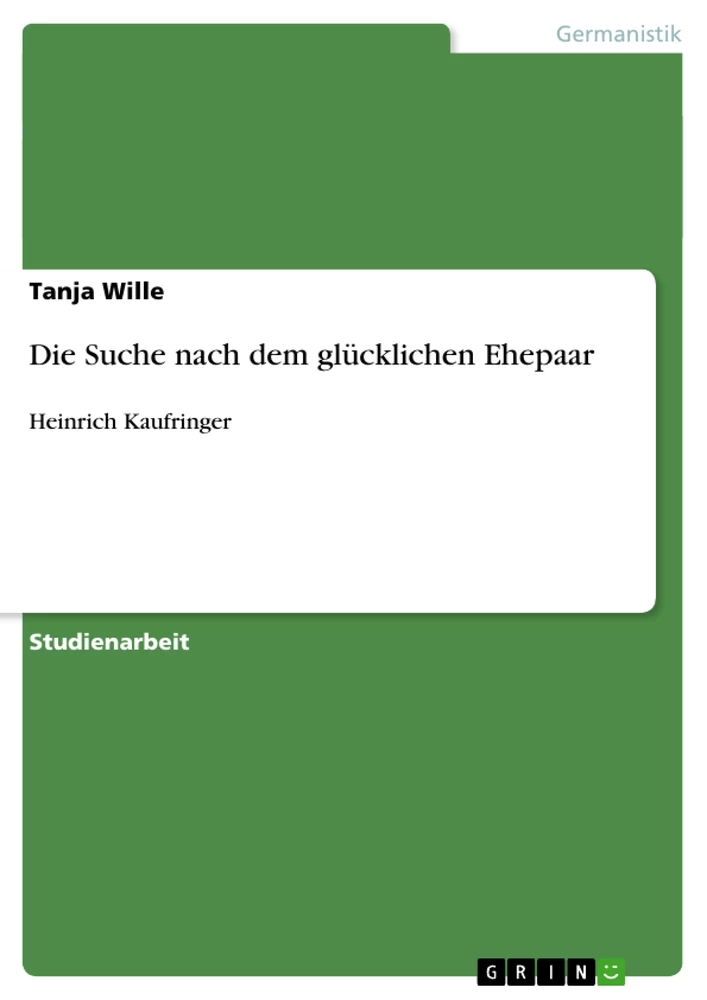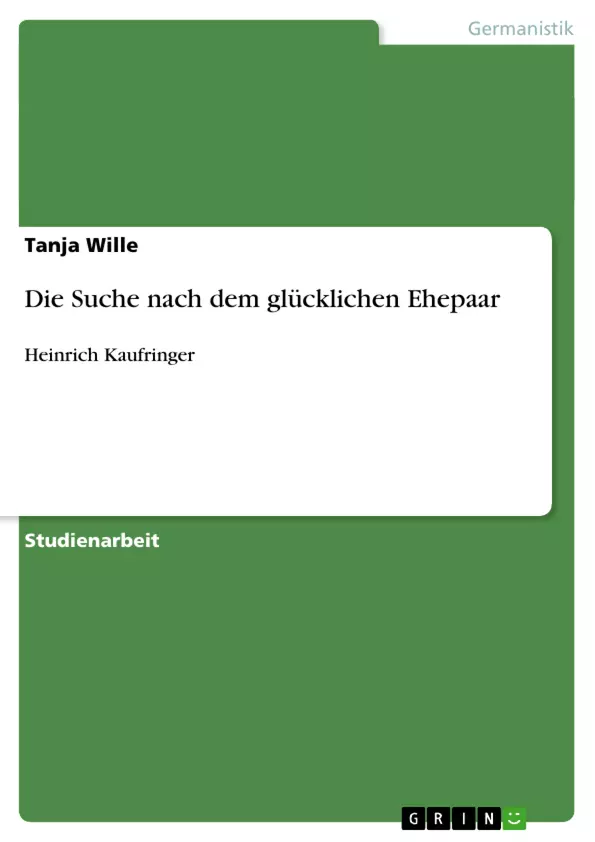Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar ist wohl eine der hervorstechendsten Mären des Heinrich Kaufringer. Überliefert nur in einer Schrift im Jahre 1464, zählt diese “schwankhaft gefärbte”, exemplarische Märe Ende des 14. Jahrhunderts zu den ungewöhnlichsten Werken dieser Zeit. Kaufringer hebt nicht die damals üblichen Stereotypen hervor, sondern scheut sich nicht, auch Figuren abseits der Konventionen zu konstruieren. Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar ist gespickt mit charakterlichen Gegensätzen, die im Mittelalter nicht zu vereinbaren scheinen. Das Märe thematisiert die eheliche Gemeinschaft und die damit verbundenen Konflikte zwischen den Geschlechtern. Diese Konflikte führen in dieser Märe zu einer erheblichen Differenz zwischen der Wahrnehmung des Paares in ihrem Umfeld und innerehelicher Realität. Kaufringer problematisiert an drei verschiedenen Ehepaaren den Widerspruch zwischen öffentlichem Schein und privatem Sein. Dabei vereint er unterhalterische Ansprüche sowie die moralische Belehrung des Publikums.
Das moralische Problem wird von Kaufringer am Ende der Märe nicht eindeutig gelöst, das Publikum kann nur mögliche Ansätze zur innerehelichen Konfliktlösung übernehmen und diese individuell weiterführen.
Das Märe setzt sich aus dem einleitenden Promythion, der Rahmenerzählung, zwei Binnenerzählungen und einem Epimythion zusammen. Im folgenden Teil dieser Arbeit sollen die einzelnen Teile der Märe auf Widersprüche zwischen privatem und öffentlichem Raum untersucht, und mit Textstellen belegt werden.
2. Analyse des öffentlichen und privaten Raumes
2.1 Promythion
Die spätmittelalterliche Kurzerzählung beginnt mit einem Promythion, welches die ideale Einigkeit des Ehepaares thematisiert. Die volkssprachliche Übersetzung und Interpretation des göttlichen Gebots[1]:
ain man und auch sein eweib
zwuo sel und ainen leib
süllen mit ainander haun.
was ir ainem wirt getaun,
es seie guot oder pein,
das sol in baiden gschehen sein.
si süllen also sein veraint,
was ir ains mit willen maint
und im ain wolgefallen ist,
so sol das ander ze der frist
auch sein gunst dazuo geben(V. 3-13)[2],
stellt sich jedoch im Ehealltag als schwer realisierbar dar, da die unterschiedlichen Eigenschaften des Menschen Stoff für Konflikte schaffen, welche die Harmonie in einer Partnerschaft stören können. Voraussetzung für ein mittelalterliches Eheglück ist beidseitige Friedfertigkeit sowie gegenseitige Liebe, was nur durch einen Partner erreicht werden konnte, der das zweite Ich des anderen darstellte. Der Eine sollte das Bestreben des Anderen kennen und gleichermaßen verfolgen, um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten. Doch war dies eher ein Ziel, als wirkliche Realität, was bereits in der einleitenden Rahmenerzählung zu erkennen ist. Innereheliche Harmonie und eheliche Reproduktion waren gleichermaßen oberste Maxime einer Ehe.[3]
2.2 Rahmenerzählung
Die Rahmenerzählung beginnt zunächst mit einer Beschreibung der Hauptfiguren und deren Lebenssituation bzw. Eheleben, welche die Basis für den weiteren Handlungsverlauf bilden. Der Held der Märe, ein reicher Bürger, wird uneingeschränkt positiv beschrieben:
er was milt und hochgemuot
und was von geslächt gar gout.
er was frumm und tugentlich
und darzuo gar erentrich.(V. 19-21)
Auch die Ehefrau des reichen Bürgers scheint zunächst frei von Makel:
er hett gar ain säligs weib;
die was im lieb sam sein leib.
er und frumkait hett si vil
und tugent oun endes zil.
si was wol in dem willen sein(V. 29-33).
Die Beschreibung des Ehepaares entspricht dem Ideal der christlichen Ehevorstellung des Promythion vollkommen. Dieser Eindruck wird jedoch mit den folgenden Zeilen revidiert:
doch muost der man gar vil pein
leiden von der frawen guot,
darumb das er hochgemuot
und in dem haus gesellig was;
darum was si im gehas,
wann si vil karkheit an ir het.(V. 34-39)
Durch die konträre ökonomische Einstellung des Paares kommt es häufig zu innerehelichen Konflikten, welche den reichen Bürger belasten:
wenn ir der man ze wissen tet,
das er wolt haben wirtschaft,
so ward er von ir gestraft.
das betruobt den man vil sehr.
er zoch hin, so zoch si her.(V. 40-44)
Das in dieser Märe männliche Prinzip dermiltekollidiert mit dem weiblichen Prinzip derkarge.[4]Miltestellt im eigentlichen Sinne eine höfische Tugend dar, “die sozial als Verpflichtung aus der privilegierten Stellung des adeligen Herrn folgt und zugleich Glanz und Charisma des Adels vor Augen zu führen hat.”[5]Demgegenüber steht dieKarge, welche als Geiz bzw. Sparsamkeit bezeichnet wird. Die Ehefrau ist, im Gegensatz zu ihrem Mann der als stellvertretender Repräsentant der Ehe in der Außenwelt (öffentlicher Raum) agiert, für den privaten Raum der Hauswirtschaft verantwortlich. Oberste Priorität stellt die familienorientierte Haushaltsführung dar, welche sparsamen Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Vermögen verlangt. Großzügigkeit und Sparsamkeit stellen einen gravierenden Konfliktstoff für diese Ehe dar. Kaufringer verbindet in der Ehefrau zwei gegensätzliche Stereotypen, welche in unzähligen anderen Mären entweder als „übles wîp“ oder als „tugendhafte Frau“ vorkommen.[6]Der Charakter der Frau macht den von Kaufringer eingeschlagenen Ehediskurs deutlich, der anders als der Frauendiskurs auch komplexe Frauentypen zulässt.[7]Der Widerspruch zwischen privatem und öffentlichem Raum der Ehe wird durch die Gedanken des Ehemannes deutlich:
[...]
[1]Vgl. Groitl, „Er ist ze milte, sie ist ze karc“, (wie Anm. 1), S.159
[2]Klaus Grubmüller (Hg.),Novellistik des Mittelalters: Märendichtung, Frankfurt am Main: Dt. Klassiker Verlag, 1. Aufl. 1996, S. 768-797, hier S. 768
[3]Vgl. Rüdiger Schnell,Sexualität und Emotionalitätin der vormodernen Ehe, Köln [u.a.] : Böhlau, 2002,
S.200/161
[4]Vgl. Groitl, „Er ist ze milte, sie ist ze karc“, (wie Anm. 1), S.162
[5]Grubmüller,Novellistik des Mittelalters, (wie Anm. 2), S. 1281f. mit Verweis auf Bumke S. 369, 434f.,481f.
[6]Vgl. Marga Stede,Schreiben in der Krise. Die Texte des Heinrich Kaufringers, Trier: Literatur-Imagination- Realität 5, 1994, S.73
[7]Vgl. Rüdiger Schnell,Frauendiskurs, Männerdiskurs, Ehediskurs: Textsorten und Geschlechterkonzepte in Mittelalter und Früher Neuzeit, Bd. 23, Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag, 1998, S. 274
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Heinrich Kaufringers Märe "Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar"?
Die Erzählung thematisiert die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Schein einer harmonischen Ehe und der privaten, oft konfliktgeladenen Realität im spätmittelalterlichen Alltag.
Was ist der zentrale Konflikt zwischen dem reichen Bürger und seiner Frau?
Der Konflikt entzündet sich an gegensätzlichen Tugenden: Der Ehemann vertritt das ritterliche Ideal der Großzügigkeit (milte), während die Ehefrau auf Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin (karge) beharrt.
Wie wird das Ideal der Ehe im "Promythion" dargestellt?
Das Ideal fordert vollkommene Einigkeit: "Zwei Seelen und ein Leib". Die Partner sollen den Willen des anderen wie ihren eigenen annehmen und stets im Konsens handeln.
Warum ist Kaufringers Darstellung der Frau ungewöhnlich für das Mittelalter?
Statt einfacher Stereotypen wie der "tugendhaften Frau" oder dem "üblen Weib" konstruiert Kaufringer komplexe Charaktere, die beide Seiten in sich vereinen können.
Welche Rolle spielt der Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Raum?
Nach außen hin wirkt das Paar perfekt, doch im privaten Raum der Hauswirtschaft führen unterschiedliche ökonomische Vorstellungen zu erheblichen psychischen Belastungen für den Ehemann.
- Quote paper
- Tanja Wille (Author), 2009, Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140040