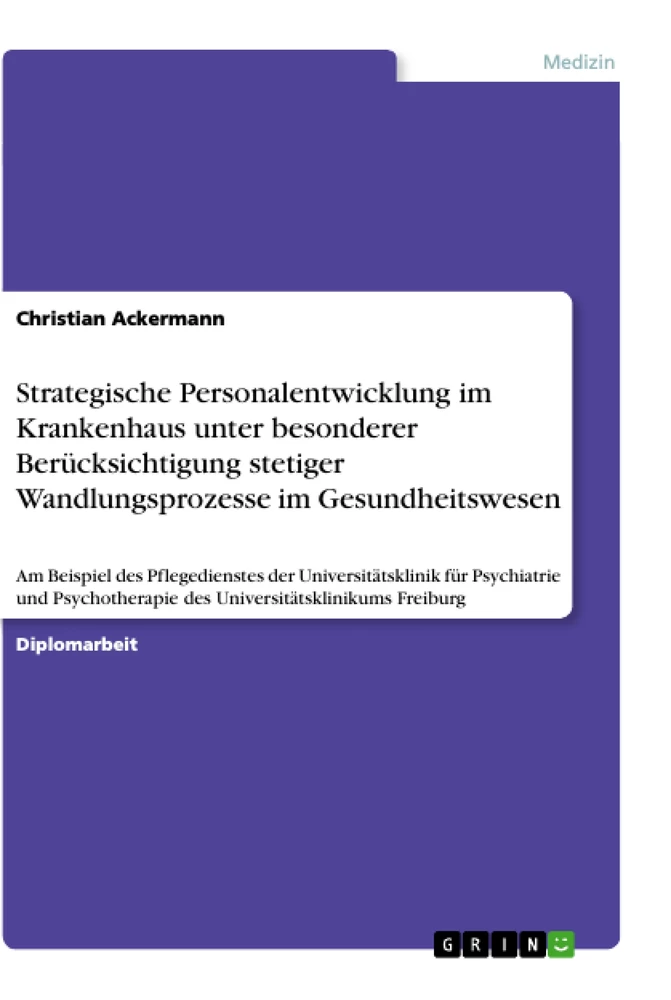Globaler Wettbewerb und verkürzte Produktlebenszyklen haben in Verbindung mit gesteigertem Qualitäts- und Kostenbewusstsein auch im Gesundheitssystem komplexe Veränderungs- und Anpassungsprozesse zur Folge. Mit der am 27. 06. 2000 im Krankenhausfinanzierungsgesetz beschlossenen Einführung eines diagnoseorientierten Fallpauschalensystems (DRGs) zum 01. 01. 2004 wurde ein grundlegender und system-immanenter Wandel der Finanzierungs- und Wettbewerbssituation im deutschen Krankenhausmarkt vollzogen. Der Gesetzgeber reagierte hierdurch auf die aktuellen Herausforderungen an das Gesundheitswesen, welche lt. BUSSE/RIESBERG insbesondere auf die demografische Entwicklung und den medizinisch-technischen Fortschritt aber auch auf die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Gesundheitsversorgung sowie auf Anreize für eine übermäßige Erbringung und Nutzung von Gesundheitsleistungen bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen der Sozialversicherungen zurückzuführen sind (vgl. BUSSE/RIESBERG 2005, S. 13).
Für das Personalmanagement der Leistungserbringer im Gesundheitswesen bedeuten diese veränderten Rahmenbedingungen, dass unter dem Prinzip des ökonomischen Wettbewerbs deregulierter und liberalisierter Märkte, die Ressource Personal durch geeignete Personalentwicklungsstrategien nachhaltig gesichert und auf diese neuen Herausforderungen vorbereitet werden muss, damit auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhalten bleibt. Ausgehend von dieser Problemlage stellt sich die Frage, was unter Personalentwicklung zu verstehen ist, woraus sich eine entsprechende Strategie ableiten bzw. aufbauen lässt und welche Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Umsetzung sinnvoll erscheinen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Notwendigkeit strategischer Personalentwicklung
1.1 Grundlegende Bedeutung
1.2 Begriffsdefinitionen
1.3 Verfahrensweise und Zielsetzung
2 Rahmenbedingungen im Wandel
2.1 Veränderung der Bevölkerungsstruktur
2.1.1 Entwicklung und Prognose der Altersverteilung
2.1.2 Herausforderungen an die Pflege
2.2 Politik und Gesetzgebung im Gesundheitswesen
2.2.1 Expansion und Leistungsausweitung
2.2.2 Kostendämpfung und Beitragssatzstabilität
2.2.3 Vergütungssysteme und Wettbewerbsbedingungen
2.3 Pflegeberufe im Wandel
2.3.1 Verberuflichung der Pflege
2.3.2 Wertewandel und Emanzipationsbestrebungen
2.3.3 Professionalisierungsdebatte und Akademisierung
2.3.4 Aktuelle Entwicklung und zukünftige Aufgaben
3 Organisationale Anpassungsstrategien
3.1 Organisationsstrukturen und Managementsysteme
3.1.1 Das Krankenhaus als Expertenorganisation
3.1.2 Strategisches Management im Krankenhaus
3.2 Organisationsstrukturen im Wandel
3.2.1 Klassisches Organisationsdesign im Krankenhaus
3.2.2 Moderne Organisationsstrukturen im Krankenhaus
3.3 Gestaltung organisationaler Veränderungsprozesse
3.3.1 Organisationsentwicklung
3.3.2 Wissensmanagement und lernende Organisation
3.3.3 Lerntheoretische Grundlagen des Wissensmanagements
3.3.4 Organisationale Lernfelder
4 Grundlagen und Methoden der Personalentwicklung
4.1 Human Resource Management
4.1.1 Hard HRM
4.1.2 Soft HRM
4.2 Wissens- und Kompetenzbereiche
4.2.1 Fachwissen
4.2.2 Methodenkompetenzen
4.2.3 Soziale Kompetenzen
4.2.4 Personale Kompetenzen
4.3 Personalbedarfsplanung
4.3.1 Ermittlung des Personalbestands
4.3.2 Ermittlung des quantitativen Personalbedarfs
4.3.3 Ermittlung des qualitativen Personalbedarfs
4.3.4 Verfahrensweisen an der Psych UKL
4.4 Auswahlverfahren und Beurteilungsinstrumente
4.4.1 Personalsuche
4.4.2 Test- und Auswahlverfahren
4.4.3 Assessment-Center
4.4.4 Personalbeurteilung
4.4.5 Verfahrensweisen an der Psych UKL
4.5 Bereiche der Personalentwicklung
4.5.1 Berufliche Bildung
4.5.2 Fort- und Weiterbildung
4.5.3 Arbeitsplatzbezogene Personalentwicklungsmaßnahmen
4.5.4 Sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen
4.5.5 Verfahrensweise an der Psych UKL
4.6 Wissenstransfer und Anreizsysteme
4.6.1 Gestaltung des Wissenstransfers
4.6.2 Überprüfung des Wissenstransfers
4.6.3 Motivation und Anreizgestaltung
4.6.4 Verfahrensweise an der Psych UKL
5 Resümee und Ausblick
Gesetze und Rechtsverordnungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Notwendigkeit strategischer Personalentwicklung
Diese Diplomarbeit befasst sich mit den Möglichkeiten einer strategischen Personalentwicklung im Krankenhaus unter besonderer Berücksichtigung stetiger Wandlungsprozesse im Gesundheitswesen. Die Notwendigkeit hierzu wird durch eine vergleichende und kritische Auseinadersetzung mit ausgesuchten literarischen Quellen herausgearbeitet und am Beispiel des Pflegedienstes der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Freiburg dargestellt.
1.1 Grundlegende Bedeutung
Globaler Wettbewerb und verkürzte Produktlebenszyklen haben in Verbindung mit gesteigertem Qualitäts- und Kostenbewusstsein auch im Gesundheitssystem komplexe Veränderungs- und Anpassungsprozesse zur Folge. Mit der am 27. 06. 2000 im Krankenhausfinanzierungsgesetz beschlossenen Einführung eines diagnoseorientierten Fallpauschalensystems (DRGs) zum 01. 01. 2004 wurde ein grundlegender und systemimmanenter Wandel der Finanzierungs- und Wettbewerbssituation im deutschen Krankenhausmarkt vollzogen. Der Gesetzgeber reagierte hierdurch auf die aktuellen Herausforderungen an das Gesundheitswesen, welche lt. Busse/Riesberg insbesondere auf die demografische Entwicklung und den medizinisch-technischen Fortschritt aber auch auf die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Gesundheitsversorgung sowie auf Anreize für eine übermäßige Erbringung und Nutzung von Gesundheitsleistungen bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen der Sozialversicherungen zurückzuführen sind (vgl. Busse/Riesberg 2005, S. 13).
Für das Personalmanagement der Leistungserbringer im Gesundheitswesen bedeuten diese veränderten Rahmenbedingungen, dass unter dem Prinzip des ökonomischen Wettbewerbs deregulierter und liberalisierter Märkte, die Ressource Personal durch geeignete Personalentwicklungsstrategien nachhaltig gesichert und auf diese neuen Herausforderungen vorbereitet werden muss, damit auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erhalten bleibt. Ausgehend von dieser Problemlage stellt sich die Frage, was unter Personalentwicklung zu verstehen ist, woraus sich eine entsprechende Strategie ableiten bzw. aufbauen lässt und welche Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Umsetzung sinnvoll erscheinen.
1.2 Begriffsdefinitionen
Becker bescheinigt dem Begriff Personalentwicklung ein hohes Maß an Heterogenität und Unschärfe und somit auch das Abhandensein einer allgemeinverbindlichen Nominaldefinition, was er letztlich dem Umstand einer noch jungen akademischen Disziplin zuschreibt. Er fordert daher die Bedeutung des Begriffs mit einer analytischen Definition inhaltlich festzulegen, welche die Merkmale und Praxis der Personalentwicklung hinreichend genau beschreibt (vgl. Becker 2005, S. 2 – 3).
Die Zusammenhänge von Personalentwicklung und Organisationsentwicklung werden hingegen bei Krämer verdeutlicht, wenn er von den Wortbestandteilen beider Begrifflichkeiten ausgehend darauf hinweist, dass es sich in beiden Fällen um Veränderungsprozesse im Zeitverlauf handelt. Während bei der Organisationsentwicklung die Veränderungen auf die Strukturen und Prozesse des gesamten Systems ausgerichtet sind, stehen bei der Personalentwicklung die Individuen im Mittelpunkt der Betrachtung (vgl. Krämer 2007, S. 14).
Im Sinne einer komplexen Wechselwirkungsbeziehung kann Personalentwicklung somit als Bestandteil von Organisationsentwicklung betrachtet werden, während Organisationen, durch das Handeln, Wirken und Verändern ihrer Mitglieder, ebenfalls einem geplanten und systematisch gesteuerten Wandlungsprozess unterzogen werden können. Der Begriff Personalentwicklung wird in der Literatur demnach wie folgt definieren:
„Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisationsentwicklung, die von einer Person oder Organisation zur Erreichung spezieller Zwecke zielgerichtet, systematisch und methodisch geplant, realisiert und evaluiert werden“ (Becker 2005, S. 3).
„Personalentwicklung ist der Prozess der Förderung, Bildung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Erreichung der Organisationsziele. Sie setzt in der Phase der ersten Kontaktaufnahme im Rekrutierungsprozess ein und endet erst mit dem Ausscheiden des Individuums aus der Organisation“ (Krämer 2007, S. 15).
„Der Begriff << Personalentwicklung >> (PE) bezeichnet in der Regel alle unternehmerischen Aktivitäten, die systematisch und zumeist langfristig der Förderung und Qualifikation der Mitarbeiter dienen, damit diese zur Erfüllung ihrer aktuellen oder zukünftigen Aufgaben befähigt bleiben oder werden“ (Loffing/Geise 2005, S. 17).
Unter Personalentwicklung versteht man ein systematisches und zukunftsweisendes Konzept der Qualifikation für Mitarbeiter aller Hierarchieebenen zur Bewältigung gegenwärtiger und zukünftiger Anforderungen. Sie verbessert das Leistungspotenzial der Mitarbeiter im Hinblick auf derzeitige und künftige Unternehmensziele und berücksichtigt zusätzlich deren persönliche Interessen (Nicolai 2006, S. 227 – 228).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Literatur Personalentwicklung im Wesentlichen als eine systematisch geplante und zielgerichtete Methode zur Förderung und Bildung von Mitarbeitern verstanden wird, mit dem Ziel, Wissen sowohl für den Einzelnen als auch für die Organisation zu generieren, zu erhalt bzw. zu erweitern. Dieses Wissen dient dem Zweck der Aufgabenerfüllung und Leistungssteigerung und ist an den strategischen Unternehmenszielen und den daraus abgeleiteten, gegenwärtig und zukünftig benötigten Kompetenzen und Kenntnissen der Mitarbeiter, ausgerichtet.
Dabei ist Personalentwicklung als prozessualer, auf seine Erfolgswirkung hin überprüfter und angepasster, Vorgang zu verstehen, der mit der Rekrutierung und Auswahl zukünftiger Mitarbeiter beginnt und erst mit deren Wiederaustritt aus der Organisation endet. Nicolai weißt nochmals gesondert darauf hin, dass dieser Prozess auf gegenseitigem Nutzen beruht, da neben den Bedarfen und Anforderungen des Unternehmens auch die Interessen und Bedürfnisse des Mitarbeiters zu berücksichtigen sind (vgl. Nicolai 2006, S. 227 – 228).
1.3 Verfahrensweise und Zielsetzung
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Begründung der Notwendigkeit einer aus den strategischen Geschäftszielen des Krankenhauses abgeleiteten Vorgehensweise zur systematischen und geplanten Personalentwicklung. Dabei wird die Thematik in Bezug auf die recherchierte Literatur in einer vergleichend analysierenden Darstellung erörtert, um anschließend auf Basis dieser Betrachtung die bereits beim Pflegedienst der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Freiburg bestehenden Instrumente und Dokumente zur Personalentwicklung kritisch zu reflektieren. Das Ergebnis soll anschließend als Empfehlung in einem Personalentwicklungskonzept für die Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Freiburg zusammengefasst werden.
Die Literaturrecherche wurde vorwiegend in den Datenbanken des Internet-Suchportals vascoda.de und den Online-Katalogen (OPAC) der Freiburger Hochschulen (Caritasbibliothek und Universitätsbibliothek) sowie in den Datenbanken CareLit® und WISE durchgeführt. Hierzu wurden in einem ersten Prozess Quellen zu den zentralen Schlüsselbegriffen des Themas (Strategie, Personalentwicklung, Pflege, Krankenhaus, Gesundheitswesen) – einzeln und in Verknüpfung miteinander – recherchiert. Nach deren Sichtung und Auswertung wurden auf Basis sich hieraus ergänzender Suchbegriffe (Personalmanagement, Wissensmanagement, lernende Organisation, Organisationssoziologie, Organisationspsychologie, demografischer Wandel, Gesundheitsreformen, Leistungs- und Potenzialbewertung) – wiederum einzeln und in Verknüpfung miteinander – weitere Quellen recherchiert und ebenfalls ausgewertet.
Da zu den einzelnen Suchbegriffen z. T. eine sehr hohe Anzahl an Quellen recherchierter werden konnte, musste anschließend eine reduzierende Auswahl erfolgen. Die Kriterien waren dabei, neben der Relevanz für die Thematik, vor allem die Aktualität der Quelle. Es wurden aber auch gezielt Werke berücksichtigt, welche die Thematik der Diplomarbeit aus der Perspektive einer anderen Branche bzw. Branchenübergreifend darstellen (vgl. z. B. Müller 2004). Dadurch soll es dem Autor ermöglicht werden, Erkenntnisse und Erfahrungen aus anderen Bereichen in seine Arbeit miteinzubeziehen.
Im Wesentlichen kamen schließlich Monografien und Aufsätze aus Sammelwerken zur Auswahl, ergänzend aber auch Artikel aus Fachzeitschriften sowie online veröffentlichte Publikationen und Broschüren von Fachverbänden und öffentlichen Institutionen. Abschließend wurde die Literaturauswahl noch durch die für das Thema Personalentwicklung relevanten Dokumente aus den maßgeblichen Qualitätsmanagement-Handbüchern des Universitätsklinikums Freiburg sowie durch einzelne Studienbriefe der Hamburger Fernhochschule ergänzt.
2 Rahmenbedingungen im Wandel
Die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen, unter denen die Krankenhäuser in Deutschland agieren müssen, befinden sich sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene in einem stetig fortschreitenden Wandlungsprozess. Welche einzelnen Faktoren hier als Herausforderungen wirken und wie die Gesetzgebung im Gesundheitswesen darauf reagiert, ist für die Personalentwicklungsstrategien der einzelnen Unternehmen von grundsätzlicher Bedeutung.
2.1 Veränderung der Bevölkerungsstruktur
Hochaltrigkeit in einer immer älter werdenden Gesellschaft mit steigender Lebenserwartung bei gleichzeitig rückläufiger Fertilitätsrate und immer weniger jungen Menschen, die nachkommen, sind die Hauptaspekte des demografischen Wandels, wie er für das 21. Jahrhundert beschrieben wird.
2.1.1 Entwicklung und Prognose der Altersverteilung
Aus Tab. 1 wird ersichtlich, dass der Anteil der bis Vierzigjährigen an der Gesamtbevölkerung von 2000 bis 2006 stetig rückläufig war, während der Bevölkerungsanteil der über Vierzigjährigen im gleichen Zeitraum entsprechend zugenommen hat. Die größte Zuwachsrate verzeichnete die Gruppe der Vierzig- bis Sechzigjährigen. Sie wuchs um 3,1 % von 26,7 % auf 29,8 % und stellt gegenwärtig den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung dar. Bezeichnend für diese demografischen Veränderungsprozesse ist auch die Tatsache, dass die Gruppe der unter Zwanzigjährigen bereits seit 2004 kleiner ist als die Gruppe der Sechzig- bis Achtzigjährigen. Zusammen mit der Gruppe der über Achtzigjährigen stellt diese Gruppe der Sechzig- bis Achtzigjährigen seit 2006 einen Anteil von 25 % an der Gesamtbevölkerung. Die aktuellen Prognosen gehen dahin, dass sich der Anteil dieser beiden Gruppen bis zum Jahr 2050 auf einen Wert von 37,1 % bis 43,1 % erhöhen wird (vgl. Statistisches Bundesamt 2006, Tab. 1 – Tab. 15).
Tab. 1: Bevölkerung nach Altersgruppen / Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt 2008
Entsprechend den prognostizierten Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur erwarten Busse/Riesberg eine Zunahme chronisch-degenerativer Erkrankungen und somit zukünftig mehr medizinische und pflegerische [Personal-] Ressourcen für die Diagnostik und Behandlung von z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bösartigen Neubildungen (vgl. Busse/Riesberg 2005, S. 13 – 14).
2.1.2 Herausforderungen an die Pflege
Die Problematik einer alternden Gesellschaft wird durch den gleichzeitigen Wandel etablierter Familienstrukturen, mit ihrem Trend zur Singularisierung und zur Ein-Generationenfamilie, dazu führen, dass Hochbetagte mit ihrem höheren Krankheits- und Pflegefallrisiko immer seltener durch Familienangehörige in ihrer häuslichen Umgebung betreut und versorgt werden können. Diese Entwicklung wird zukünftig eine gesteigerte Nachfrage nach professionellen Betreuungs- und Versorgungsleistungen begünstigen, sodass insbesondere in den stationären und ambulanten Institutionen des Pflegesystems von einer Ausweitung und Weiterentwicklung bestehender Leistungsangebote und Versorgungsmodelle auszugehen ist. Für den Pflegedienst in den Krankenhäusern bedeutet dies die Notwendigkeit, die Übergänge und Schnittstellen zu den Leistungsanbietern in den nachgelagerten Pflegemarkt so zu gestallten, dass eine sektorenübergreifende Kooperation und Prozesssteuerung gewährleistet werden kann. Zusätzlich kann in diesen Veränderungen auch die Chance für eine Markt-Erweiterung oder Diversifikation in dieses Marktsegment begründet liegen.
Infolge der beschriebenen Wandlungsprozesse in der Alters- und Familienstruktur und den veränderten Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten des Gesundheitswesens wird es somit in immer rascherer Folge zu immer neueren Produktentwicklungen in Medizin und Pflege kommen. Die hierdurch steigenden Anforderungen an die Mitarbeiter hinsichtlich fachlicher Qualifikation und individueller Anpassungsfähigkeit bedeuten für das Personalmanagement in den Krankenhäusern die Notwendigkeit, ihre Personalentwicklungsstrategie zielgerichtet auf die frühzeitige Entdeckung und Förderung vorhandener Entwicklungspotenziale bei den einzelnen Mitarbeitern auszurichten.
Tab. 2: Altersverteilung in der Berufsgruppe der Pflegekräfte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2007
Wie aus Tab. 2 zu ersehen ist, wirkt sich die demografische Entwicklung aber auch direkt auf die Berufsgruppe der Pflegekräfte aus. Bei einem stetigen Anstieg des Anteils der bis fünfzigjährigen und der über fünfzigjährigen Beschäftigten, kommt zukünftig einer speziell an die Bedürfnisse und Potenziale älterer Mitarbeiter angepassten Personalentwicklung eine immer größere Bedeutung zu. Gleichzeitig gilt es Angebote zu entwickeln die geeignet sind, die knapper werdende Ressource junger Berufsanfänger in Konkurrenz zu anderen Branchen für die Pflegeberufe zu interessieren und sie langfristig an diese Berufsgruppe zu binden.
2.2 Politik und Gesetzgebung im Gesundheitswesen
Nach der Wiedereinführung des Gesundheitssystems in der Bundesrepublik Deutschland ab 1955 und dem Scheitern erste Reformbemühungen zur Kostenreduktion Mitte der 1960er Jahre war die Strategie der Gesundheitspolitik auf eine Leistungsausweitung und verbesserte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ausgerichtet (vgl. Busse/Riesberg 2005, S. 29).
2.2.1 Expansion und Leistungsausweitung
Mit der Einführung der dualen Finanzierung im Krankenhaussektor, wonach die Bundesländer die Investitionskosten und die Krankenkassen die laufenden Betriebskosten der Krankenhäuser finanzieren, wurde durch zusätzliche öffentliche Investitionen die Möglichkeit geschaffen, noch aus der Nachkriegszeit bestehende infrastrukturelle Defizite und Versäumnisse rasch zu beseitigen. Hinzukommende Steigerungsraten durch ein allgemeines Wirtschaftswachstum in Verbindung mit der Einführung kostenintensiver Technologien und einer Ausweitung der GKV auf neue Mitgliedergruppen (z. B. Studierende, Landwirte, Behinderte), lassen in Abb. 1 einen Anstieg der Gesundheitsausgaben in den Jahren 1970 – 1973 von 6,5 % auf 7,7 % des BIPs erkennen. Dies entsprach mit einer relativen Steigerung von 18,5 % den Wachstumszielen der damaligen Gesundheitspolitik.
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2008
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Gesundheitsausgaben ohne Einkommensleistungen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (GAR-alt) / früheres Bundesgebiet
Anders verhielt es sich jedoch mit dem erneuten relativen Zuwachs von nochmals 18,2 % in den Jahren bis 1976 auf jetzt 9,1 % des BIPs. Dieser weitere Anstieg der Gesundheitsausgaben entsprach nun nicht mehr den Vorstellungen einer gezielten Wachstumspolitik, sondern wurde lt. Busse/Riesberg in Verbindung mit der Ölkrise gesamtgesellschaftlich als Kostenexplosion wahrgenommene und vermehrt auf demografische Trends und eine stetig fortschreitende Leistungsausweitung zurückgeführt. Schließlich führte diese Entwicklung 1977 zur Einführung des Krankenversicherungskostendämpfungsgesetzes (vgl. Busse/Riesberg 2005, S. 29).
2.2.2 Kostendämpfung und Beitragssatzstabilität
Kennzeichnend für das Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz war ein Strategiewechsel zum Prinzip der Kostendämpfung und Beitragssatzstabilität. Dabei sollte die grundsätzliche Begrenzung der Leistungsausweitung durch eine Koppelung der Leistungsausgaben an die Einkommensentwicklung der Versicherten erreicht werden. Dieser Strategiewechsel wurde notwendig, da unter den Bedingungen einer fortschreitenden Globalisierung die von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und deren Arbeitgebern gemeinsam getragen Beitragssätze zur GKV als Gegenstand der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gesehen werden mussten (vgl. Busse/Riesberg 2005, S. 30).
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2008
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Gesundheitsausgaben in Deutschland als Anteil am Bruttoinlandsprodukt in Prozent
Unter Beibehaltung dieses Grundprinzips führte die kontinuierliche Reformgesetzgebung ab den 1980er Jahren zu einem geringeren Ansteigen der Gesundheitsausgaben. Durch das Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 konnte auch den durch die deutsche Wiedervereinigung hervorgerufenen zusätzlichen Belastungen begegnet werden, sodass sich die Steigerungsrate, wie Abb. 2 verdeutlicht, ab der Mitte der 1990er Jahre vorübergehend sogar wieder rückläufig entwickelte.
In Abb. 3 wird veranschaulicht, dass die Beitragssätze zur GKV gegenüber den anteiligen Gesundheitsausgaben am BIP für den Vergleichszeitraum eine höhere Steigerungsrate aufweisen. Während die Gesundheitsausgaben in den Jahren von 1992 bis 2004 von 9,6 % auf 10,6 % anstiegen und somit eine relative Steigerungsrate von 10,4 % aufwiesen, betrug die relative Steigerungsrate bei der Beitragssatzentwicklung zur GKV im gleichen Zeitraum 11,8 % (Steigerung von 12,7 % auf 14,2 %). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Finanzierung der GKV an die Entlohnung des Produktionsfaktors Arbeit geknüpft ist, während sich dessen Gesamtanteil am BIP jedoch kontinuierlich rückläufig entwickelt.
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 2008
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Allgemeiner Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung
Da die durch diese Hebelwirkung hervorgerufene überproportional hohe Steigerung des Beitragsatzes dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität entgegenlief, nahm der Reformdruck auf das System weiter zu, sodass mit der Novellierung des Krankenhausfinanzierungsgesetztes vom 27. 06. 2000 die grundlegende Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf ein diagnoseorientiertes Fallpauschalensystem (Diagnosis Related Groups è DRGs) zum 01. 01. 2004 beschlossen wurde.
Galt noch bis zum Gesundheitsstrukturgesetz von 1993 das Selbstkostendeckungsprinzip für Krankenhäuser, wurde das System ab dann sukzessive auf prospektive Erstattungsmechanismen und Entgeltformen (Fallpauschalen und Sonderentgelte für bestimmte Leistungen ab 1996) umgestellt. Da ein Großteil der Leistungen jedoch nach wie vor über tagesgleiche Basis- und Abteilungspflegesätze abgerechnet wurde und die Behandlungsdauer somit in den meisten Fällen immer noch maßgeblichen Einfluss auf die abrechenbaren Behandlungskosten hatte, konnte das Ziel eines leistungsbezogenen Vergütungssystems mit gesteigerter Effizienz durch mehr Wettbewerbselemente nur bedingt erreicht werden.
2.2.3 Vergütungssysteme und Wettbewerbsbedingungen
Die DRGs stellen ein Patientenklassifikationssystem dar, in dem der einzelne Behandlungsfall anhand ärztlicher Diagnosekriterien in seiner Kostenintensität erfasst und eingruppiert wird. Die Klassifizierung des Behandlungsfalls und die Erfassung des Kostengewichts (Fallschwere) ist dabei maßgeblich von Art und Anzahl der codierten Diagnosen abhängig und bestimmt dadurch den zu erzielenden Erlös. Die tatsächliche Verweildauer und die tatsächlich entstandenen Behandlungskosten sind somit, entgegen dem Prinzip der Selbstkostendeckung, nicht mehr direkt erlöswirksam.
Gestaltete sich früher das Verhältnis der Fallkosten zu den Behandlungstagen mit zunehmender Verweildauer günstiger, da der Anteil der tatsächlichen Behandlungskosten des Falls, bei tagesgleichen festgeschriebenen Vergütungssätzen, mit jedem weiteren Behandlungstag sank, hat sich dieses Prinzip unter den Bedingungen des DRG-Systems grundlegend gewandelt. Für den Leistungsanbieter bedeutet dies, dass sich die Erlöse jetzt analog zur Anzahl der behandelten Fälle, abhängig von Fallart und Fallschwere, entwickeln, diese sich jedoch nicht mehr analog zur Verweildauer maximieren lassen.
Entsprechend dieser grundlegend gewandelten Wettbewerbsbedingungen lautet die Frage jetzt nicht mehr: „Wie viele Tage wird der Patient voraussichtlich im Krankenhaus verbringen müssen?“, sondern: „Wie viel Zeit darf die Behandlung maximal in Anspruch nehmen?“ In diesem Zusammenhang weist Naegler darauf hin, dass „ … [d]ie Abrechnung mithilfe von DRG’s … nicht nur zu einer grundlegend neuen Zielsetzung, dem Tagret Timing, führen [wird][,] [s]ie wird ferner zu einer fallbezogenen Organisation des Krankenhauses anregen und damit dem Geschäftsprozessmanagement als Instrument des Krankenhausmanagements zu mehr Bedeutung als bisher verhelfen (Naegler 2007, S. 13).
Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass sowohl die notwendige Anpassung der Organisation, als auch die erfolgreiche Rekrutierung und Entwicklung der dazu benötigten Personalressourcen maßgeblich darüber entscheiden wird, ob und wie sich das einzelne Krankenhaus auf diesem strukturell neu ausgerichteten Gesundheitsmarkt gegenüber seinen Wettbewerbern behaupten kann. Dies trifft umso mehr zu, wenn man die in der Politik aktuell diskutierten und vom Sachverständigenrat zur Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswesen prognostizierten Veränderungen in der Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe sowie den Wandel in den Versorgungsstrukturen mit in Betracht zieht (vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung und Entwicklung im Gesundheitswesen, S. 15, 29).
2.3 Pflegeberufe im Wandel
Ausgelöst durch den medizinischen Fortschritt, vollzog sich ab dem frühen 19. Jahrhundert der Wandel von den noch vormodern geprägten Hospitalgemeinschaften zum modernen Krankenhaus mit seinem qualitativ und quantitativ zunehmend ausdifferenzierteren medizinischen Leistungsangebot. Infolge dieser Entwicklung stieg der Bedarf an qualifizierter Pflege, sodass sich etwa zeitgleich aus der katholischen Ordenspflege das Mutterhaussystem entwickelt.
2.3.1 Verberuflichung der Pflege
Gemäß der geistlichen Ausrichtung der Mutterhäuser wurde die Krankenpflege von Beginn an als ein religiöses Element der Liebestätigkeit, die ihren Ausdruck im ewigen Gelübde des Kranken- und Armendienstes fand, verstanden (vgl. Recken 2003, S. 12). Dieser Ausrichtung folgend entsprach sie, als fürsorglich-dienende aber unselbstständige und unentgeltliche Tätigkeit, dem damaligen Rollenbild der bürgerlichen Frau. Zusammen mit den Ehe und Familie ersetzenden Strukturen einer totalen Institution ermöglichte es das Organisationsmodell des Mutterhauses somit jungen und unverheirateten Frauen aus bürgerlichen Kreisen, einer sozial akzeptierten und abgesicherte Tätigkeit nachzugehen.
Im Zuge der weiteren Entwicklung wurde das Mutterhausmodell auch auf nicht katholische Institutionen (Diakonissen, Schwesternschaften des Roten Kreuzes) übertragen, behielt jedoch seine wesentliche Prägung bei. Nach wie vor wurde das Gestellungsverhältnis, in dem die Bedingungen geregelt waren, zu denen die Schwestern dem Krankenhaus als Arbeitskraft überlassen wurden, direkt zwischen Mutterhaus und Krankenhaus vereinbart und abgerechnet. Eine direkte Entlohnung der Schwestern für die Ausübung ihrer Krankenpflegetätigkeit erfolgte weiterhin nicht, jedoch waren die Mutterhäuser in vertraglich geregelter Kooperation mit den Krankenhäusern für deren Ausbildung und materielle Versorgung verantwortlich.
Aufgrund dieser Charakteristik war die Krankenpflege lt. Recken eine nichtberufliche hausarbeitsnahe Tätigkeit, die fast ausschließlich von Frauen ausgeübt wurde und deren wesentliche Kennzeichnung darin lag, dass die Schwestern nicht über die zur Verfügungsstellung ihre eigene Arbeitskraft bestimmen konnten, diese nicht entlohnt wurde und es auch keine klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit gab (vgl. Recken 2003, S. 24).
Zusätzlich zu dieser Prägung unterlag die Verberuflichung der Krankenpflege auch den Anforderungen einer fortschreitenden medizinischen Entwicklung. Neben den auf das körperliche Wohl des Patienten abzielenden originären Tätigkeiten wurden der Krankenpflege spätestens mit Beginn des 20. Jahrhunderts immer mehr Aufgaben aus dem medizinischen Bereich übertragen. Einerseits stellte diese Entwicklung höhere Anforderungen an die Ausübung des Pflegeberufes und somit auch an die Ausbildung der Pflegekräfte, andererseits oblag die Definitionsmacht darüber, was krankenpflegerische Tätigkeit war und wie diese ausgeführt werden musste, beim Arzt, sodass der Krankenpflegeberuf zusätzlich die Charakteristik eines ärztlichen Assistenz- und Hilfsberufs annahm.
Abgesehen von der aus der Organisationsform des Mutterhausmodells resultierenden ökonomischen Unselbstständigkeit und Abhängigkeit der einzelnen Pflegekräfte, führte diese Entwicklung auch zu einer Einschränkung und Unselbstständigkeit des professionellen Handlungsspektrums und somit zu einer Abhängigkeit der beruflichen Weiterentwicklung des Pflegeberufs von den Interessen und Bedarfen Dritter.
Zunehmende Kritik an dieser Situation führte bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts zur Entstehung der freiberuflichen Pflege und ab dem 20. Jahrhundert zur Gründung unabhängiger Berufsorganisationen. Da die hier organisierten Pflegekräfte jedoch überwiegend in der Privatpflege außerhalb der Krankenhäuser tätig waren, blieb das Mutterhaus für lange Zeit die maßgebliche Organisationsform der verberuflichten Pflege. „Erst in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelten sich die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der nicht mutterhausgebundenen Pflege“ (Recken 2003, S. 10).
2.3.2 Wertewandel und Emanzipationsbestrebungen
Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und dem Wiederaufbau des Gesundheitswesens wurde anfänglich an die traditionellen Organisationsformen der Vorkriegszeit angeknüpft. Jedoch führten veränderte gesellschaftliche Werte mit dem Wunsch nach mehr Demokratie und dem Streben nach mehr Mündigkeit und individueller Freiheit ab den 1960er Jahren zunehmend zu einer Konfrontation mit dem eher bevormundenden Modell der Mutterhauspflege, sodass ab dieser Zeit einsetzende Säkularisierungs- und Veränderungsprozesse zu einer Umstrukturierung der pflegerischen Berufsorganisationen führten.
Diese Emanzipationsbestrebungen der Pflege weg von einer nichtberuflichen hausarbeitsnahen Tätigkeit, ausgeübt aus Berufung von aufopferungsvoll dienenden Schwestern, hin zu einer zeitgemäßen Dienstleistung lässt sich vor allem daran erkennen, dass zunehmend mehr Pflegekräfte in einem regulären Beschäftigungsverhältnis als Angestellte über Arbeitsverträge, und nicht mehr durch die bis dahin überwiegend übliche Überlassung aus Gestellungsverhältnissen, an das sie beschäftigende Krankenhaus gebunden waren. Im Zuge dieser beruflichen Entwicklung erlangten Pflegende erstmals auch außerhalb der freiberuflichen Pflege Selbstbestimmung über die zur Verfügungsstellung ihrer eigenen Arbeitskraft bei gleichzeitig direkter Entlohnung entsprechend der persönlich oder tariflich vereinbarten Vertragsbedingungen.
Durch Wachstumsprozesse angestoßene Veränderungen in der Arbeitswelt, die mit einer systematischen und rationalen Funktionalisierung bestehender Arbeitsabläufe einhergingen, führten lt. Arets et all im Verlauf dieser Entwicklung dazu, dass Pflegende sich immer öfter mit den Möglichkeiten für ein schnelleres und effektiveres Arbeiten befassten (vgl. Arets et all 1996, S. 31). In der Folge können ab den 1970er Jahren weitere Modernisierungs- und Professionalisierungsprozesse beobachtet werden, die sich schließlich auch auf die ideologische und berufspolitische Ausrichtung der Berufsverbände auswirkten.
Im Zuge dieses ideologischen Wandels veränderte sich in der verbandspolitischen Darstellung das Bild der beruflichen Pflege vom selbstlos dienenden und aufopferungsvollen Frauen- und Familienberuf des 19. Jahrhunderts hin zur rationalen und funktionalen Dienstleistung in einer modernen Industriegesellschaft. Zum Ausdruck kam dies vor allem dadurch, dass sich das Berufsbild jetzt nicht mehr nur an der Krankenschwester und dem damit verknüpften Rollenbild der bürgerlichen Frau des 19. Jahrhunderts orientierte sondern, dass nun auch Krankenpfleger ihre Anerkennung als legitime Pflegekräfte fanden.
Verstärkt wurde dieser Prozess durch einen andauernden Personalmangel und der Frage danach, was die originären Aufgaben der Pflege sind und wie diesem Personalmangel nachhaltig begegnet werden kann. Schließlich führten diese Professionalisierungstendenzen, angelehnt an die Entwicklung in der Medizin, zur Herausbildung spezialisierte Arbeitsfelder (z. B. Fachpflege für Anästhesie und Intensivmedizin), sodass die Neu- und Umgestaltung der pflegerischen Aus-, Fort- und Weiterbildungen eine zunehmend gewichtigere Bedeutung in der Verbandsarbeit erlangte.
2.3.3 Professionalisierungsdebatte und Akademisierung
Als Voraussetzung für den Wandel der beruflichen Pflege zur Profession beschreiben Arets et all, neben dem Konsens einer Berufsethik und dem Organisationsgrad der Pflegenden in Berufsverbänden, vor allem das Bestehen einer Handlungsautonomie sowie das Vorhandensein einer qualifizierten und fundierten wissenschaftlichen Basis für die Ausbildung und Ausübung des Berufs (vgl. Arets et all 1996, S. 43).
Ausgelöst durch gesellschaftliche Veränderungen und den Wandel der beruflichen Pflege begann ab den späten 1970er Jahren die Auseinadersetzung über die Notwendigkeit einer Professionalisierung in der Pflege. Lt. Recken öffnet sich die Pflege im Zuge dieser Entwicklung ab den 1980er Jahren „… in ihren theoretischen Debatten den Einflüssen aus dem angloamerikanischen Umfeld“ (Recken 2003, S. 44).
Erste Ansätze einer universitären Pflegeausbildung lassen sich in den USA auf die 1882 an der Columbia University in New York gegründete School of Nursing zurückverfolgen (vgl. Columbia University / School of Nursing 2008). Bereits ab den 1950er Jahren wurde in der Pflegeforschung an der Entwicklung eigenständiger pflegewissenschaftlicher Theorien gearbeitet.
Entgegen der traditionell an medizinisch-naturwissenschaftlichen Konzepten ausgerichteten Pflege verstanden sich diese neuen Ansätze als eine humanistisch-ganzheitliche Wissenschaft und rückte demzufolge nicht den Kranken oder die Krankheit, sondern den ganzen Menschen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Schroeter schreibt hierzu, dass die Pflegeforschung mit der Fokussierung auf die Person-Umwelt-Kontextualität immer näher an die Sozialwissenschaften heranrückte und somit in den 1980er Jahren den grundlegenden Paradigmenwechsel von der Krankheitsorientierung zur Gesundheitserhaltung vollzog (vgl. Schroeter o. J. b, S. 13).
Im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Entwicklung kam ab den 1980er Jahren auch in der deutschen Pflege zunehmend die Forderung nach einer akademischen Qualifizierung auf. 1992 wies die Robert Bosch Stiftung in ihrer Denkschrift „Pflege braucht Eliten“ auf die Notwendigkeit einer vollwertigen akademischen Ausbildung des Leitungs- und Lehrpersonals im Pflegebereich hin. Begründet wurde dies damit, dass langfristig das Qualitätsniveau der Pflege am Patienten anzuheben sei, um auch zukünftig die immer komplexeren Aufgaben in einem sozial, ökonomisch, betrieblich, fachlich und standespolitisch schwierigeren Feld bewältigen zu können (vgl. Robert Bosch Stiftung 1993, S. 97).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist strategische Personalentwicklung im Krankenhaus?
Es ist ein systematisches Konzept zur Förderung und Qualifizierung von Mitarbeitern, das direkt aus den langfristigen Unternehmenszielen des Krankenhauses abgeleitet wird, um Wettbewerbsfähigkeit und Qualität zu sichern.
Wie beeinflussen DRGs das Personalmanagement?
Die Einführung des Fallpauschalensystems (DRGs) hat den Kostendruck erhöht, was eine effizientere Personalplanung und eine gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter zur Bewältigung komplexerer Prozesse erforderlich macht.
Welche Kompetenzen sind für Pflegeberufe heute wichtig?
Neben Fachwissen gewinnen Methodenkompetenz, soziale Kompetenz und personale Kompetenz an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund der Akademisierung und Professionalisierung der Pflege.
Was ist der Unterschied zwischen Personal- und Organisationsentwicklung?
Personalentwicklung fokussiert auf die Förderung des Individuums, während Organisationsentwicklung die Strukturen und Prozesse des gesamten Systems (z. B. der Klinik) verändern will.
Warum ist Wissensmanagement im Gesundheitswesen so wichtig?
Aufgrund des medizinischen Fortschritts und des Fachkräftemangels muss vorhandenes Wissen systematisch gesichert, geteilt und kontinuierlich aktualisiert werden, um Behandlungsfehler zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.
- Quote paper
- Christian Ackermann (Author), 2009, Strategische Personalentwicklung im Krankenhaus unter besonderer Berücksichtigung stetiger Wandlungsprozesse im Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140065