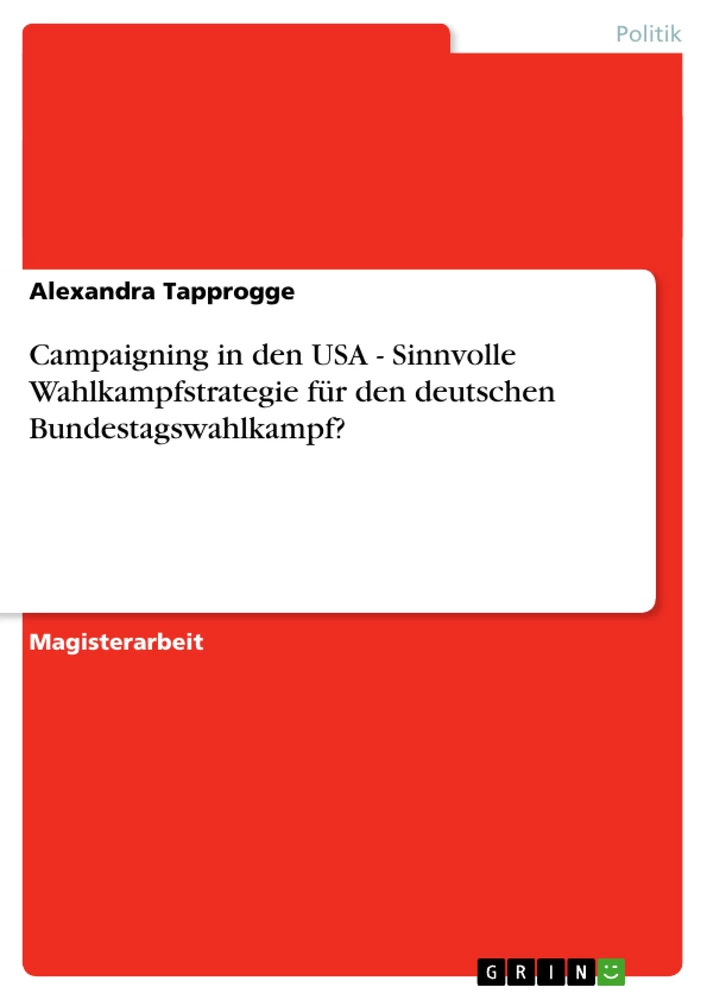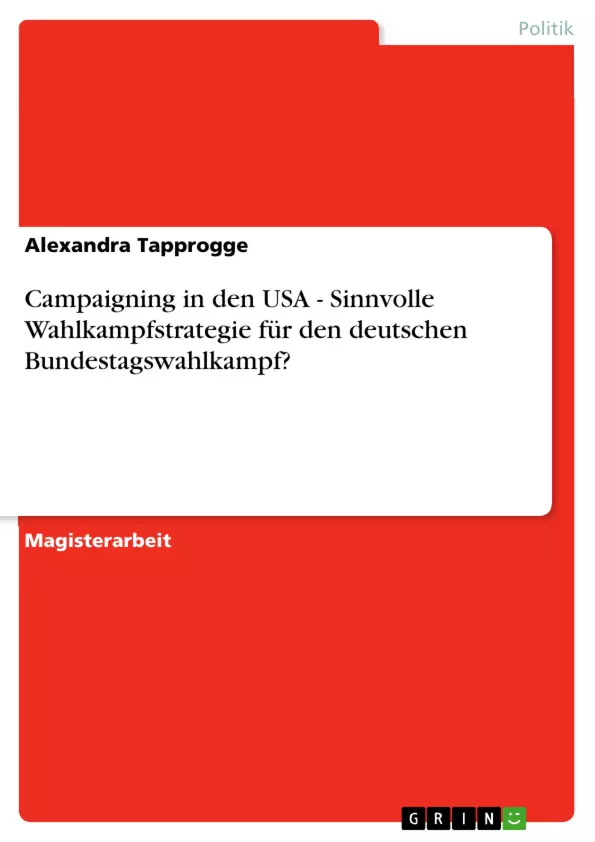[...] Die vorliegende Arbeit beleuchtet die „Waffen und Symbole“ des Campaigning.
Dabei soll zunächst geklärt werden, um welche „Kriegsmittel“ es sich handelt, wie sie
eingesetzt werden und welche Folgen sie haben.
Betrachtet man infolgedessen den bundesdeutschen Wahlkampf 1998 als
Schlacht, so kann Gerhard Schröder als erfolgreicher Krieger gelten. Denn erstmals
bediente sich ein deutscher Kanzlerkandidat vornehmlich Wahlkampftaktiken des amerikanischen
Campaigning. Eine noch größere Konzentration auf ame rikanische Wahlkampfgepflogenheiten
im Bundestagswahlkampf 2002 ist die logische Folge.
Die Wahlkampflandschaft der Bundesrepublik ist auf dem Weg in ein neues
Zeitalter. Der Einfluss des amerikanischen Campaigning ist dabei ungebrochen. Personen
stehen zunehmend im Mittelpunkt von Kampagnen, die von Profis geplant und
entworfen werden. Die Medien fungieren als Bindeglied zwischen ihnen und den Wählern,
politische Sachfragen rücken dabei mehr und mehr in den Hintergrund. Images
statt Issues lautet auch hierzulande die Parole.
Doch wie sinnvoll ist diese Entwicklung? Sind deutsche Wähler und Politiker
auf dem Weg, ihre Ansprüche an eine sachgerechte Politik aufzugeben? Brauchen wir
die Entertainisierung des Wahlkampfes um zu einer kultivierten Wahlentscheidung zu
kommen?
Die vorliegende Arbeit sucht nach Antworten auf diese Fragen. Dabei werden
bei der Betrachtung bundesdeutscher Wahlkämpfe lediglich die beiden großen Volksparteien
CDU/CSU und SPD berücksichtigt. Außerdem ist zu beachten, dass aufgrund
des frühzeitigen Abgabetermins dieser Arbeit, die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes
2002 leider nicht mehr berücksichtigt werden kann. 3
Der Arbeit hängt ein Glossar an, in welchem die wichtigsten Wahlkampftermini
– vor allem aus dem Amerikanischen – noch einmal erklärt sind. Zusätzlich finden sich
in der Dokumentation Gesprächsprotokolle der für diese Arbeit durchgeführten Interviews
mit Wahlkampfexperten aus der SPD und CDU sowie mit dem ehemaligen Wahlkampfberater der CDU, Peter Radunski, und dem amerikanischen Wahlkampfexperten
Robert Watson.
3 Stand des berücksichtigten Materials 15. Juli 2002.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wahlkampf in Perspektive
- Die Geschichte des deutschen Wahlkampfes
- Die frühe Entwicklung des Wahlkampfes
- Die 50er Jahre - Neuordnung der Wahlkämpfe
- Die 60er Jahre – Zunehmende Personalisierung
- Die 70er Jahre - Emotionalisierung durch „,,Themensetting\"\"
- Die 80er Jahre - Repolitisierung des Wahlkampfes
- Die 90er Jahre – eine neue Wahlkampfära
- Die Geschichte des Campaigning in den USA
- Die Anfänge der amerikanischen Wahlkämpfe
- Veränderte Vorzeichen
- Bedeutungsverlust traditioneller Wahlkampfmittel
- Der Begriff der „Amerikanisierung“ des bundesdeutschen Wahlkampfes
- Der Einfluss von Massenmedien im Wahlkampf
- Wirkung der Massenmedien auf die Meinungsbildung
- Wirkung von Wahlkämpfen auf die Meinungsbildung
- Zusammenfassung
- Die Geschichte des deutschen Wahlkampfes
- Campaigning in den USA
- Kommunikation als zentrale Herausforderung
- Professionalisierung der politischen Faktoren
- Age of missing information
- Die politische Werbung
- Formen politischer Werbung
- Wirkung politischer Werbung
- Nutzung traditioneller Wahlkampfformen
- Die Primaries
- Die Conventions
- Die Debates
- Der Einfluss von Debates
- Angewandte Strategien
- Die Authentizität von Debates
- Die Rolle der First Ladies in spe
- Zusammenfassung
- Kommunikation als zentrale Herausforderung
- Strategien politischer Kommunikation
- Vom Parteien- zum Personenwahlkampf
- Der Kandidat als Spiegel der Partei
- Die Emotionalisierung der Wähler
- Die Inszenierung von Politik
- Professionelles Wahlkampfmanagement
- Negative Campaigning
- Die Meinungsforschung
- Wichtigster zu bestimmender Faktor – der Wechselwähler
- Opinion Research“ – Grundlage des Campaigning
- Opposition Research
- Nutzung multimedialer Vermittlungsformen
- Die Rolle des Fernsehens
- Das Internet als Kommunikationsplattform
- Entwicklung des Wahlkampfmediums
- Die Wirkung des Internets
- Die traditionsreichen Printmedien
- Zusammenfassung
- Vom Parteien- zum Personenwahlkampf
- Elemente von Campaigning im Bundestagswahlkampf 1998
- Bundestagswahlkampf 1998
- Die Inszenierung der SPD
- Der Parteitag der SPD in Leipzig
- Wahlkampfinhalte und -kampagnen der Sozialdemokraten
- Helmut Kohl als Sinnbild der CDU
- Die Inszenierung der SPD
- Die Wahlkampfzentralen der Parteien
- Die Kampa
- Die Arena
- Zusammenfassung
- Bundestagswahlkampf 1998
- Die Zukunft des Wahlkampfes in Deutschland
- Der Medienwahlkampf 2002
- Fortschreitende Amerikanisierung
- Die Kandidaten als Zugpferde der Partei
- Die Rolle der Kandidatenfrauen
- Zusammenfassung
- Der Medienwahlkampf 2002
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des amerikanischen Campaigning auf den deutschen Bundestagswahlkampf. Ziel ist es, die Strategien und Taktiken des amerikanischen Campaigning zu analysieren und deren Bedeutung für den deutschen Wahlkampf zu bewerten. Dabei wird besonders auf die Frage eingegangen, inwiefern die „Amerikanisierung“ des deutschen Wahlkampfes sinnvoll ist.
- Die Entwicklung des deutschen und amerikanischen Wahlkampfes
- Die Rolle von Kommunikation und Medien im Wahlkampf
- Die Strategien des Campaigning, wie z.B. Personalisierung, Emotionalisierung und Inszenierung
- Die Auswirkungen des Campaigning auf den deutschen Wahlkampf
- Die Zukunft des Wahlkampfes in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die zentrale Frage nach der Sinnhaftigkeit des amerikanischen Campaigning im deutschen Wahlkampf. Anschließend wird im ersten Kapitel die historische Entwicklung des Wahlkampfes in Deutschland und den USA dargestellt. Dabei werden die Veränderungen des Wahlkampfes im Laufe der Zeit, insbesondere die zunehmende Personalisierung und Mediatisierung, beleuchtet.
Kapitel 2 widmet sich dem amerikanischen Campaigning und analysiert die verschiedenen Elemente, die dieses ausmachen. Besonders wird auf die Rolle von Kommunikation, traditionellen Wahlkampfformen, wie z.B. Primaries und Conventions, sowie auf die Strategien der politischen Werbung eingegangen.
In Kapitel 3 werden die Strategien der politischen Kommunikation im deutschen Wahlkampf betrachtet. Hier werden die Trends des Personenwahlkampfes, die zunehmende Emotionalisierung der Wähler und die Inszenierung von Politik analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Rolle von Meinungsforschung, negativem Campaigning und multimedialen Vermittlungsformen im Wahlkampf.
Kapitel 4 untersucht das amerikanische Campaigning im Bundestagswahlkampf 1998 am Beispiel der beiden großen Volksparteien CDU/CSU und SPD. Dabei werden die Wahlkampfinhalte und -strategien der beiden Parteien analysiert.
Kapitel 5 blickt in die Zukunft des Wahlkampfes in Deutschland und untersucht die Auswirkungen des amerikanischen Campaigning auf den Medienwahlkampf 2002.
Schlüsselwörter
Amerikanisches Campaigning, Bundestagswahlkampf, Personalisierung, Mediatisierung, Kommunikation, Wahlkampfstrategien, Negative Campaigning, Meinungsforschung, multimediale Vermittlungsformen, Wahlkampfexperten, Wahlkampftermini
- Citation du texte
- Alexandra Tapprogge (Auteur), 2002, Campaigning in den USA - Sinnvolle Wahlkampfstrategie für den deutschen Bundestagswahlkampf?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14010