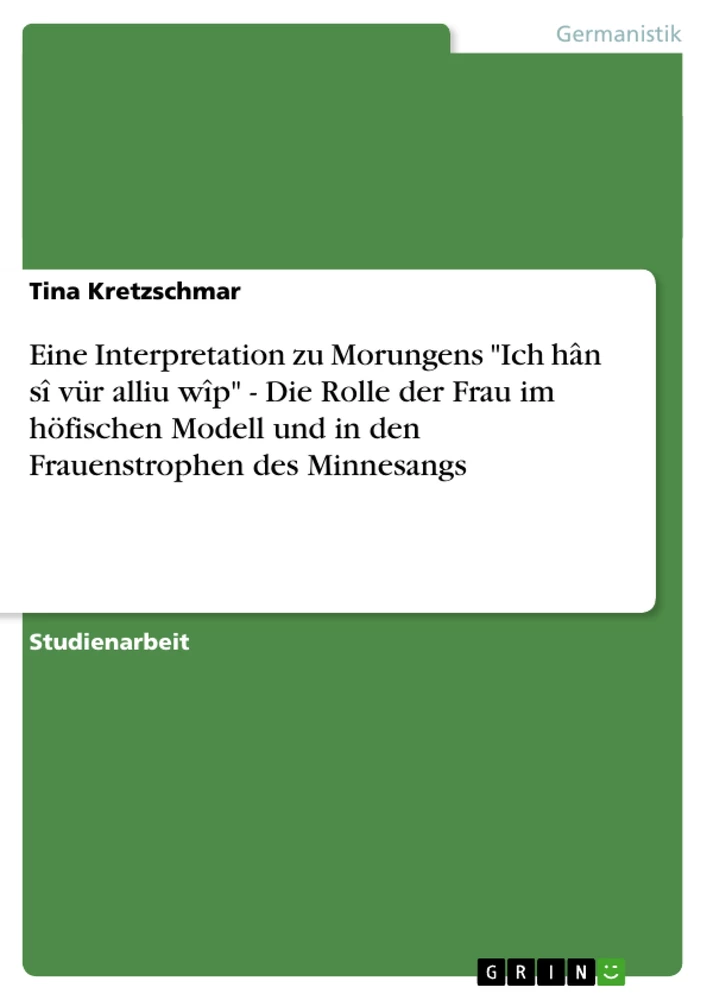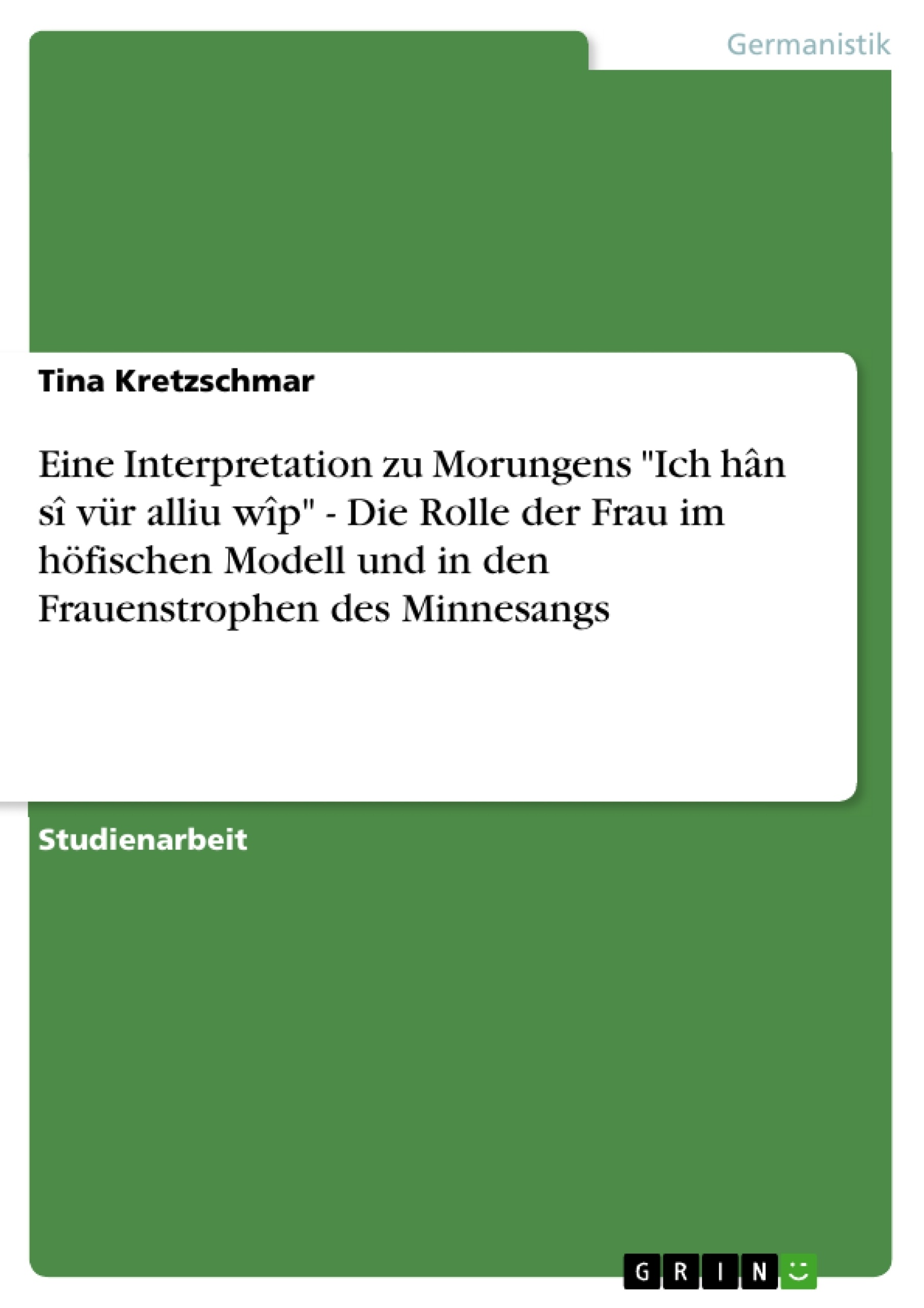„Ich habe dich lieber, als alle anderen“, welcher Frau würde diese Aussage kein verlegenes
Lächeln ins Gesicht zaubern? Anders wird es auch Frauen im Mittelalter nicht gegangen
sein, als sie vom Minnesänger mit ähnlichen Worten verzaubert worden. Die Verse des
Minnesangs, welche uns bis heute erhalten blieben vermitteln uns oft ein Bild von geliebten
und liebenden Frauen und Männern. Mit meiner Themenwahl habe ich es mir zur Aufgabe
gemacht aufzuzeigen, ob es sich dabei um tatsächlich empfundene Gefühle der im
Minnelied vorkommenden Personen handelt oder ob dieses Bild aufgrund unserer heutigen
Vorstellung von Liebe entstand. Mit einer kurzen Darstellung der Frauenposition im
höfischen System werde ich versuchen eine Grundlage für die folgende Interpretationen zu
schaffen. Insbesondere möchte ich die Frauenstrophen in Minneliedern näher beleuchten
und dabei die Funktion dieser für den gesamten Minnesang herausarbeiten.
Um die angeführten Tatsachen dabei an einem Beispieltext erläutern zu können habe ich den
Doppelwechsel „Ich hân sî vür alliu wîp“ des Sängers Heinrich von Morungen gewählt. An
diesem Minnelied möchte ich jedoch nicht nur die Frauenstrophen interpretieren, obwohl ich
darauf das Hauptaugenmerk lege, sondern möglichst umfassende Auslegungsansätze finden.
Auch die von Morungen begründete Form des Tageliedwechsels möchte ich in den
Interpretationsansätzen mit gewichtiger Bedeutung berücksichtigen.
Eine besondere Herausforderung stellt die Interpretation des Liedes für mich aus dem
Grunde dar, da es als Vorstudie1 des Liedes XXX „Owê, - sol aber mir iemer mê“
angesehen wird und die Deutungen des Liedes X selbst bisher nur dementsprechend knapp
ausfielen. Auch dem formalen Aufbau des Minnesangliedes „Ich hân sî vür alliu wîp“ wird
in bisheriger Forschungsliteratur nur umrisshaft Berücksichtigung geschenkt. In dieser
Arbeit werde ich versuchen auch diesen Aspekt in einem möglichst umfassenden Umfang
einzubeziehen.
1 Vgl. H. Tervooren, Anmerkungen zu den Liedern Heinrich von Morungens 1975, S.158.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Rahmen und Zielsetzung der Untersuchung
- 2. Heinrich von Morungen „Ich hân sî vür alliu wîp“
- 2.1. Liedtext
- 2.2. Überlieferung
- 2.3. Inhalt des Liedes
- 2.4. Äußere Form des Liedes
- 2.5. Erste Interpretationsansätze zum „Tageliedwechsel“
- 3. Die Frauenrolle im Minnesang
- 3.1. Die Frau im Höfischen Modell
- 3.2. Die Frau im Wechsel und in den Frauenstrophen
- 3.3. Interpretation der Frauenstrophen im Lied X
- 4. Zusammenfassende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Minnelied „Ich hân sî vür alliu wîp“ von Heinrich von Morungen und untersucht die Rolle der Frau im höfischen Modell und in den Frauenstrophen des Minnesangs. Ziel der Arbeit ist es, zu ergründen, ob die im Minnelied dargestellten Gefühle tatsächlich authentisch waren oder ob sie durch unsere heutige Vorstellung von Liebe geprägt sind. Die Arbeit beleuchtet die Funktion der Frauenstrophen und die Bedeutung des Tageliedwechsels in der Interpretation des Liedes.
- Die Rolle der Frau im höfischen System
- Die Bedeutung des Tageliedwechsels
- Die Funktion und Interpretation der Frauenstrophen im Minnelied
- Die Darstellung von Liebe und Zuneigung im Minnelied
- Die Interpretation des Liedes „Ich hân sî vür alliu wîp“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Rahmen und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie untersucht die Frage, ob die im Minnelied dargestellten Gefühle tatsächlich authentisch waren oder ob sie durch unsere heutige Vorstellung von Liebe geprägt sind. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit dem Lied „Ich hân sî vür alliu wîp“ von Heinrich von Morungen, inklusive des Liedtextes, der Überlieferung, des Inhalts, der äußeren Form und der ersten Interpretationsansätze zum Tageliedwechsel. Im dritten Abschnitt wird die Frauenrolle im Minnesang beleuchtet, unterteilt in die Frau im höfischen Modell, die Frau im Wechsel und in den Frauenstrophen, sowie die Interpretation der Frauenstrophen im Lied X.
Schlüsselwörter
Minnesang, Heinrich von Morungen, „Ich hân sî vür alliu wîp“, Tageliedwechsel, Frauenstrophen, Höfisches Modell, Liebe, Zuneigung, Frauenrolle, Interpretationsansätze
- Quote paper
- Tina Kretzschmar (Author), 2003, Eine Interpretation zu Morungens "Ich hân sî vür alliu wîp" - Die Rolle der Frau im höfischen Modell und in den Frauenstrophen des Minnesangs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14011