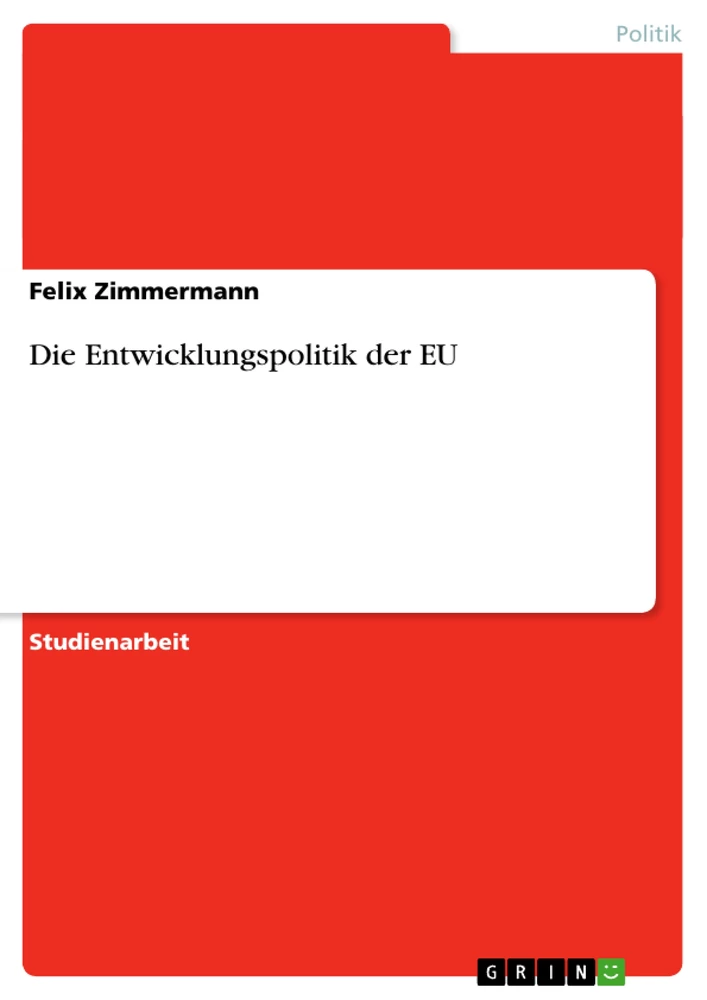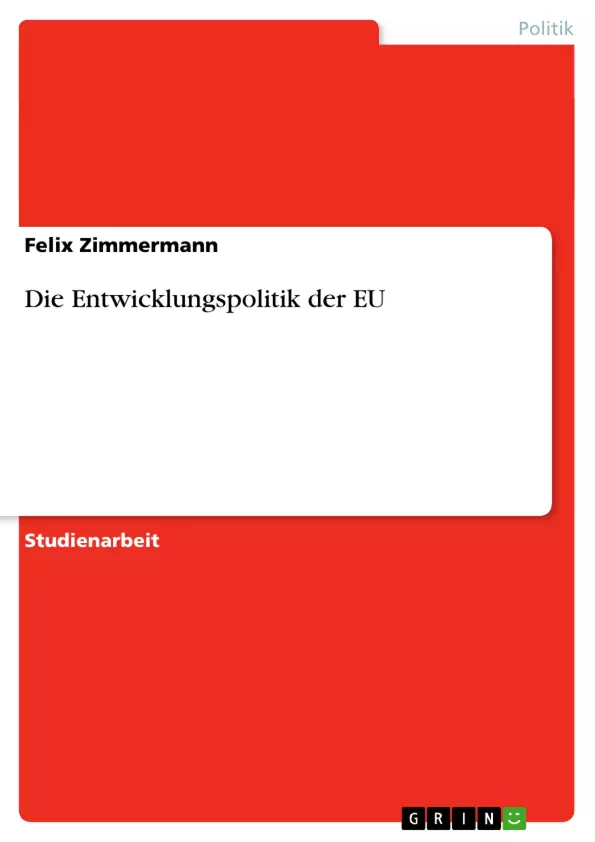Einer der wichtigsten Grundsätze der Europäischen Union besteht in der politischen Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern. Dies begründet sich in erster Linie durch die postkoloniale Verantwortung einiger ihrer wirtschaftlich stärksten Mitglieder und den damit verbundenen Hilfsleistungen gegenüber den Staaten der so genannten dritten Welt. Zweifelsohne stehen derlei Verpflichtungen in vielen Bereichen im Widerspruch zu wirtschaftspolitischen Eigeninteressen europäischer Industrienationen. Dennoch birgt die Nord-Süd-Kooperation auch Chancen in sich, wie die Bestrebungen der EU...
Studiengang: MES 1. Semester
Einführung in die VWL für Juristen/Kulturwissenschaftler
- Kurzreferat -
Die Entwicklungspolitik der EU
Einer der wichtigsten Grundsätze der Europäischen Union besteht in der politischen Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern. Dies begründet sich in erster Linie durch die postkoloniale Verantwortung einiger ihrer wirtschaftlich stärksten Mitglieder und den damit verbundenen Hilfsleistungen gegenüber den Staaten der so genannten dritten Welt. Zweifelsohne stehen derlei Verpflichtungen in vielen Bereichen im Widerspruch zu wirtschaftspolitischen Eigeninteressen europäischer Industrienationen. Dennoch birgt die Nord-Süd-Kooperation auch Chancen in sich, wie die Bestrebungen der EU zur Eingliederung von Kompetenzträgern aus Entwicklungsländern aufzeigen.
Im Folgenden wird die Veränderung der Zielsetzung europäischer Entwicklungspolitik unter besonderer Berücksichtigung der Maßnahmen im Bereich der humanitären Hilfe dargestellt. Abschließend behandelt ein kurzer Ausblick aktuelle Herausforderungen der EU im bereich der Entwicklungszusammenarbeit.
Der Entwicklungsgedanke von „Lomé“ bis „Cotonou“: aus „Hilfe“ wird
„Zusammenarbeit“
,, Die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der
Entwicklungszusammenarbeit, die eine Ergänzung der entsprechenden Politik der Mitgliedstaaten darstellt, fördert
- die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der am meisten benachteiligten Entwicklungsländer;
- die harmonische Schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die
Weltwirtschaft;
- die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern.“1
Ursprünglich wurde dieser Entwicklungsgedanke im Gründungsvertrag der EG als Teil der „Römischen Verträge“ (1957) festgehalten. Zu jenem Zeitpunkt verstand man Entwicklung noch vorrangig als Resultat wirtschaftlichen Wachstums.2Mittlerweile hat sich der entwicklungspolitische Handlungsrahmen jedoch deutlich erweitert, was sich insbesondere am Prozess der Schwerpunktverlagerung von den vier „Lomé- Abkommen“3 (1975-2000) bis hin zum Inkrafttreten des „Cotonou-Abkommen“ (2002) ablesen lässt.
Erstere bestimmten über Jahrzehnte hinweg die Fördermaßnahmen der EU gegenüber den „AKP- Staaten“4. Vor dem Hintergrund der Aufrechterhaltung einer Einflussnahme gegenüber den ehemaligen Kolonien trieb man die wirtschaftliche Förderung der fortan unabhängigen Entwicklungsländer voran. Das daraus resultierende Entstehen neuer Abhängigkeiten stellte sich jedoch als nicht unproblematisch heraus: Mit „Lomé I“ fand seitens der EG ein Umdenken statt, indem man die von den Entwicklungsländern z. T. als neo-kolonialistisch angesehene Politik der „Assoziation“ in eine - zumindest vertragliche festgehaltene - partnerschaftliche „Kooperation“ umwandelte. Der Neugewinn an Einfluss drückte sich vor allem in der Handelspolitik aus, welche nach wie vor den Entwicklungsgedanke dominierte. Die AKP-Staaten wurden begünstigt, indem die EG ihnen freien Zugang zu ihren Märkten gewährte, ohne sie dadurch zu einer Gleichbehandlung zu verpflichten.5Eine bedeutende Erweiterung des Entwicklungsverständnisses ging hingegen erst mit den Verträgen „Lomé TTT/TV“ gegen Ende des 20. Jh. Einher: Erstmals wurden Forderungen bezüglich der Einhaltung von Menschenrechten in den Vertragstext aufgenommen. Diese Abkehr von einer rein ökonomischen Entwicklung nahm schließlich mit dem Anschluss des „CotonouAbkommen“ konkretere Formen an. Sie sollten den Ausgangspunkt einer komplett „neu strukturierten Entwicklungszusammenarbeit“6markieren, deren Umsetzung u. a. die Vereinbarkeit entwicklungspolitischer Maßnahmen auf nationaler und supranationaler Ebene zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten voraussetzte.
Mit „Cotonou“ gesellten sich zu Hauptakteuren der EU-Entwicklungspolitik 7drei weitere EG-AKP-Organe: der „Botschafterausschuss“, die „Paritätische
Parlamentarische Versammlung (PPV)“, sowie der „AKP-EG Ministerrat“. Mittels dieser Tnstrumente erweiterte man den Rahmen des politischen Dialogs und widmete sich neben der Handelspolitik und der damit verbundenen Armutsbekämpfung einer Wahrung der Menschenrechte, einer verstärkten Demokratieförderung sowie der Konfliktprävention. Dementsprechend fand eine Rückbesinnung aufjene Grundsätze des EG - Vertrags (s. o.) statt, welche in den „Lomé - Verträgen“ vernachlässigt worden war. Darüber hinaus setzte man auf eine stärkere Beteiligung der Zivilgesellschaft am Entwicklungsprozess.8Derartige Kooperationsinitiativen gehören zu den bedeutendsten Faktoren für eine wirksame Bereitstellung materieller und immaterieller Hilfsgüter durch die Europäische Union. Dies gilt vor allem für den Bereich der humanitären Hilfe.
Die humanitären Hilfsmaßnahmen der EU
Die „Generaldirektion Humanitäre Hilfe“ (ECHO) untersteht der Europäischen Kommission und hat sich zum Ziel gesetzt, als einflussreichstes Hilfsorgan der EU
Leben zu schützen, Leiden zu verhindern bzw. zu mildem, sowie die Menschenwürde zu bewahren. Sie wird aktiv, sobald die lokalen Akteure und Regierungen angesichts humanitärer Krisen - seien sie von Menschen oder durch Naturkatastrophen verursacht - handlungsunfähig sind. Die humanitären Aktionen der EU basieren auf den Prinzipien der „Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit.“9Als größter Einzelgeber weltweit spielt die Europäische Union eine bedeutende Rolle im bereich der humanitären Hilfe.10Im letzten investierte die Europäischen Kommission 751 Millionen €11 in die humanitäre Hilfe.12Der Umfang der benötigten Hilfsgelder steht in engem Zusammenhang mit dem Ausmaß der im jeweiligen Zeitraum entstandenen Krisen. Die Effektivität der Hilfsmaßnahmen ist jedoch ebenfalls entscheidend für den Erfolg der EU im humanitären Sektor. Sie stellt eine der Herausforderungen europäischer Entwicklungszusammenarbeit dar.
Aktuelle Herausforderungen der EU-Entwicklungspolitik Generell gilt es, nationale Interessen so weit wie möglich mit den entwicklungspolitischen Zielen auf supranationaler Ebene zu vereinbaren. Für die Finanzierung des Hilfsapparates muss die Europäische Kommission allerdings Richtlinien vorgeben, um ihr Budget den Bedürfnissen der Entwicklungsländer anzupassen. Bis 2015 erwartet sie daher von den Mitgliedstaaten, ihren Hilfsbeitrag auf 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufzustocken.13Der finanzielle Rahmen bietet allerdings lediglich die Basis entwicklungspolitischer Arbeit: Des Weiteren gilt es, die Mittel auf möglichst direktem in die Projekte fließen zu lassen, welches wiederum eine transparente und gegenseitig befürwortete Kooperation der Entwicklungspartner bedingt. Für eine solche Entwicklung ist vor allem die Aussicht auf einen potentiellen Profit aller beteiligten Parteien förderlich.
Quellen:
Literatur:
Dialer, Doris: Die EU-Entwicklungspolitik im Brennpunkt. Brandes & Apsel: Frankfurt am Main 2007
Kaltefleiter, Viola: Die Entwicklungspolitik der Europäischen Union - Rechtfertigung, Effizienz und politische Ökonomie staatlicher Entwicklungshilfe. Physica Verlag: Heidelberg 1995
Kappel, Robert: INEF-Report Heft 17. Gerhard-Mercator-Universität: Duisburg 1996
Schmidt, Gert: Handelspolitik versus Entwicklungspolitik. Peter Lang: Frankfurt am Main 1995
Internet (Stand: 24,02,20091:
Informationsseite der Europäischen Kommission: http://ec.europa.eu
Zugang zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: http://eur-lex.europa.eu
Die Internetpräsenz der Organisationfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): http://oecd.org
[...]
1Siehe Artikel 177 (1)EGV auf http://eurlex.europa.eu/de/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325DE.003301.html
2Vgl. Schmidt 1995: S. 60
3Die „Lomé-Abkommen“ sind als Nachfolgeverträge derbedeutungsärmeren „Yaoundé-Abkommen“ (1964-1975) zu betrachten, welche vornehmlich die wirtschaftliche Entwicklung mit Mitteln des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) vorantreiben sollten.
4 Die „AKP (Afrika-Karibik-Pazifik) -Staaten“ bildeten bis in die frühen 1990er den Schwerpunkt europäischer Entwicklungszusammenarbeit. Der Zerfall des Ostblocks bewirkt jedoch, dass fortan auch dieser Teil der Welt (wie auch die Mittelmeerländer aufgrund ihrer geographischen Lage) zunehmend von der Entwicklungshilfe profitiert. „Die veränderte geostrategische Landschaft vermindert den Einfluss der AKP-Länder außerdem zugunsten wichtiger asiatischer Länder.. .und Lateinamerikas. Die Rolle der AKP- Länder als “Hinterland“ und Bollwerk gegen den Kommunismus entfällt. Die Karten der internationalen Politik werden neu gemischt, die AKP-Länder geraten aufgrund ihrer wirtschaftlichen Schwäche und ihrer strategischen Bedeutungslosigkeit gegenüber den anderen Regionen der 3. Welt ins Hintertreffen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Zukunft der Kooperation der EU und der AKP Staatengemeinschaft.“ Siehe Kappel in INEF-Report Heft 17/1996: S. 5 Nach wie vor ist die Entwicklung der AKP-Staaten jedoch die Priorität europäischer Entwicklungspolitik.
5Vgl. Dialer 2007: S.46-55
6 Die „Lomé-Abkommen“ wurde seitens der EU wie auch von der Allgemeinheit als gescheitert angesehen, da sie das Hauptziel einer wirtschaftlichen Tntegration der Entwicklungsländer verfehlt haben. Nach wie vor seien die Volkswirtschaften zu wenig in den Welthandel einbezogen. Die Gründe dafür lägen u.a. in den protektionistischen Tmportstrategien der EU-Länder, wie auch in dem Machtgefalle zwischen Nord u. Süd, welches dem Partnerschaftsgedanke widerspricht. Vgl. Dialer 2007: S.58
7 Gemeint sind hiermit folgende Tnstitutionen: EU-Kommission, die Generaldirektion Entwicklung, die GD Humanitäre Hilfe, die EG Delegationen sowie Europe Aid.
8Vgl. DialerS. 93-141
9Siehe Abschnitt 2.1 „Humanitäre Grundsätze“ auf http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/consensus_de.pdf
10Im Jahre 2007 stellte die GD Echo Hilfsgelder im Umfang von 422,7 Mio für die AKP-Länder, 157,4 Mio für Asien und Lateinamerika (sowie Osteuropa und die Neuen unabhängigen Staaten) und 124, 9 Mio für den Nahen Osten und den Mittelmeerraum zur Verfügung. Die GD Echo fungiert in erster Linie als Geber und arbeitet mit NGOs, UN- Organisationen und internationalen Organisationen zusammen, welche die Hilfsprojekte umsetzen. Vgl. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0449:FIN:DE:HTML
11Vgl. « Budget de la Communauté pour l’aide humanitaire 2008 »auf http://ec.europa.eu/echo/files/funding/budget/yearly_budget_fr.pdf
12Für den gesamten Bereich betrug das Entwicklungshilfebudget (2007) 7,9 Milliarden €. Vgl. http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
13Vgl. http://ec.europa.eu/news/external_relations/080409_2_de.htm
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Cotonou-Abkommen?
Ein 2000 unterzeichnetes Abkommen zwischen der EU und den AKP-Staaten, das die Entwicklungszusammenarbeit auf politische Dialoge, Handel und Armutsbekämpfung ausrichtet.
Wer sind die AKP-Staaten?
Eine Gruppe von Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazifik, die historisch enge Bindungen zu ehemaligen europäischen Kolonialmächten haben.
Was ist ECHO?
ECHO ist die Generaldirektion für europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, die weltweit Hilfe bei Krisen und Naturkatastrophen koordiniert.
Wie hat sich die EU-Entwicklungspolitik gewandelt?
Sie entwickelte sich von rein wirtschaftlicher "Hilfe" hin zu einer partnerschaftlichen "Zusammenarbeit", die auch Menschenrechte und Demokratie einbezieht.
Was ist das 0,7-Prozent-Ziel?
Die Verpflichtung von Industrieländern, 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit auszugeben.
- Arbeit zitieren
- Felix Zimmermann (Autor:in), 2009, Die Entwicklungspolitik der EU, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140113