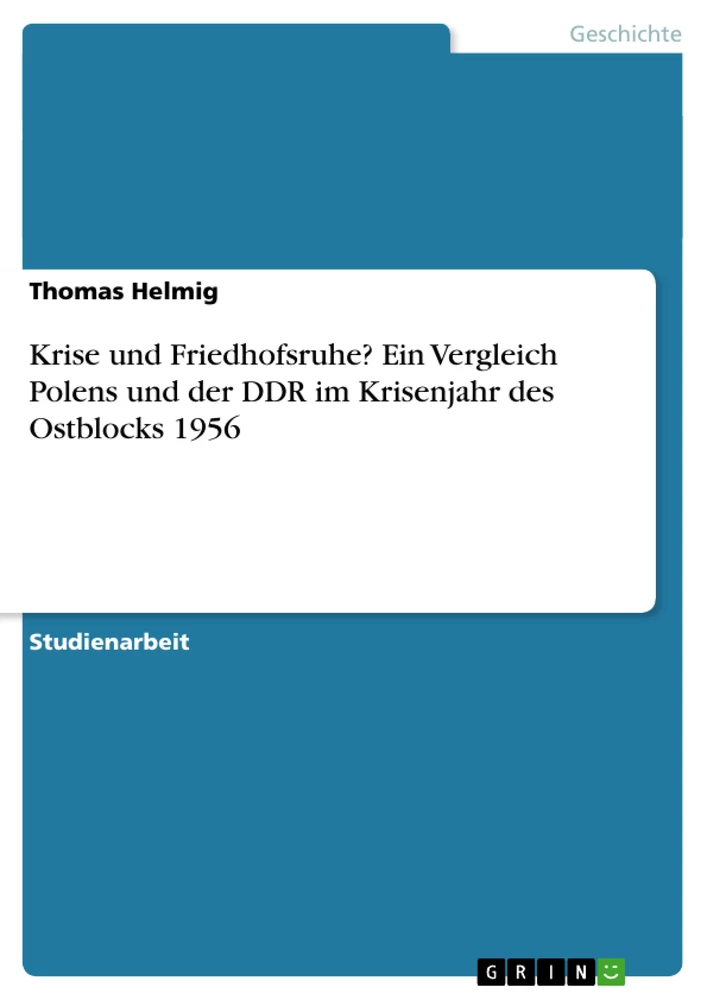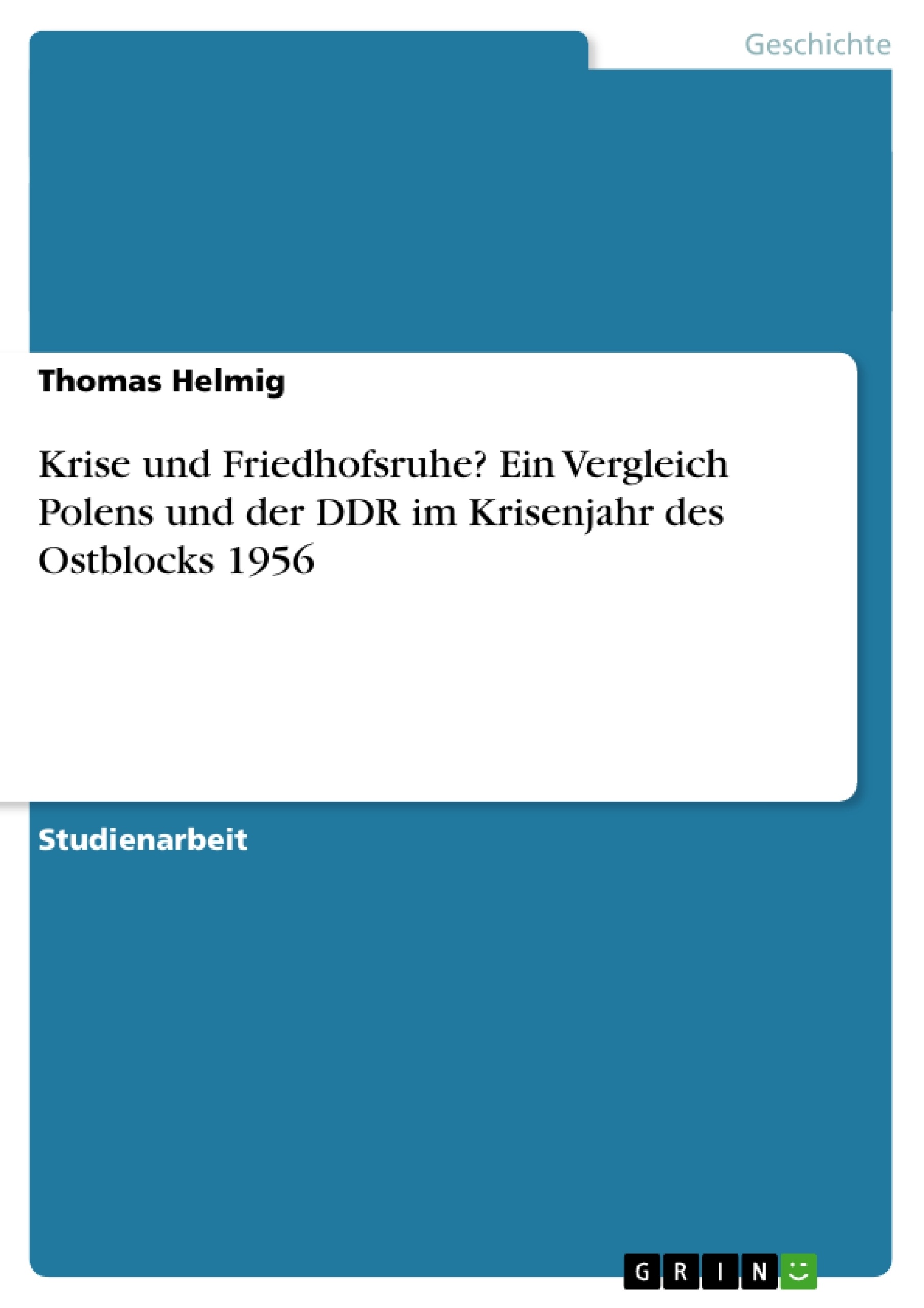Der XX. Parteitag stellte eine bedeutende Zäsur des Ostblocks dar, der eine Reihe von Erschütterungen auslöste. In Polen scheiterte der Versuch der PZPR, durch eine Veröffentlichung der Geheimrede Chruščëvs das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Zu tief war die Spaltung der Partei; zu groß die Signalwirkung auf die polnische Gesellschaft, als das die „Strategie der kontrollierten Liberalisierung und hätte gelingen können. Zu welchen Folgen eine Aufweichung der ideologischen Position verbunden mit ökonomischer Unzufriedenheit in weiten Teilen der Arbeiterschaft führte zeigt der Aufstand in Poznań. Doch auch nach der Niederschlagung des Aufstandes in Poznań glich die kommunistische Herrschaft dem „Tanz auf dem Vulkan“ Erst mit der Rehabilitierung des früheren Parteichefs Gomulka gelang es die Lage zu stabilisieren. Gomulka wurde von weiten Teilen der Bevölkerung nicht als Knecht der SU oder Kommunist wahrgenommen wurde, sondern vor allen als Pole, dem es galt beizustehen. Die Wiedererlangung einer gewissen Legimität gelang auch deshalb, weil einige gesellschaftliche Kernforderungen erfüllt wurden. Wo diese Legimität in Folge wieder versagte, konnte Gomulka die polnische Gesellschaft damit erpressen, dass eine Nichtbeachtung der Interessen der SU den polnischen Staat einem ähnliches Schicksal wie Ungarn ausliefern würde. Auch wenn es in der DDR in Folge des XX. Parteitages zu Krisenerscheinungen, wie vereinzelten Streiks, abweichenden Verhalten an Universitäten, Vorlage von Alternativkonzepten durch Intellektuelle und einem Führungskampf innerhalb des Politbüros kam, so bleibt doch festzuhalten, dass es der SED und insbesondere Ulbricht gelang die Situation weitestgehend unter Kontrolle zu halten, ja sogar gestärkt in seiner Position aus dem Jahr 1956 hervorzugehen. Die Formulierung programmatischen Alternativen durch eine Gruppe von Intellektuellen blieb für die DDR weitgehend folgenlos, da es den beteiligten Akteuren nicht, gelang eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Die DDR wurde infolge des Jahres 1956 auf ideologischem Gebiet der Musterknabe des Ostblocks. Dass man dann mit Polen ausgerechnet die „unsicherste Baracke“ des Sozialismus als Nachbar hatte belastete in den folgenden Jahrzehnten immer wieder die Beziehungen zwischen der DDR und Polen. Ein „Monumentalbild der Großen Freundschaft“ zwischen den Ländern des Ostblocks und der SU ließ sich nach den Ereignissen des Jahres 1956 sowieso nicht mehr aufrechterhalten.
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Fragestellung und Vorgehen
1.2. Forschungsstand
2. „Tauwetter“ in der SU
2.1. Chruš ëv und der XX. Parteitag der KPdSU
3. Das Jahr 1956 in Polen
3.1. Der Aufstand in Pozna und die Massenproteste im Herbst
3.2. Die Ursachen der polnischen Krisen
3.2.1. Die Spaltung der PZPR
3.2.2. Eine polnische Zivilgesellschaft
4. Das Jahr 1956 in der DDR
4.1. Der Umgang mit den Ergebnissen des XX. Parteitag der KPdSU
4.2. Rebellion der Intelektuellen
4.3. Der Konflikt im Politbüro
4.4. Die Situation an den Universitäten
4.5. Wirtschafts- und Versorgungslage im Jahr
4.6. Tiefere Ursachen für die relative Ruhe in der DDR
4.6.1. Der „Lernschock“ des 17. Juni
4.6.2. Offene Grenze
5. Resümee und Folgen
Abkürzungsverzeichnis
Bibliographie
Einleitung
Richtete sich 2003, zum fünfzigsten Jahrestag des Juniaufstandes in der DDR, die mediale und publizisitische Gedenkaufmerksamkeit in Deutschland vorrangig auf den nationalen Kontext, so ließ sich 2006, aus Anlass des fünfzigsten Jahrestages des Ungarnaufstandes, erfreulicherweise beobachten, dass die Berichterstattung in Hörfunk, TV und Presse um eine Einordnung der ungarischen Ereignisse im Herbst 1956 in die Entwicklungen des kommunistischen Krisenjahres 1956 bemüht war. Insbesondere wurde ein enger Bezug zu den Ereignissen des im Februar 1956 stattgefundenen XX. Parteitages der KPdSU und der sog. Entstalinisierungsrede des russischen KP-Führers Chruš ëv hergestellt.1 Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielten jedoch die Entwicklungen in Polen und der DDR. Ein Grund hierfür mag sein, dass es nicht zu einem gesamten national-revolutionären Aufstand wie in Ungarn kam, der ähnlich wie 1953 in der DDR durch sowjetische Intervention blutig niedergeschlagen wurde. Jedoch kam es gerade in Polen in Folge des XX. Parteitages der KPdSU im Jahr 1956 örtlich zu ähnlichen Entwicklungen wie in Ungarn an deren Ende sich die polnischen Kommunisten mit einer Begrenzung ihres im Grunde noch totalitären Herrschaftsanspruches abfinden mussten. Begrenzte Autonomie von Kirchen, Kultur- und Wissenschaftskreisen war die Folge.2 Anders hingegen in der DDR, hier folgten auf den XX. KPdSU Parteitag keine schweren Erschütterungen von Partei, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Gegenteil, der erste Mann im Staate, Walther Ulbricht, konnte wie schon in der Junikrise 1953, die Ereignisse nutzen, und seine Position innerhalb der SED, als auch gegenüber der SU zu festigen. Somit stand am Ende des Jahres 1956 einer zaghaften Liberalisierung in Polen eine verstärkte „Re“- Ideologisierung3 und zunehmende Repression in der DDR gegenüber. Wieso verlief das Jahr 1956 in der DDR und Polen so unterschiedlich?
1.1. Fragestellung und Vorgehen
Ausgehend von dem Postulat, die DDR und die Warschauer Pakt Staaten nicht als monolithischen Block zu betrachten, soll die Frage beantwortet werden, warum es in Polen 1956 zu Aufständen und einem Führungswechsel innerhalb der PZPR kam und in der DDR die Lage den Anschein nach vergleichsweise ruhig blieb.
Um sich der Frage zu nähern, wird einleitend in Abschnitt 2 auf die sowjetischen Entwicklungen nach Stalins Tod bis zum XX. Parteitagtag der KPdSU im Februar 1956 eingegangen, welcher mit als Auslöser und Katalysator kommender Ereignisse in den Warschauer Pakt Staaten gilt. In Polen zeigten sich Krisenerscheinungen in Form eines Aufstandes in Pozna sowie eines Machtwechsels innerhalb der PZPR. Verbunden mit einer kurzen Schilderung der Ereignisse soll anhand der Analysekategorien Partei und Gesellschaft in Kapitel drei auf die Ursachen der beschriebenen Entwicklungen eingegangen werden. An Hand der gleichen Kategorien wird in Kapitel vier die Situation in der DDR innerhalb des gleichen Zeitraums beleuchtet. Um jedoch eine ausreichende Antwort auf die Frage nach den Ursachen der „Friedhofsruhe“ in der DDR geben zu können, wird zusätzlich in Kapitel Vier noch auf die Auswirkungen des Lernschocks vom 17. Juni 1953 sowie die offene Grenze zur BRD eingegangen. Abschließend soll zusammenfassend die Hauptfrage beantwortet werden und ein kurzer Überblick über die Folgen des Jahres 1956, sowohl für die DDR, als auch für Polen gegeben werden.
1.2. Forschungsstand
In der polnischen Forschung bildete das Jahr 1956 immer schon einen wichtigen ezugspunkt bei der Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur. Die Debatten drehten sich hierbei vor allen um zwei Punkte. Zum einen die schwächere Anbindung Polens an die SU nach den Ereignissen des Jahres 1956 und zum anderen die Diskussion, ob sich Polen im Verlauf des Jahre 1956 vom totalitären zum autoritären System wandelte.4 Damit verbunden, die wie auch in Deutschland teilweise erbittert geführte Debatte um den Totalitarismusbegriff. In der Erforschung der DDR wurde das Krisenjahr erst ab Mitte der 90iger Jahre zum 40. Jahrestag des Ungarnaufstandes stärker wahrgenommen. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Debatten in den 90iger Jahren um die Bewertung des 17.
Juni, 1953, den Mauerbau 1961 und der adäquaten Beschreibung des Diktaturcharakters kreisten. 1996 erschien der erste Sammelband in dem sowohl auf die Bedeutung des Jahres 1956 innerhalb der DDR eingegangen wurde als auch ein Bezug zu den sowjetischen und polnischen Ereignissen hergestellt wurde.5 Eine umfassenden Einbettung der Rolle der DDR innerhalb der Warschauer Paktes und des RGW wurde zwar weiterhin als Disiderat angemahnt6 stand jedoch bis Mitte des neuen Jahrzehnts weitgehend aus.7 Mit dem 50 Jahrestag der Aufstände in Ungarn und Polen sowie des XX.. Parteitages stieg die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema an. Eine Ausgabe der APUZ erschien zum Thema, Fachbeiträge und Monografien wurden veröffentlicht. Hervorzuheben ist hier etwa die 2007 von Wentker vorgelegte Monographie zur Außenpolitik der DDR, in dem es ihm gelingt detailliert nachzuzeichnen wie die SED Führung die Ereignisse im polnischen Herbst wahrnahm und auf sie reagierte.8 Eine detaillierte Sicht auf die Herrschaftsrepräsentation und deren Funktionsweise im Jahr 1956 sowohl in Polen als auch in der DDR gibt Behrends in seiner 2006 erschienenen Monographie.9 Mit seiner engen Bezugnahme auf die Ereignisse des XX.. Parteitages gelingt es ihm vor allen die unterschiedlichen Auswirkungen der Geheimrede in Polen und der DDR auf die jeweiligen Parteiapparate detailliert nachzuzeichnen.
2. „Tauwetter“ in der SU
Nach dem Tod Stalins am 5. März 1953 gab es in der SU eine Phase der zaghaften Liberalisierung. Der Roman von Ilja Ehrenburg „Tauwetter“ gab diesem Zeitraum seinen Namen. Unmittelbar nach Stalins Ableben kam es zu einer Korrektur stalinistischer Beschlüsse. Im Jahr 1953 gab es eine erste Generalamnestie, bei der vor allem Gefangene aus dem Gulag-System entlassen wurden. Noch zu Lebzeiten des gefürchteten Lawrenti Berija wurde per Politbürobeschluss das Tragen von Konterfeien lebender Parteigenossen untersagt, um so den Personenkult Einhalt zu gebieten. Die Einstellung des permanenten Terrors und die Abschaffung von Sondergerichten im September 1953 waren weitere Zeichen für das Abziehen des stalinistischen Frostes. Erste kritische Prawda Artikel, begleitet von der Einrichtung einer Untersuchungskommission im November 1955, fragten nach dem Verbleib von Parteigenossen und „ehrlichen Sowjetbürgern“ während der Stalinzeit.10
Parallel dazu sorgte der „Neuen Kurs“ in der Wirtschaftspolitik11 zu einem, wenn auch auf niedrigen Niveau, steigenden Lebensstandard der Bevölkerung. Ein Kurs, der auch in den ostmitteleuropäischen Staaten durchgesetzt wurde. Ebenso lässt sich in den internationalen Beziehungen ein Tauwetter erkennen, da Moskau nach Stalin dringend eine Phase der Konsolidierung benötigte. Als Beispiele hierfür lassen sich das Waffenstillstandsabkommen in Korea, der Österreichische Staatsvertrag vom 15.05.1955, der Besuch Adenauers in Moskaus im April 1955 sowie der Besuch Chruschtschows im Juni 1955 im bis vor kurzen offiziell durch die SU verteufelten Yugoslawien nennen. 12
Einig war sich die sowjetische Führung nach 1953, dass der Staatsterror gegen die Bevölkerung aufhören musste, seine lähmende Wirkung auf die sowjetische Gesellschaft war unverkennbar13. Eine weitere Aufgabe bestand, spätestens nach Integration der BRD in die NATO, in der Konsolidierung des eigenen Hegemonialbereiches. Die Verabschiedung des Warschauer Vertrages im Mai 1955 und die Gewährung der „vollen Souveränität“ für die DDR im September desselben Jahres sind Zeichen für diese Konsolidierungsbemühungen der SU.
2.1. Chruš ëv und der XX. Parteitag der KPdSU
Vom 14. bis 25. Februar 1956 fand in Moskau der XX. Parteitag der KPdSU statt. Dieser kann innersowjetisch als ein Kapitel der Diadochenkämpfe, die seit dem Tod Stalins in der sowjetischen Führung tobten, gesehen werden. Innerhalb der SU-Führung war zu diesem Zeitpunkt unklar, wie stark mit Stalin zu brechen sei.14 Chruš ëv, dem 1.
Sekretär des ZK der KPdSU gelang es, die Frage in seinem Sinne zu klären und sich so die Vormachtstellung innerhalb von Partei und Staat zu sichern. Am letzten Tag des XX. Parteitages hielt er eine geheime Rede vor den ausschließlich sowjetischen Delegierten des Parteitages. In einem vierstündigen Scherbengericht wurde Stalin von seinem fast heiligen Sockel gerissen. Neben den Verbrechen, die in der Partei begangen wurden, brandmarkte Chruš ëv unter anderem die Fehler Stalins im II. WK, seinen Personenkult sowie die Schauprozesse.15
Es war für viele im Auditorium ein Schock. Der gütige und weise Vater Stalin ein gemeiner Verbrecher. Was waren die Beweggründe für die folgenschwere Rede? Chruš ëv trat die Flucht nach vorn an und schaltete so seine innerparteilichen Widersacher aus. In dem er sich als Modernisierer und läuterungswilliger Genosse gab, diskreditierte er die langjährigen Paladine Stalins, insbesondere Molotow, Kaganowitsch und Malenkow die tief in die Verbrechen Stalins verstrickt waren. Selber trat somit seine eigene, nicht unerhebliche, Rolle in der Terrormaschinerie in den Hintergrund. In seinen Ausführungen wurde der Übeltäter klar benannt, während die Partei in Unschuld gebadet und als Opfer des Größenwahnsinns eines Mannes dargestellt wird. Ideologie und Herrschaftsordnung konnte somit unangetastet bleiben.16 Es gelang Chruš ëv so seine eigene Machtbasis innerhalb der Partei auszubauen und den Fortbestand des totalitären Regimes zu sichern17. Stalin für alles verantwortlich zu machen, half somit auch der Frage nach systemimmanenten Fehlern aus dem Weg zu gehen.18 Eine Sichtweise, die von den meisten Genossen der KPdSU, auch auf Grund der eigenen Verstrickungen in den Terror, bereitwillig mitgetragen wurde. Ganz anders, wie weiter unten noch gezeigt wird, jedoch in den Staaten unter sowjetischer Vorherrschaft. Der von Chruš ëv inszenierte „zweite Tod“ Stalins verschärfte die latente Systemkrise in Ostmitteleuropa und entwickelte eine eigene Krisendynamik.19
Von gleichsam großer Bedeutung war auch die erste Rede Chruš ëvs auf dem XX. Parteitag. Die hier offiziell vorgestellte Prämisse der friedlichen Koexistenz20 beider Systeme, war, genau wie die erwähnte Möglichkeit nationaler Eigenwege zum Sozialismus, ein Zeichen der Entspannung nicht nur für die USA sondern besonders für die ostmitteleuropäischen Volksdemokratien.21 Das hier eine nachträgliche ideologische Legitimierung der Wiederannäherung an Yugoslawien sowie die Konsolidierung des Blocks als Motive Chruš ëv eine Rolle spielten, ist zumindest vorstellbar. Ob sich Chruš ëv über die Auswirkungen, zu denen seine beiden Reden im Ostblock führten allerdings bewusst war, kann vor dem Hintergrund der nachfolgenden Ereignisse ernsthaft in Zweifel gezogen werden.
3. Das Jahr 1956 in Polen
Für Polen leitete der XX. Parteitages der KPdSU wie auch für Ungarn ein schweres Krisenjahr ein. Die Reden von Chruš ëv können jedoch nicht als die Ursachen für die gesellschaftlichen Erschütterungen in Polen gesehen werden. Eher kam den Reden eine Katalysatorfunktion für das Ausbrechen bisher verborgener gesellschaftliche Konflikte zu, die nun offen zu Tage traten.22 Höhepunkte dieser Dauerkrise waren der Arbeiteraufstand in Pozna und die Massenproteste im Herbst.
3.1. Der Aufstand in Pozna und die Massenproteste im Herbst
Nachdem es im Frühjahr zu ersten schweren Streiks in ganz Polen gekommen war, stellte Pozna den Gipfel dar. Am 28. Juni bildeten die Arbeiter der örtlichen Stalinwerke einen Protestzug, dem sich im Laufe des Vormittags mehr und mehr Belegschaften anderer Betriebe anschlossen. Dieser zog in Richtung Stadtzentrum und es wurde die örtliche Woiwodschaftsleitung, das Gericht und das Gefängnis besetzt. Gerüchte, man sei Teil einer nationalen Erhebung, bestärkten die Menge in ihrem Handeln. Ferner wurde den Streikenden von Anfang an auch internationale Aufmerksamkeit zu teil, da zu diesem Zeitpunkt die jährliche Messe in Pozna stattfand. Die angespannte Situation eskalierte, nachdem aus einem örtlichen Gebäude der Staatssicherheit auf die Demonstranten geschossen wurde. Im Verlauf der nächsten zwei Tage wurde der Aufstand durch circa 10.000 polnische Soldaten und 400 Panzer niedergeschlagen. Etwa 90 Menschen verloren bei den bewaffneten Auseinandersetzungen, die bis zum Morgen des 30.
[...]
1 Siehe hierzu die Medienresonanzauswertung auf der vom Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung und der Stiftung zur Aufarbeitung der SED - Diktatur betriebenen Internetseite zum Ungarnaufstand 1956, www.ungarn1956.de, Abruf 28.07.2009, 11.00 Uhr.
2 Vgl. Holzer, Jerzy 2003: Die Erfahrung des Totalitarismus. In: Lawaty, Andreas; Orlowski, Hubert (Hrsg.): Deutsche und Polen. Geschichte - Kultur - Politik, München, S. 481.
3 Somit lässt sich, wenn auch nur abgeschwächt, das Leitthema des Hauptseminars als Kontrastfolie auf Entwicklungen innerhalb des Ostblocks anlegen.
4 Vgl. Dudek, Antoni 2004: Die polnische Geschichtsschreibung und die Erinnerung an die Volksrepublik
Polen. In: Bensussan, Agn s; Dakowska, Dorota; Beaupr Nicolas (Hrsg.): Die Überlieferung der Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizeien in Polen und Deutschland nach 1989, Essen, S 220.
5 Vgl. Hahn, Hans-Henning; Olschowsky Heinrich (Hrsg.): Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa, Berlin.
6 Vgl. Foitzik, Jan 2004: DDR-Forschung und Aufarbeitung der kommunistischen Diktaturen in
Ostmitteleuropa und Russland. In: Eppelmann, Rainer, Faulenbach, Bernd, Mählert, Ulrich (Hrsg.): Bilanz und Perspektiven der DDR Forschung. Paderborn u.a., S. 377.; Jarausch, Konrad H 2004: Plädoyer für eine differenzierte DDR-Geschichte, In: : Bensussan, Agn s; Dakowska, Dorota; Beaupr Nicolas (Hrsg.): Die Überlieferung der Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizeien in Polen und Deutschland nach 1989, Essen, S. 237.
7 Auch der 2000 vom Forschungsverbund SED Staat der FU Berlin herausgegeben Sammelband „Satelliten nach Stalins Tod“ nahm in seinen Beiträgen kaum eine vergleichende Perspektive ein sondern kam eher in einer Aneinanderreihung von Beiträgen mit nationaler Perspektive daher, vlg. Hegedüs, Andras B; Wilke, Manfred (Hrsg.): Satelliten nach Stalins Tod. Der „Neue Kurs“, 17. Juni 1953 in der DDR, Ungarische Revolution 1956. Berlin 2000.
8 Vgl. Wentker, Hermann 2007: Außenpolitik in engen Grenzen. Die DDR im internationalen System 1949- 1989, München, S. 151-160.
9 Behrends, Jan, C 2006: Die erfundene Freundschaft. Propaganda für die Sowjetunion in Polen und in der DDR, Köln, Weimar, Wien.
10Vgl. Hildermeier, Manfred 1998: Geschichte der Sowjetunion 1917- 1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München, S. 757 ff..
11 Die einseitige Ausbau der Schwerindustrie wird verlangsamt, um so den Bereich der Konsumgüterindustrie zu stärken.
12Vgl. Luks, Leonid 2000: Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Von Lenin bis Jelzin, Regensburg, S. 435ff..
13Vgl. Hildermeier: S. 758.
14 Vgl. Ebd.: S. 757.
15 Vgl. Ebd.: S. 764.
16 Vgl. Behrends, S. 329, 333..
17 Meiner Ansicht handelte es sich in der SU auch nach Stalins Tod um ein totalitäres System. Nur das eben nach Stalins Tod die Durchsetzung eines neuen Wertesystems/Ideologie weitgehend abgeschlossen war und es bei bestimmten Merkmalsausprägungen wie permanenten Terror zu Wandlungen kam.
18 Vgl. Schroeder, Klaus 2000: Der SED-Staat. Partei, Staat und Gesellschaft 1949-1990. München, S. 133.
19 Vgl. Behrends: S. 328; Hildermeier: S. 765f.; Luks: S. 447.
20 Malenkow prägte diesen Begriff schon kurz nach Stalins Tod vgl. Hildermeier: S. 437.
21 Friedliche Koexistenz bedeutete jedoch grundsätzlich nicht den Anspruch der Weltrevolution aufzugeben, vielmehr nahm man die These Stalins von der Unvermeidbarkeit eines Weltkrieges zurück. Vgl. hierzu näher, Wentker, 2007: S. 122
22 Vgl. Dudek, Antoni 1999: Der politische Umbruch 1956 in Polen. In: Heinemann, Winfried; Wiggershaus, Norbert (Hrsg.): Das internationale Krisenjahr 1956. Polen, Ungarn, Suez, München, S. 27.
Häufig gestellte Fragen
Warum verlief das Krisenjahr 1956 in Polen und der DDR so unterschiedlich?
Während es in Polen zu Aufständen und einem Machtwechsel kam, gelang es der SED in der DDR, die Lage weitestgehend unter Kontrolle zu halten.
Was war die Bedeutung der Geheimrede Chruschtschows?
Die Rede auf dem XX. Parteitag leitete die Entstalinisierung ein und wirkte als Katalysator für Erschütterungen im gesamten Ostblock.
Welche Rolle spielte der Aufstand in Poznań?
Der Aufstand zeigte die ökonomische Unzufriedenheit der Arbeiter und zwang die polnische Führung zu einer begrenzten Liberalisierung unter Gomulka.
Warum blieb es in der DDR vergleichsweise ruhig?
Gründe waren der „Lernschock“ nach dem 17. Juni 1953, die noch offene Grenze zur BRD und Ulbrichts geschickte Festigung seiner Machtposition.
Was versteht man unter „Friedhofsruhe“ in der DDR?
Der Begriff beschreibt die durch Repression und Ideologisierung erzwungene Stabilität, während Nachbarstaaten wie Polen und Ungarn rebellierten.
- Arbeit zitieren
- Thomas Helmig (Autor:in), 2009, Krise und Friedhofsruhe? Ein Vergleich Polens und der DDR im Krisenjahr des Ostblocks 1956, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140123