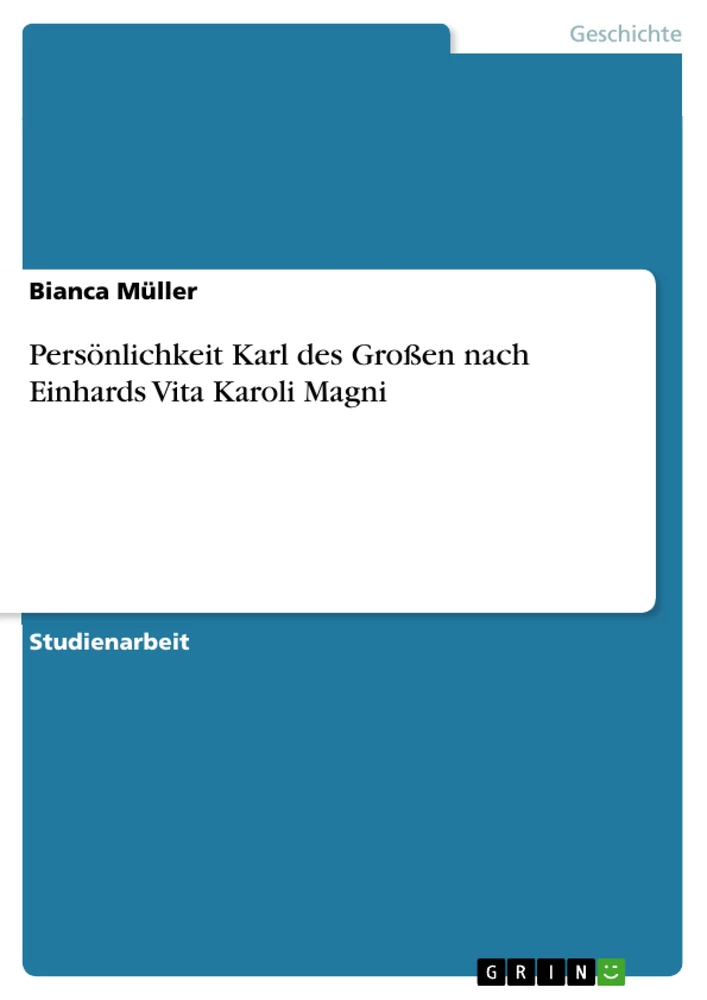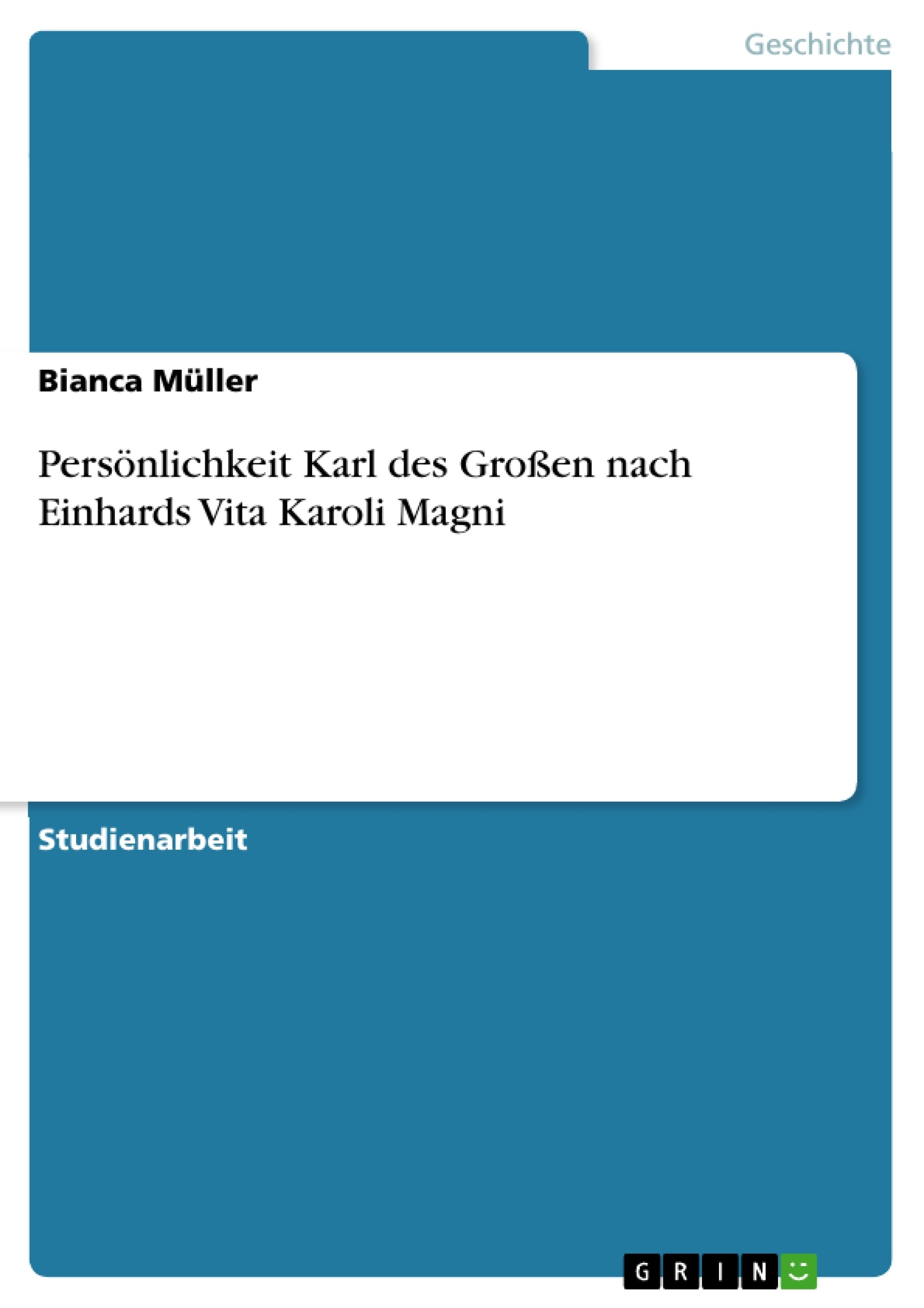Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich neben der Persönlichkeitsbeschreibung Karl des Großen, basierend auf der Vita Karoli Magni, mit einer Darstellung einiger biographischer Informationen zu deren Verfasser Einhard. Diese beleuchtet den Karlsbiographen als höfischen Gelehrten und Geschichtsschreiber, so dass die erarbeiteten Informationen einer historischen Kontextualisierung dienlich sein werden.
Des Weiteren werden Erläuterungen zu der Entstehung, der Form und des Inhalts der Karlsvita vorgenommen. Diese lassen Rückschlüsse auf Einhards Verfassungsabsicht zu, so dass sich diesbezügliche Auslegungen nahtlos anschließen lassen. Ferner wird im Rahmen dieser Arbeit der Stellenwert der Vita nach den erarbeiteten Erkenntnissen diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biographisches zum Verfasser
2.1 Einhards literarisches Werk – die Vita Karoli Magni
2.2 Verfassungsabsicht
3. Einhards Beschreibung des äußeren Erscheinungsbild Karls
4. Einhards Ausführungen zu Karls Persönlichkeit
5. Stellenwert der Vita Karoli Magni
6. Fazit
7. Quellenverzeichnis
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die vorliegende Ausarbeitung beschäftigt sich neben der Persönlichkeitsbeschreibung Karl des Großen, basierend auf der Vita Karoli Magni, mit einer Darstellung einiger biographischer Informationen zu deren Verfasser Einhard. Diese beleuchtet den Karlsbiographen als höfischen Gelehrten und Geschichtsschreiber, so dass die erarbeiteten Informationen einer historischen Kontextualisierung dienlich sein werden.
Des Weiteren werden Erläuterungen zu der Entstehung, der Form und des Inhalts der Karlsvita vorgenommen. Diese lassen Rückschlüsse auf Einhards Verfassungsabsicht zu, so dass sich diesbezügliche Auslegungen nahtlos anschließen lassen. Ferner wird im Rahmen dieser Arbeit der Stellenwert der Vita nach den erarbeiteten Erkenntnissen diskutiert werden.
2. Biographisches zum Verfasser
Der sich selbst ‚Einhart’ schreibende Gelehrte am Hofe Karls des Großen stammte aus einem edlen ostfränkischen Geschlecht im Maingau[1]. Seine Eltern übergaben ihren um 770 geborenen Sohn bereits in frühen Lebensjahren zur Erziehung und Ausbildung dem Kloster Fulda[2]. Von dort nahm er wohl im Jahr 794 auf Anraten des Abts Baugulf seinen Weg an den Hof Karls des Großen, zunächst zur Vervollständigung seiner Bildung an der Hofschule unter Alkuin[3]. Als dieser nach Tour übersiedelte, nahm Einhard bald eine herausragende Stellung an der Aachener Hofschule ein[4].
Neben seiner Gelehrsamkeit machte sich Einhard durch seine große Kunstfertigkeit einen Namen. Sein Beiname ‚Beseleel’, welchen er in höfischen Kreisen trug, weist darauf hin, dass ihm die Oberleitung der Bauten am Hofe Karls übertragen wurde[5].
Des Weiteren genoss Einhard großes Ansehen wegen seiner prudentia et probitas (Klugheit und Rechtschaffenheit), nicht nur bei der höfischen Gesellschaft, sondern auch beim Kaiser selbst[6]. So wurde er zum einen mit wichtigen politischen Missionen, wie im Jahr 806 betraut, als er vom Papst die Zustimmung zu der geplanten divisio regnorum einholen durfte, zum anderen war der Gelehrte maßgeblich daran beteiligt, dass Karl 813 seinen Sohn Ludwig als Mitkaiser einsetzte[7]. Außerdem ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass Einhard der Verfasser des Testaments Karls war, welches einzig in seiner Karlsbiographie (c. 33) überliefert ist[8].
Nach Karls Ableben war Einhard einer der wenigen alten Getreuen, die am Kaiserhof, derzeit unter der Regentschaft Ludwigs des Frommen, verbleiben durften[9]. Um sich besser dem Dienst an den Heiligen widmen zu können, bat Einhard Ludwig im Jahr 830, ihn von seinen weltlichen Pflichten zu befreien. So zog er sich nach Seligenstadt zurück, wo er zwei Jahre zuvor ein Kloster gegründet hatte und 840 verstarb[10].
Einhards schriftliche Hinterlassenschaft beinhaltet neben zahlreichen Briefen, die eine reiche Quelle für die politischen Ereignisse der Regierungszeit Ludwigs I. darstellen, mehrere religiöse Schriften, wie das Libellus de adoranda cruce und die Transalation et miracula SS. Marcellini et Petri, sowie sein berühmtestes Werk, die Vita Karoli Magni, welche Gegenstand der folgenden Ausführungen sein wird[11].
2.1 Einhards literarisches Werk – die Vita Karoli Magni
Die Beschreibung des Lebens Karls des Großen seitens Einhard wurde vermutlich in den Jahren zwischen 815 und 830 verfasst, eine genauere Datierung ist durch historische Tatsachen nicht belegbar[12]. Diese “nach ihrer literarischen Form vollendetste und nach ihrem Inhalt die anziehendste der mittelalterlichen Kaiserbiographien”[13] ist allein schon wegen der Tatsache, dass sie die einzige Biographie des Kaisers, die von einem Zeitgenossen, der Karl persönlich kannte, verfasst wurde, von großer Bedeutung.
Formal wie sprachlich orientiert sich Einhard an der Tradition des klassischen Lateins, wie er selbst im Prologus zur Vita Karoli Magni schreibt. Diese Orientierung erklärt den suetonischen Stil der nach Kategorien abhandelnden Kaiserbiographie, welche ein Novum für die mittelalterliche Aufzeichnung historischer Gegebenheiten jenseits der Chronologie der Jahrbücher darstellte[14]. Wie sich aus dem Prologus der Karlsvita ebenfalls schlussfolgern lässt, war sich Einhard seiner Renaissance der spätrömischen Literaturgattung wohl bewusst und verteidigt sie gegenüber den Lesern, „die an allem Modernen etwas auszusetzen haben“[15]. Weiterhin ist dem Prologus zu entnehmen, dass sich Einhard nicht sicher war, ob überhaupt jemand das Leben des genannten Kaisers verschriftlichen würde. Des Weiteren tritt seine Überzeugung zu Tage, dass außer ihm niemand die Ereignisse genauer schildern könne[16].
Inhaltlich wirkt die Erzählung gedrängt und knapp, was wohl dem Umstand geschuldet ist, dass Einhard bewusst auf Anekdoten verzichtete[17]. Zweifelsohne lässt sich die Ausrichtung erkennen, dass das Leben und Werk des portraitierten Herrschers, als ein rundes Ganzes darzustellen versucht wurde.
Einhards literarisches Hauptwerk lässt sich am ehesten in drei Teile aufgliedern. Dem ersten entsprechen die Kapitel 5 bis 17, welche die innen- und außenpolitischen Aktivitäten zum Inhalt haben. Der zweite Teil (cc. 18 bis 25) ist Karls Lebensführung und seiner Affinität zu den Wissenschaften gewidmet, welche weiter unten ausführlich diskutiert werden. Karls Reichsverwaltung und Lebensende, samt Testament, bilden die Kapitel 26 bis 33. Obwohl die Vita in den Teilen, die der Politik Karls gewidmet sind, weder einen Anspruch auf historische Korrektheit, noch auf Vollständigkeit gemäß den Forderungen moderner wissenschaftlicher Forschung erfüllen kann, hat sie wie bereits angedeutet einen unschätzbaren Wert für die Neuzeit[18].
Die Vita erfreute sich bereits unter Einhards Zeitgenossen reger Popularität, erkennbar an der Zahl von 80 belegbaren Handschriften. Zudem nahm sie großen Einfluss auf die mittelalterliche Geschichtsschreibung und Heldensage[19], welche im Rahmen dieser Arbeit keine hinreichende Erörterung erfahren kann.
2.2 Verfassungsabsicht
Die Beweggründe des Verfassers der Vita Karoli Magni sind eindeutig seinem Prologus zu entnehmen. Einhards Beweggründe reichen von tief empfundenem persönlichen Dank, insbesondere für die geistige Pflege in jungen Jahren und der lebenslangen Freundschaft, hin zu einem daraus erwachsenem Verpflichtungsgefühl[20]. Des Weiteren ist Einhards große Bewunderung für seinen „domini et nutritoris“[21] konsequent evident. Daher darf es nicht verwundern, dass er seinen „Helden Karl allenthalben heraushebt, ihn preist und rühmt“[22]. Wie bereits festgestellt wurde, schweigt Einhard in Bezug auf gewisse historische Gegebenheiten und schönt andere, wodurch sich historische Ungenauigkeiten ergeben. Dieser Misstand beschränkt sich jedoch gemäß der modernen Forschungsliteratur auf Karls politisches Handeln und weniger auf seine Persönlichkeit im engeren Sinne[23]. Ausgehend von dieser Annahme kann daher an dieser Stelle auf weitere solcher Ausführungen verzichtet werden, da die Authentizität der Persönlichkeitsbeschreibung außer Frage steht, wie folgende Erörterungen belegen werden.
[...]
[1] Fleckenstein, Einhard, 1737.
[2] Ebd.
[3] Kerner, Karl der Große, 76.
[4] Ebd.
[5] Ebd.
[6] Ebd.
[7] Fleckenstein, Einhard, 1737.
[8] Kerner, Karl der Große, 77.
[9] Fleckenstein, Einhard, 1737.
[10] Barth, Karl der Große, 55.
[11] Ebd.
[12] Wevers, Einhards Vita Karoli Magni, 3.
[13] Ebd.
[14] Wevers, Einhards Vita Karoli Magni, 5.
[15] Einhard, Vita, Prologus.
[16] Ebd.
[17] Ebd.
[18] Vgl. Kerner, Karl der Große, 78-79; Wevers, Einhards Vita Karoli Magni, 3; Pyritz, Das Karlsbild Einharts, 167 und insbesondere Wolf, Einhards hofhistoriographischen Euphemismus.
[19] Wevers, Einhards Vita Karoli Magni, 4.
[20] Einhard, Vita, Prologus.
[21] Ebd.
[22] Wolf, Einhards hofhistoriographischen Euphemismus, 321.
[23] Vgl. Kerner, Karl der Große, 78-79; Wevers, Einhards Vita Karoli Magni, 3; Pyritz, Das Karlsbild Einharts, 167 und insbesondere Wolf, Einhards hofhistoriographischen Euphemismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Einhard?
Einhard war ein Gelehrter, Kunstsachverständiger und enger Vertrauter am Hofe Karls des Großen. Er verfasste mit der "Vita Karoli Magni" die bedeutendste zeitgenössische Biografie des Kaisers.
Was ist das Besondere an der "Vita Karoli Magni"?
Sie ist die einzige Biografie Karls des Großen, die von einem Zeitgenossen geschrieben wurde, der ihn persönlich kannte. Sie orientiert sich stilistisch an dem antiken Vorbild Sueton.
Wie beschreibt Einhard Karl den Großen?
Einhard liefert detaillierte Beschreibungen des äußeren Erscheinungsbildes, der Essgewohnheiten, der Bildung und des Charakters Karls, wobei er ihn als idealen christlichen Herrscher darstellt.
Welche Absicht verfolgte Einhard mit der Biografie?
Seine Motive waren persönlicher Dank und die Bewunderung für seinen Dienstherrn sowie der Wunsch, Karls Taten für die Nachwelt festzuhalten, damit diese nicht in Vergessenheit geraten.
In welchem Zeitraum entstand die Karlsvita?
Das Werk wurde vermutlich zwischen 815 und 830 verfasst, also einige Jahre nach dem Tod Karls des Großen im Jahr 814.
- Arbeit zitieren
- Bianca Müller (Autor:in), 2009, Persönlichkeit Karl des Großen nach Einhards Vita Karoli Magni, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140225