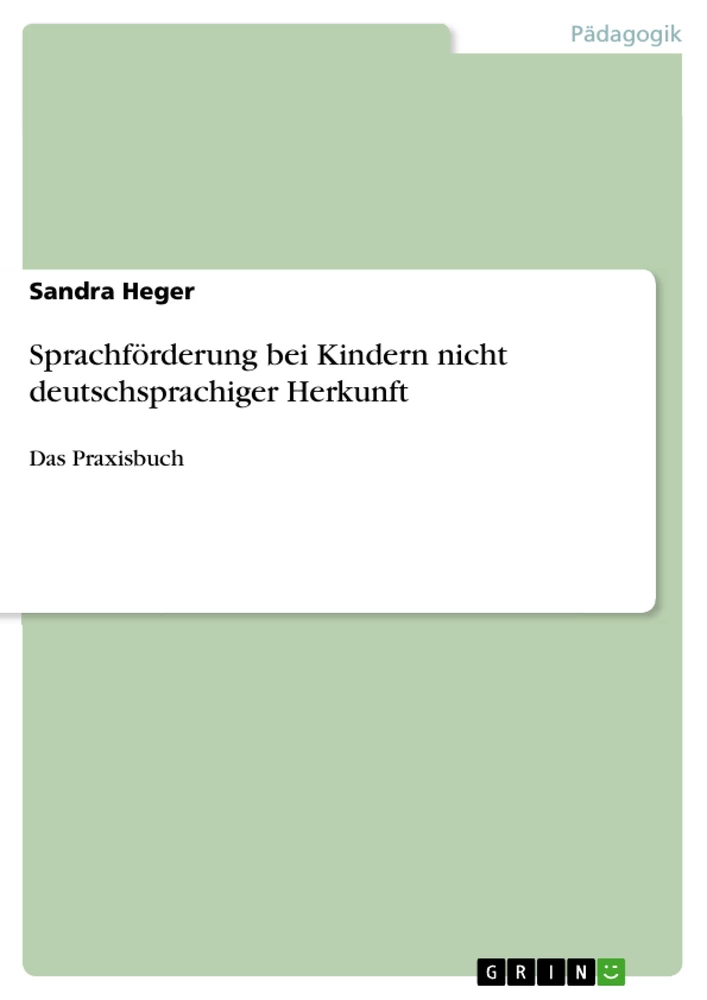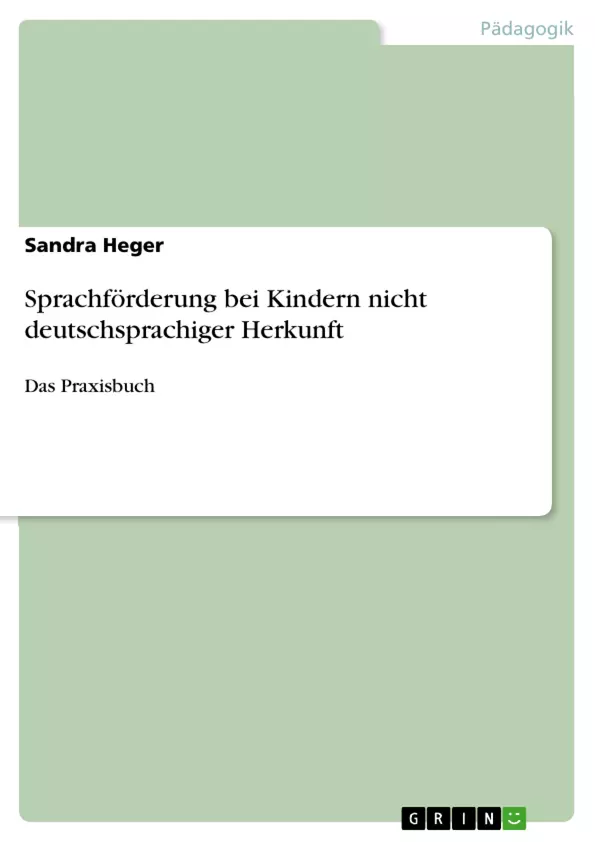„Sprachförderung bei Kindern nicht- deutschsprachiger Herkunft – Das Praxisbuch“ gibt nicht nur einen Überblick über die theoretischen Grundlagen zum Thema Sprachförderung, sondern es werden neben der Thematisierung der Grundlagen zur kindlichen Sprachentwicklung, dem Erst- und Zweitspracherwerb, der Definition der Sprachförderung und ihre Bedeutsamkeit, der Rolle der Lehrperson und den methodischen Elementen der Sprachförderungsarbeit, vor allem praxisorientierte Konzeptionsvorschläge und Anregungen gegeben, wie eine solche Förderung von der Lehrperson gestaltet werden kann. Es werden beispielhafte Wortschatzfelder, Spiele, Lieder und Arbeitsblätter zu den einzelnen Themen der sprachlichen Förderung aufgeführt, die zur Hilfe herangezogen werden können, um eine auf die Kinder abgestimmte, individuelle Konzeption zur thematischen und inhaltlichen Gestaltung einer Sprachförderung zu erstellen.
Im Mittelpunkt stehen hierbei die Themen und Inhalte, die in einer Sprachförderung für Kinder nicht- deutschsprachiger Herkunft vorkommen können. Die thematische und inhaltliche Auswahl wurde so getroffen, dass die kindliche Lebenswelt das Fundament der Themenwahl bildet.
Zudem werden drei Unterrichtsversuche vorgestellt, die in einer vorschulischen Sprachförderung zum Einsatz gekommen sind. Dabei werden die Vorüberlegungen zum jeweiligen Thema vorgestellt, wie auch der Stundenverlauf und die Reflexion der Unterrichtsstunde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen zur Entwicklung von Sprache bei Kindern
- 2.1. Sprachentwicklung - Grundlegende Voraussetzungen für den Spracherwerb
- 2.2. Prozesse des Lernens jüngerer Kinder und ihre Begriffsbildung
- 3. Der Erst- und Zweitspracherwerb
- 3.1. Definition der Erstsprache und der gleichzeitige Erwerb zweier Sprachen
- 3.2. Die Erstsprache ist das Grundgerüst für den Erwerb der Zweitsprache
- 3.3. Der Zweitspracherwerb
- 3.4. Die Sprachförderung und ihre Bedeutsamkeit
- 4. Definition „vorschulische Sprachförderung“
- 4.2. Bedeutung der Sprachförderung für die Integration
- 5. Die Rolle der Lehrperson
- 5.1. Beobachtung des Kindes
- 5.2. Lehrperson als Sprachvorbild
- 5.3. Die Rolle der zweisprachigen Lehrperson
- 6. Methodische Elemente der Sprachförderungsarbeit
- 6.1. Methodische Grundgedanken
- 6.2. Ausgewählte methodische Elemente zur vorschulischen Sprachförderungsarbeit
- 7. Themen und Inhalte in der Sprachförderung
- 7.1. Ich und mein Körper
- 7.2. Meine Gruppe/ Klasse
- 7.3. Gefühle und Gedanken
- 7.4. Kleidung
- 7.5. Familie
- 7.6. Nahrung
- 7.7. Tiere
- 7.8. Farben und Formen
- 7.9. Räumlichkeiten
- 7.10. Schule
- 8. Unterrichtsversuche zur Sprachförderungsarbeit
- 8.1. Informationen zu der Sprachförderungsgruppe
- 8.2. Planung und Reflexion der Unterrichtsstunde zum Thema „Die Gruppe“
- 8.2.1. Vorüberlegungen zum Thema
- 8.2.2. Stundenverlauf
- 8.2.3. Reflexion der Unterrichtsstunde
- 8.3. Planung und Reflexion der Unterrichtsstunde zum Thema „Die Körperteile“
- 8.3.1. Vorüberlegungen zum Thema
- 8.3.2. Stundenverlauf
- 8.3.3. Reflexion der Unterrichtsstunde
- 8.4. Planung und Reflexion der Unterrichtsstunde zum Thema „Das Badezimmer“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Praxisbuch zielt darauf ab, Lehrkräften praktische Hilfestellungen zur Sprachförderung bei Kindern nicht-deutschsprachiger Herkunft zu geben. Es verbindet theoretische Grundlagen der Sprachentwicklung mit konkreten methodischen Ansätzen und Unterrichtsbeispielen.
- Theorie des Erst- und Zweitspracherwerbs
- Methoden der vorschulischen Sprachförderung
- Rollen der Lehrperson in der Sprachförderung
- Bedeutung der Sprachförderung für Integration
- Praxisbeispiele aus dem Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in das Thema Sprachförderung bei Kindern nicht-deutschsprachiger Herkunft und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung des Praxisbuchs. Es unterstreicht die Bedeutung frühkindlicher Sprachförderung für den schulischen Erfolg und die gesellschaftliche Teilhabe.
2. Theoretische Grundlagen zur Entwicklung von Sprache bei Kindern: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis der Sprachentwicklung bei Kindern dar. Es beleuchtet grundlegende Voraussetzungen für den Spracherwerb und die Prozesse des Lernens bei jüngeren Kindern, inklusive ihrer Begriffsbildung. Es bietet ein umfassendes Verständnis der kognitiven und sozialen Aspekte, die den Spracherwerb beeinflussen.
3. Der Erst- und Zweitspracherwerb: Hier werden Erst- und Zweitspracherwerb definiert und die Interdependenz beider Prozesse erläutert. Das Kapitel betont die Rolle der Erstsprache als Basis für den Zweitspracherwerb und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen des gleichzeitigen Erwerbs zweier Sprachen. Die Bedeutung der Sprachförderung im Kontext des Zweitspracherwerbs wird ausführlich diskutiert.
4. Definition „vorschulische Sprachförderung“ und Bedeutung der Sprachförderung für die Integration: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition des Begriffs „vorschulische Sprachförderung“ und argumentiert über deren entscheidende Bedeutung für die erfolgreiche Integration von Kindern nicht-deutschsprachiger Herkunft in den Bildungsprozess. Es analysiert die möglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Sprachentwicklung und Integration.
5. Die Rolle der Lehrperson: Das Kapitel beschreibt die vielfältigen Rollen der Lehrperson in der Sprachförderung. Es betont die Bedeutung der Beobachtung des Kindes, die Vorbildfunktion der Lehrkraft im Sprachgebrauch und insbesondere die besondere Rolle von zweisprachigen Lehrkräften. Die verschiedenen Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion werden analysiert und Strategien zur effektiven Unterstützung der Kinder aufgezeigt.
6. Methodische Elemente der Sprachförderungsarbeit: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene methodische Ansätze für die Sprachförderung im Vorschulalter. Es beschreibt methodische Grundgedanken und stellt ausgewählte methodische Elemente vor, die sich in der Praxis bewährt haben. Die Kapitel verbindet theoretische Überlegungen mit konkreten, umsetzbaren Strategien für den Unterricht.
7. Themen und Inhalte in der Sprachförderung: Hier werden konkrete Themen und Inhalte für die Sprachförderungsarbeit vorgestellt. Die einzelnen Themen – von "Ich und mein Körper" bis "Schule" – bieten vielfältige Möglichkeiten, die Sprachentwicklung der Kinder gezielt zu fördern. Jedes Thema bietet Anknüpfungspunkte für den Sprachunterricht und stellt ein wichtiges Element einer ganzheitlichen Sprachförderung dar.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Kinder nicht-deutschsprachiger Herkunft, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, vorschulische Sprachförderung, Integration, Lehrperson, Sprachvorbild, methodische Elemente, Unterrichtspraxis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Praxisbuch: Sprachförderung bei Kindern nicht-deutschsprachiger Herkunft
Was ist der Inhalt dieses Praxisbuchs?
Dieses Praxisbuch bietet Lehrkräften praktische Hilfestellungen zur Sprachförderung bei Kindern nicht-deutschsprachiger Herkunft. Es verbindet theoretische Grundlagen der Sprachentwicklung mit konkreten methodischen Ansätzen und Unterrichtsbeispielen. Der Inhalt umfasst Themen wie Erst- und Zweitspracherwerb, Methoden der vorschulischen Sprachförderung, die Rolle der Lehrperson, die Bedeutung der Sprachförderung für die Integration und Praxisbeispiele aus dem Unterricht. Ein Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen, Zielsetzungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Das Buch behandelt die theoretischen Grundlagen der Sprachentwicklung bei Kindern, einschließlich grundlegender Voraussetzungen für den Spracherwerb und die Prozesse des Lernens bei jüngeren Kindern sowie deren Begriffsbildung. Es beleuchtet die kognitiven und sozialen Aspekte, die den Spracherwerb beeinflussen, und erklärt ausführlich den Erst- und Zweitspracherwerb, die Interdependenz beider Prozesse und die Rolle der Erstsprache als Basis für den Zweitspracherwerb.
Welche methodischen Ansätze zur Sprachförderung werden vorgestellt?
Das Buch präsentiert verschiedene methodische Ansätze für die vorschulische Sprachförderung. Es beschreibt methodische Grundgedanken und stellt ausgewählte, praxiserprobte Elemente vor. Die Kapitel verbinden theoretische Überlegungen mit konkreten, umsetzbaren Strategien für den Unterricht. Konkrete Themen und Inhalte für die Sprachförderungsarbeit werden ebenfalls vorgestellt, von "Ich und mein Körper" bis "Schule".
Welche Rolle spielt die Lehrperson in der Sprachförderung?
Das Buch betont die vielfältigen Rollen der Lehrperson in der Sprachförderung. Es hebt die Bedeutung der Beobachtung des Kindes, die Vorbildfunktion der Lehrkraft im Sprachgebrauch und insbesondere die besondere Rolle von zweisprachigen Lehrkräften hervor. Die verschiedenen Aspekte der Lehrer-Schüler-Interaktion werden analysiert und Strategien zur effektiven Unterstützung der Kinder aufgezeigt.
Welche Bedeutung hat die Sprachförderung für die Integration?
Das Buch argumentiert über die entscheidende Bedeutung der vorschulischen Sprachförderung für die erfolgreiche Integration von Kindern nicht-deutschsprachiger Herkunft in den Bildungsprozess. Es analysiert mögliche Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Sprachentwicklung und Integration.
Welche konkreten Beispiele aus dem Unterricht werden gegeben?
Das Buch enthält Praxisbeispiele aus dem Unterricht, darunter detaillierte Planungen und Reflexionen von Unterrichtsstunden zu Themen wie „Die Gruppe“, „Die Körperteile“ und „Das Badezimmer“. Diese Beispiele illustrieren die Anwendung der vorgestellten Methoden und bieten konkrete Anleitungen für die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Buches beschreiben, sind: Sprachförderung, Kinder nicht-deutschsprachiger Herkunft, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, vorschulische Sprachförderung, Integration, Lehrperson, Sprachvorbild, methodische Elemente, Unterrichtspraxis.
- Quote paper
- Sandra Heger (Author), 2009, Sprachförderung bei Kindern nicht deutschsprachiger Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140249