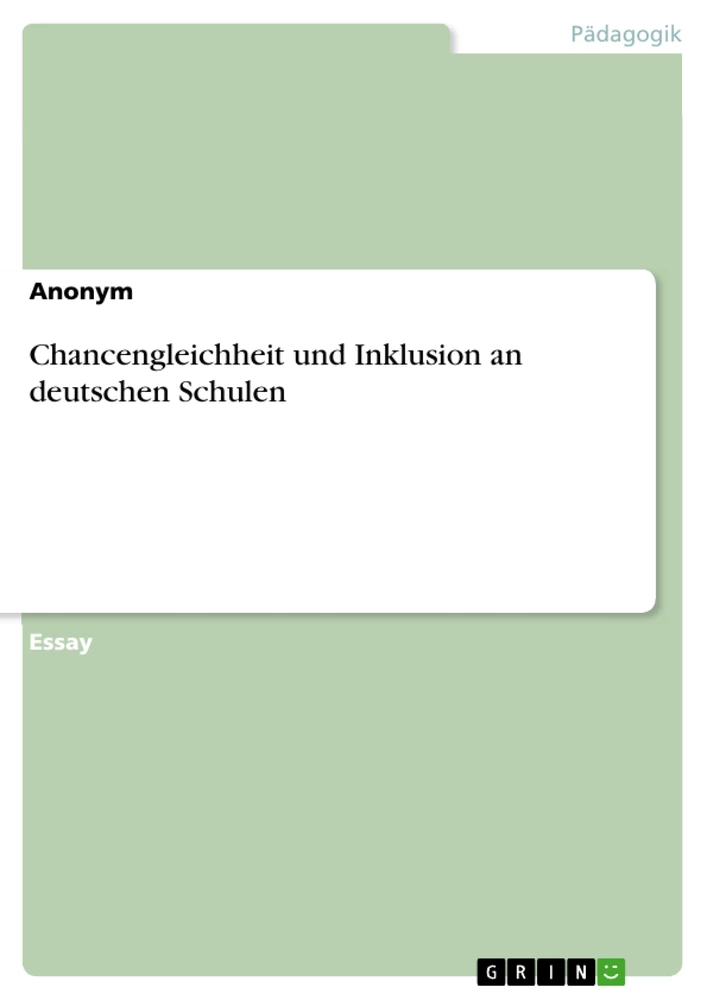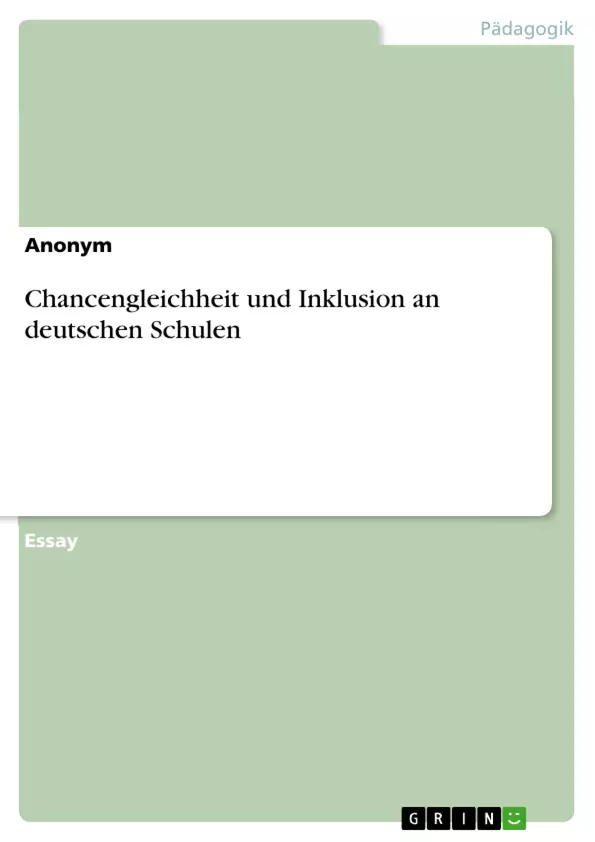Dieses Essay beschäftigt sich mit der Chancengleichheit an deutschen, mit Bezug auf Kindern mit migrantischem Hintergrund. Spätestens seit PISA 2000, oder aber seit der UN-BRK 2009, sind wir uns in Deutschland einig, dass Bildung kein Luxusgut derer sein darf, die das Privileg haben, in einer sozioökonomisch gut situierten Familie aufzuwachsen. Bildung darf auch nicht denjenigen verwehrt werden, die aufgrund einer Behinderung / einer anderen Muttersprache / anderer Hintergründe länger zum Verstehen benötigen oder schlichtweg weniger verstehen können. Kein Kind soll hierzulande aufgrund eigener Ressourcen zu Beginn des Schuleintritts benachteiligt werden. Keinem Kind soll das Recht auf Bildung verwehrt bleiben. Bildung ermöglicht Teilhabe und Teilhabe ist das Ziel im Sinne der Normalisierung. Teilhabe ist auch die Idee hinter der gesamtgesellschaftlichen Inklusion, ebenso wie die Chancengleichheit, die allen Schulkindern ermöglichen soll, ihr Potenzial vollends zu entfalten. Doch selbst, wenn auch schon der Weg das Ziel ist, gestaltet dieser sich in Deutschland als sehr steinig. Es wird auf das deutsche Schulsystem eingegangen, wie der Chancengleichheit entgegengewirkt wird mit Fokus auf Benotung und Lösungsansätze für mehr Inklusion präsentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Chancengleichheit an deutschen Schulen: Zwischen Utopie und Pflicht
- Wie der Chancengleichheit entgegengewirkt wird
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Chancengleichheit im deutschen Schulsystem und beleuchtet die Diskrepanz zwischen der angestrebten Bildungsgerechtigkeit und der Realität. Dabei werden die Herausforderungen und die systemimmanenten Hürden aufgezeigt, die einer tatsächlichen Chancengleichheit im Weg stehen.
- Die Problematik der frühen Leistungssortierung im deutschen Bildungssystem
- Der Einfluss der sozialen Herkunft und die Reproduktion von sozialer Ungleichheit durch Schule
- Die Rolle von Beurteilungsfehlern und Stereotypisierung in der Bewertung von Schülerleistungen
- Die Bedeutung der Schuleingangsvoraussetzungen und die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Förderung
- Das Konzept der Inklusion und die Herausforderungen ihrer Umsetzung im deutschen Schulsystem
Zusammenfassung der Kapitel
Chancengleichheit an deutschen Schulen: Zwischen Utopie und Pflicht
Der Text beginnt mit einer Schilderung der Problematik der Chancengleichheit anhand des fiktiven Beispiels von Samir, einem Schüler mit Migrationshintergrund, der aufgrund seiner sozialen Situation und der mangelnden Unterstützung durch das Schulsystem benachteiligt wird. Es wird deutlich, dass das deutsche Schulsystem, trotz des Anspruchs auf Bildungsgerechtigkeit, die soziale Ungleichheit reproduziert. Die Geschichte von Samir verdeutlicht die Auswirkungen von Leistungshomogenität und frühen Selektionsmechanismen auf das Leben von Schülern aus bildungsfernen Schichten.
Im weiteren Verlauf des Kapitels wird die historische Entwicklung des deutschen Schulsystems beleuchtet und die Bedeutung des Prinzips der Leistungshomogenität im Kontext der frühen Trennung von Schülern in verschiedene Schulformen diskutiert. Es wird argumentiert, dass die meritokratische Grundhaltung des deutschen Bildungssystems, die Leistung und Anstrengung als entscheidende Faktoren für den schulischen Erfolg betrachtet, in der Praxis zu einer Ungleichheit der Chancen führt, da Kinder mit unterschiedlichen Startbedingungen nicht die gleichen Möglichkeiten haben.
Das Kapitel endet mit einer Kritik an der Praxis der frühzeitigen Selektion von Kindern, die in der Folge zu einer Benachteiligung von Schülern mit besonderem Förderbedarf führt und ihnen die Teilnahme am inklusiven Schulsystem verwehrt.
Wie der Chancengleichheit entgegengewirkt wird
Dieses Kapitel analysiert die systemischen Hürden, die einer tatsächlichen Chancengleichheit im Wege stehen. Es wird argumentiert, dass die Betonung von Leistungshomogenität und die Verwendung von Noten als Bewertungsinstrument die individuelle Entwicklung und Förderung von Schülern behindern.
Darüber hinaus wird die Problematik von Beurteilungsfehlern und Stereotypisierung durch Lehrkräfte thematisiert, die zu einer Selbstverwirklichungsprophezeiung führen können. Die Autorin verdeutlicht, dass die Bewertung von Schülerleistungen nicht nur von ihrer objektiven Leistung, sondern auch von subjektiven Faktoren wie der sozialen Herkunft, dem Verhalten in der Schule und dem erwarteten Leistungsniveau beeinflusst wird.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Leistungshomogenität, frühe Selektion, soziale Ungleichheit, Inklusion, Beurteilungsfehler, Stereotypisierung, Schuleingangsvoraussetzungen, meritokratisches Prinzip, Bildungsferne, Migrationshintergrund
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter Chancengleichheit im deutschen Schulsystem verstanden?
Chancengleichheit bedeutet, dass der Bildungserfolg eines Kindes unabhängig von seiner sozialen Herkunft, seinem Migrationshintergrund oder körperlichen Beeinträchtigungen sein sollte.
Wie wirkt die frühe Leistungssortierung in Deutschland?
Durch die frühe Trennung nach der Grundschule werden Kinder oft aufgrund ihres sozioökonomischen Status statt ihres tatsächlichen Potenzials selektiert, was soziale Ungleichheit reproduziert.
Welche Rolle spielen Beurteilungsfehler von Lehrkräften?
Stereotypisierungen können dazu führen, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten oder mit Migrationshintergrund bei gleicher Leistung schlechter bewertet werden (Selbsterfüllende Prophezeiung).
Was ist das Ziel der Inklusion an Schulen?
Inklusion zielt darauf ab, allen Kindern die Teilhabe am Regelschulsystem zu ermöglichen und individuelle Förderung als Standard zu etablieren, statt Kinder in Sondersysteme auszugliedern.
Warum ist das meritokratische Prinzip im Bildungswesen problematisch?
Das Prinzip "Leistung gegen Erfolg" vernachlässigt, dass Kinder mit sehr unterschiedlichen Startbedingungen (Ressourcen im Elternhaus) in die Schule kommen.
Was sind Lösungsansätze für mehr Bildungsgerechtigkeit?
Diskutiert werden eine bedarfsgerechtere Förderung, die Abkehr von rein notenbasierter Selektion und eine längere gemeinsame Schulzeit zur Verringerung der sozialen Schichtung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Chancengleichheit und Inklusion an deutschen Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1403466