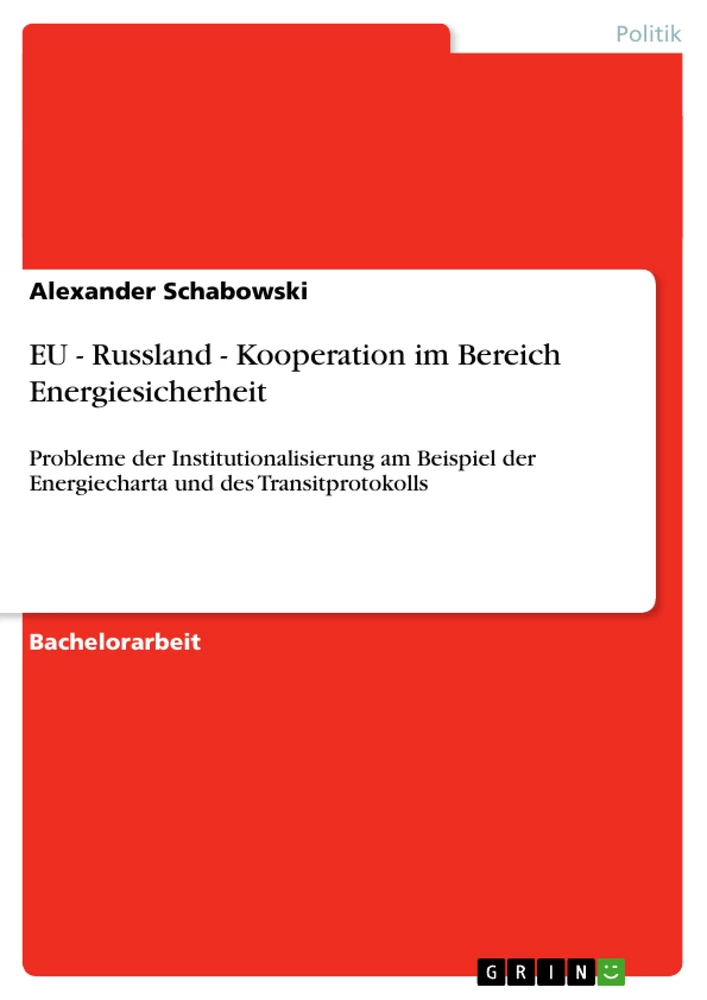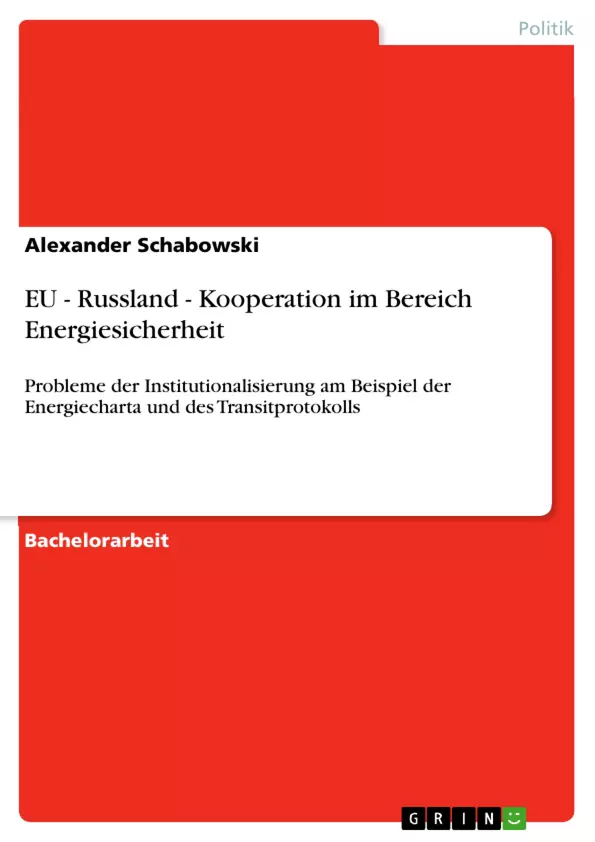Im Bereich der Energiesicherheit bestehen sowohl für die Russische Föderation (RF) als auch für die Europäische Union (EU) erhebliche Anreize für eine institutionalisierte Kooperation.
Ein möglicher Weg ist der im Jahre 1994 unterzeichnete und von Russland bisher nicht ratifizierte Energiechartavertrag (ECT).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ursachen für den scheinbaren Widerspruch zwischen dem zu beobachtenden Stillstand in den nunmehr fast 15 Jahren andauernden Verhandlungen und einer gleichzeitig wachsenden proklamierten Priorisierung energiepolitischer Kooperationsabsichten auf beiden Seiten. Die zentralen Thesen der Arbeit lauten:
Zwischen der EU und Russland besteht im Energiesektor aufgrund divergierender Präferenzordnungen eine Dominanz unvereinbarer Präferenzen.
Im weiteren Verhandlungsprozess besteht eine momentan ungleiche Machtverteilung aufgrund ungleicher Kooperationszwänge.
Die Kumulation kooperationshinderlicher Faktoren reduziert deutlich die Wahrscheinlichkeit einer institutionellen Zusammenarbeit.
Als zugrunde liegender Analyserahmen der Arbeit dient das Modell des liberalen Intergouvernementalismus von Andrew Moravcsik. Das Ausmaß und die Intensität der Kooperation werden bei intergouvernemental-theoretischer Betrachtung maßgeblich durch die Präferenzen der nationalen Regierungen vordefiniert. Der weitere Verlauf des Verhandlungsprozesses wird durch die jeweiligen Gestaltungsspielräume der utilitaristisch agierenden Staaten in den jeweiligen Verhandlungskonstellationen beeinflusst. Andrew Moravcsik erweitert dieses Modell um eine substaatliche Dimension und ermöglicht es, die Ursache etwaiger Hindernisse für eine institutionalisierte Kooperation auf dieser Ebene zu verorten. Die nationale Präferenzbildung entsteht unterhalb der eigentlichen Akteursebene als Resultat der jeweiligen innerstaatlichen Machtverhältnisse und einem Wettbewerb unterschiedlicher Akteure, die versuchen, auf die Regierungsentscheidung Einfluss zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Liberale Intergouvernementalismus
- Die Energiecharta und das Transitprotokoll
- Entstehung
- Wesentliche Inhalte ECT
- Wesentliche Inhalte und Streitpunkte bei den Verhandlungen zum ECTP
- Analyse der Ebene der innerstaatlichen Präferenzbildung
- Akteure und Konfliktlinien in der RF
- Akteure
- Konfliktlinien innerhalb der RF
- Akteure und Konfliktlinien in der EU
- Akteure
- Konfliktlinien innerhalb der EU
- Zwischenfazit zur Analyse der innerstaatlichen Präferenzbildung
- Akteure und Konfliktlinien in der RF
- Analyse der Ebene der internationalen Verhandlungen
- Präferenzen und Verhandlungsposition der RF
- Präferenzen der RF
- Verhandlungsposition der RF
- Präferenzen und Verhandlungsposition der EU
- Präferenzen der EU
- Verhandlungsposition der EU
- Zwischenfazit zur Analyse der Ebene der internationalen Verhandlungen
- Präferenzen und Verhandlungsposition der RF
- Bewertung des Fallbeispiels
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Kooperation zwischen der EU und Russland im Bereich der Energiesicherheit. Im Fokus steht die Institutionalisierung dieser Kooperation am Beispiel der Energiecharta und des Transitprotokolls. Die Arbeit analysiert die Präferenzbildung und Verhandlungsprozesse auf innerstaatlicher und internationaler Ebene, um die Herausforderungen und Konfliktpotenziale der Institutionalisierung aufzuzeigen.
- Liberaler Intergouvernementalismus als theoretisches Konzept
- Analyse der Energiecharta und des Transitprotokolls
- Präferenzbildung und Verhandlungsposition der EU und Russlands
- Akteure und Konfliktlinien auf innerstaatlicher Ebene
- Herausforderungen und Konfliktpotenziale der Institutionalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Energiesicherheit und die EU-Russland-Beziehungen ein, bevor sie die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit erläutert. Das zweite Kapitel stellt das theoretische Konzept des liberalen Intergouvernementalismus vor, das als analytisches Instrument für die Untersuchung der EU-Russland-Kooperation im Energiesektor dient. Das dritte Kapitel behandelt die Energiecharta und das Transitprotokoll, wobei die Entstehung, die wesentlichen Inhalte und die Streitpunkte bei den Verhandlungen beleuchtet werden. Das vierte Kapitel analysiert die Präferenzbildung und die Akteure auf innerstaatlicher Ebene in der EU und in Russland. Dabei werden die jeweiligen Konfliktlinien innerhalb der beiden Akteure herausgestellt. Das fünfte Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der internationalen Verhandlungsebene. Die Präferenzen und Verhandlungspositionen der EU und Russlands werden untersucht, um die Herausforderungen bei der Institutionalisierung der Kooperation zu verdeutlichen. Das sechste Kapitel bewertet das Fallbeispiel der Energiecharta und des Transitprotokolls, bevor im siebten Kapitel ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der EU-Russland-Kooperation im Energiesektor gegeben wird.
Schlüsselwörter
Energiesicherheit, EU-Russland-Beziehungen, Energiecharta, Transitprotokoll, liberaler Intergouvernementalismus, Präferenzbildung, Verhandlungsprozess, Institutionalisierung, Akteure, Konfliktlinien, Herausforderungen, Konfliktpotenziale.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Energiechartavertrag (ECT)?
Der ECT ist ein 1994 unterzeichnetes internationales Abkommen zur Zusammenarbeit im Energiesektor. Russland hat den Vertrag zwar unterzeichnet, aber bisher nicht ratifiziert, was zu Spannungen mit der EU führt.
Was besagt das Modell des liberalen Intergouvernementalismus?
Nach Andrew Moravcsik werden internationale Kooperationen maßgeblich durch die nationalen Präferenzen der Regierungen bestimmt, die wiederum durch innerstaatliche Machtverhältnisse und Interessengruppen geformt werden.
Warum stocken die Energieverhandlungen zwischen der EU und Russland?
Hauptgründe sind unvereinbare Präferenzen und eine ungleiche Machtverteilung. Während die EU auf Marktöffnung und Rechtssicherheit setzt, priorisiert Russland staatliche Kontrolle und strategische Interessen.
Welche Akteure beeinflussen die russische Energiepolitik?
Innerhalb Russlands gibt es verschiedene Konfliktlinien zwischen staatlichen Konzernen (wie Gazprom), Ministerien und der politischen Führung, die die Verhandlungsposition prägen.
Was ist das Transitprotokoll?
Das Transitprotokoll soll den Transport von Energie über Drittstaaten regeln. Es ist einer der zentralen Streitpunkte in den Verhandlungen zwischen der EU und Russland.
Wie sieht die Zukunft der EU-Russland-Energiekooperation aus?
Die Arbeit bewertet die Wahrscheinlichkeit einer tieferen institutionellen Zusammenarbeit aufgrund der kumulierten kooperationshinderlichen Faktoren als momentan eher gering.
- Quote paper
- Alexander Schabowski (Author), 2009, EU - Russland - Kooperation im Bereich Energiesicherheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140353