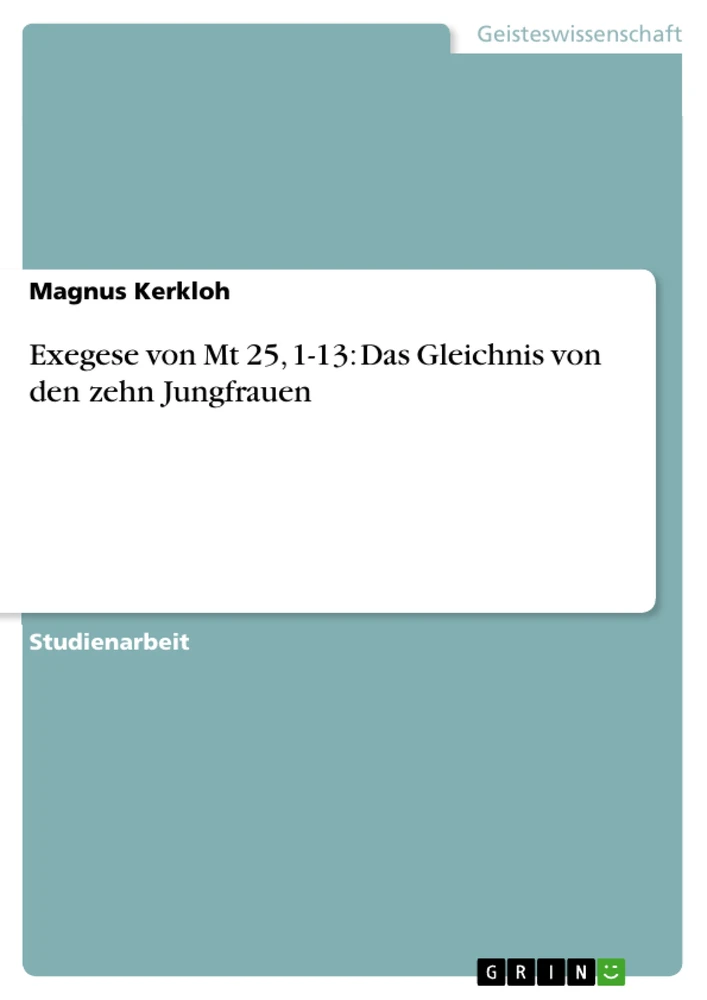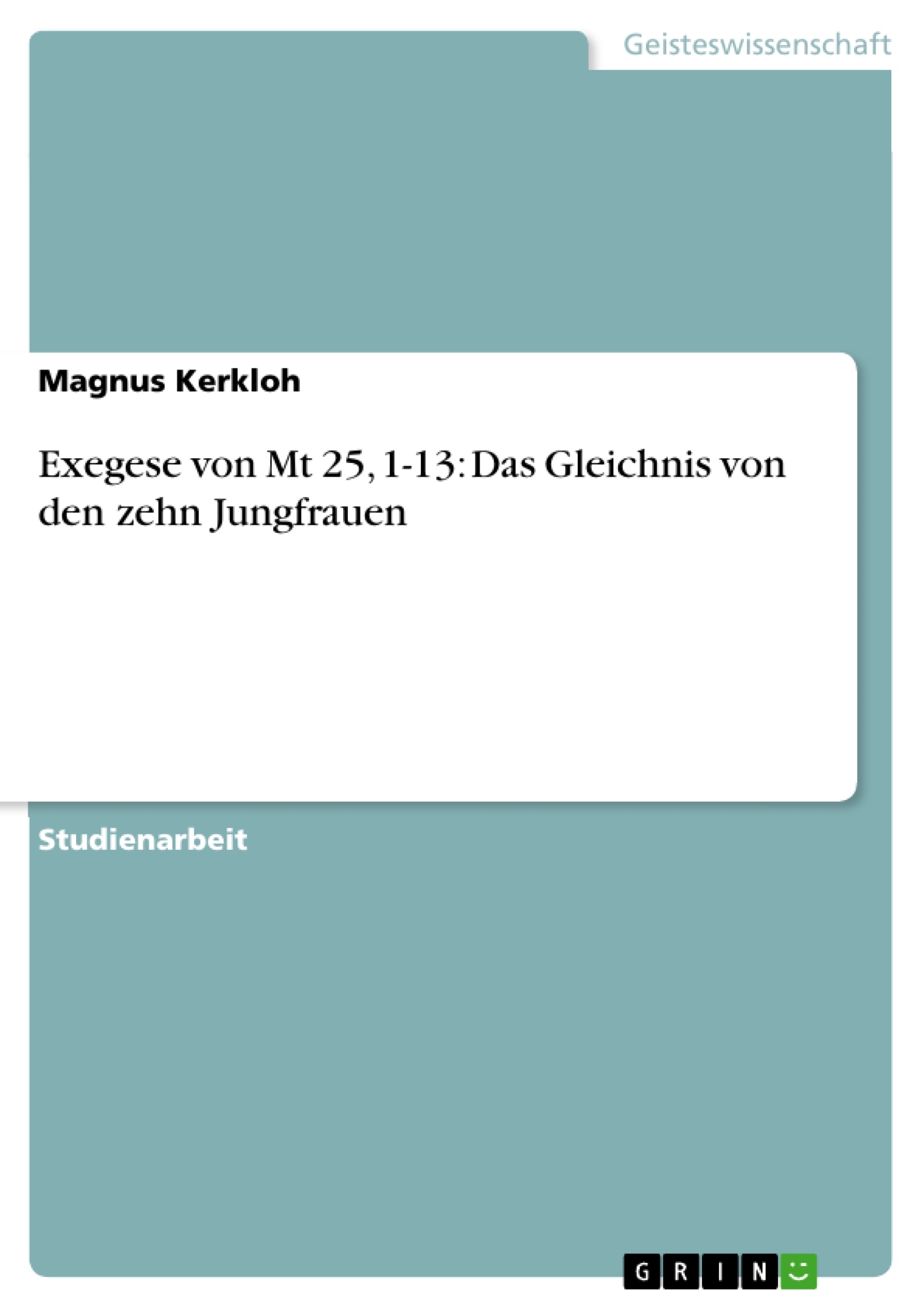„Da Gott in der Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen hat, muß der Schrifterklärer, um zu erfassen, was Gott uns mitteilen wollte, sorgfältig erforschen, was die heiligen Schriftsteller wirklich zu sagen beabsichtigten und was Gott mit ihren Worten kundtun wollte“ (Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei Verbum“ (DV), 12).
Zur Erfüllung dieser Aufgabe dient den Exegeten v. a. die historisch-kritische Methode, deren Anwendung seit der Enzyklika Pius’ XII. ‚Divino afflante Spiritu’ vom Jahre 1943 dem katholischen Exegeten nicht nur erlaubt, sondern zur Pflicht gemacht wird.
Die Anwendung dieser Methode erlaubt es, „die heiligen Texte aus der scheinbaren Vertrautheit in jene Fremdheit zu rücken, die es erst möglich macht, die Stimme der Bibel und nicht immer nur die eigene zu hören“ und so „den Text vor der Vergewaltigung durch ein Verstehen, das im Text [...] nur die eigenen Lieblingsideen wiederfindet,“ zu bewahren.
Jedoch ist hiermit auch die Gefahr der Entfremdung zwischen Leser und Text verbunden, die bis zum Versinken der Texte in Bedeutungslosigkeit für den heutigen Leser führen kann: „Zu Gegenständen der Vergangenheit geworden, reden sie nur noch zu dieser und verstummen gegenüber den heutigen Fragen.“
Obwohl also die historisch-kritische Methode „sich als eine sachgerechte und den Texten angemessene Auslegungsform erwiesen“ hat, ist sie „weder vorraussetzungslos noch unveränderlich“ . Sie darf also nicht um ihrer selbst willen betrieben werden; ihr Ziel muß es vielmehr sein, „einen zuverlässigen Weg zu weisen, der zur Begegnung mit Jesus Christus im Neuen Testament führt.“
Mit diesem Ziel als Vorgabe soll in der vorliegenden Arbeit unter Verwendung der historisch-kritischen Methode das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, welches als drittes von vier Gleichnissen Bestandteil der fünften und letzten großen Rede des Matthäus-Evangeliums, nämlich der Rede über die Endzeit (Mt 24, 1 – 25, 46), ist, näher in den Blick genommen werden. Dabei kommen im einzelnen die sechs Schritte Textkritik, Literarkritik, Formkritik, Gattungskritik, Traditionskritik und Redaktions-kritik zur Anwendung. Die einzelnen Schritte werden dabei im folgenden kurz vorgestellt und dann anhand des Textes vollzogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2. 1 Textkritik
- 2. 2 Literarkritik
- 2. 3 Form- und Gattungskritik (Formgeschichte)
- 2. 3. 1 Formkritik
- 2. 3. 2 Gattungskritik
- 2. 4 Traditionskritik
- 2. 5 Redaktionskritik
- 3. Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Exegese des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen (Mt 25, 1-13), welches als Teil der fünften und letzten großen Rede des Matthäus-Evangeliums über die Endzeit (Mt 24, 1 – 25, 46) betrachtet wird. Ziel der Arbeit ist es, das Gleichnis mithilfe der historisch-kritischen Methode zu analysieren, um einen tieferen Einblick in die Bedeutung des Textes zu gewinnen.
- Die historisch-kritische Methode als Instrument der Textanalyse
- Die Bedeutung des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen im Kontext der Endzeitrede
- Interpretation des Gleichnisses unter Berücksichtigung der literarischen, form- und gattungskritischen Aspekte
- Die Rolle der Traditionskritik und Redaktionskritik bei der Textanalyse
- Die Interpretation des Gleichnisses in seiner historischen und kulturellen Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die historisch-kritische Methode als grundlegendes Instrument der Bibelinterpretation vor und erläutert deren Bedeutung im Kontext der katholischen Exegese. Darüber hinaus wird der Fokus der Arbeit auf das Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Mt 25, 1-13) gelegt, welches im Rahmen der fünften und letzten großen Rede des Matthäus-Evangeliums über die Endzeit betrachtet wird.
2. Hauptteil
2. 1 Textkritik
Die Textkritik befasst sich mit der Rekonstruktion des ursprünglichen Textes des Neuen Testaments anhand der verfügbaren Handschriften. Anhand des Beispiels des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen werden verschiedene Textvarianten diskutiert und die Anwendung von äußeren und inneren Kriterien zur Feststellung der ursprünglichen Lesart erläutert.
2. 2 Literarkritik
Die Literarkritik befasst sich mit der Analyse der literarischen Struktur des Textes und der literarischen Gattung, der er zugeordnet werden kann. Sie untersucht die stilistischen Besonderheiten des Textes und die Intention des Autors.
2. 3 Form- und Gattungskritik (Formgeschichte)
Die Formgeschichte beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung der einzelnen Elemente des Textes, wie z.B. der Gleichnisse. Sie untersucht die Form des Gleichnisses und ordnet es einer bestimmten Gattung zu.
2. 4 Traditionskritik
Die Traditionskritik untersucht die mündliche und schriftliche Überlieferung des Textes und verfolgt die Entwicklung des Gleichnisses von den zehn Jungfrauen von seinen Ursprüngen bis zur endgültigen Fassung im Matthäus-Evangelium.
2. 5 Redaktionskritik
Die Redaktionskritik konzentriert sich auf die Arbeit des Evangelisten Matthäus und seine Absicht, das Gleichnis in seine eigene Schrift zu integrieren. Sie analysiert die spezifischen Anpassungen und Veränderungen, die Matthäus am Text vorgenommen hat.
Schlüsselwörter
Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, Matthäus-Evangelium, Endzeitrede, historisch-kritische Methode, Textkritik, Literarkritik, Formkritik, Gattungskritik, Traditionskritik, Redaktionskritik, Gleichnisinterpretation, christliche Lehre, christlicher Glaube.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die historisch-kritische Methode in der Exegese?
Es ist eine wissenschaftliche Methode zur Auslegung biblischer Texte, die deren historischen Entstehungskontext und literarische Form untersucht.
Was bedeutet Textkritik beim Gleichnis von den zehn Jungfrauen?
Die Textkritik versucht, durch den Vergleich verschiedener Handschriften den ursprünglichen Wortlaut von Mt 25, 1-13 so genau wie möglich zu rekonstruieren.
Was ist das Ziel der Redaktionskritik im Matthäus-Evangelium?
Sie untersucht, wie der Evangelist Matthäus vorhandene Traditionen bearbeitet und in seine theologische Gesamtkonzeption, hier die Endzeitrede, eingefügt hat.
Welche Rolle spielt die Gattungskritik bei Gleichnissen?
Sie ordnet den Text einer literarischen Form (z.B. Parabel oder Beispielerzählung) zu, um die spezifische Bildsprache und Intention besser zu verstehen.
Warum ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen für die Endzeitrede wichtig?
Es mahnt zur Wachsamkeit und Vorsorge angesichts der erwarteten Wiederkunft Christi und der Ungewissheit über den Zeitpunkt des Gerichts.
- Arbeit zitieren
- Magnus Kerkloh (Autor:in), 2002, Exegese von Mt 25, 1-13: Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14050