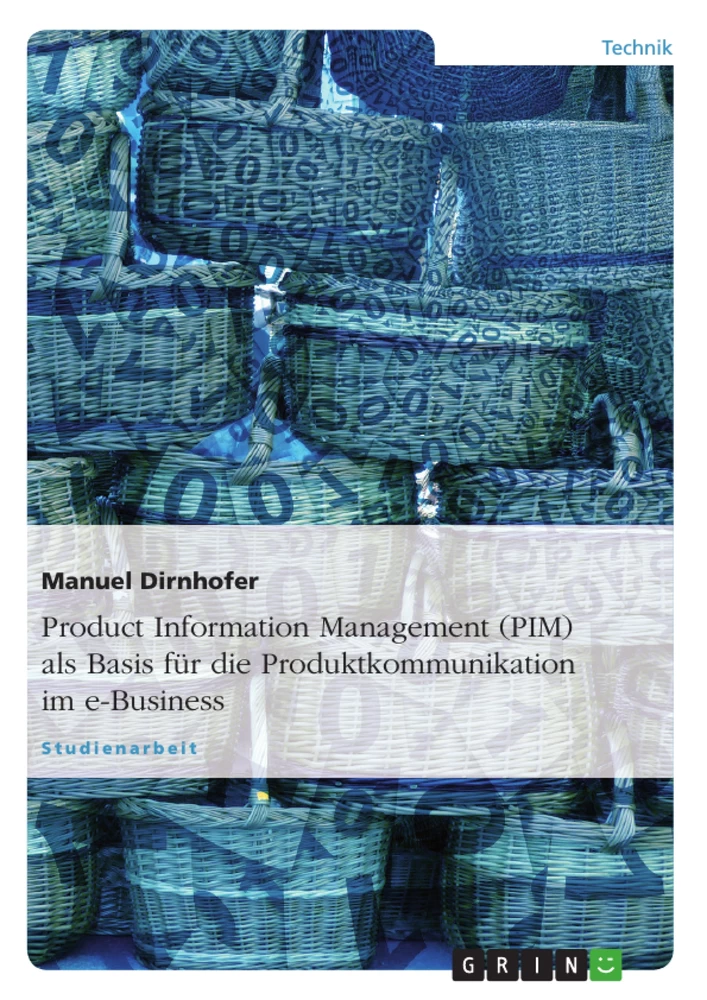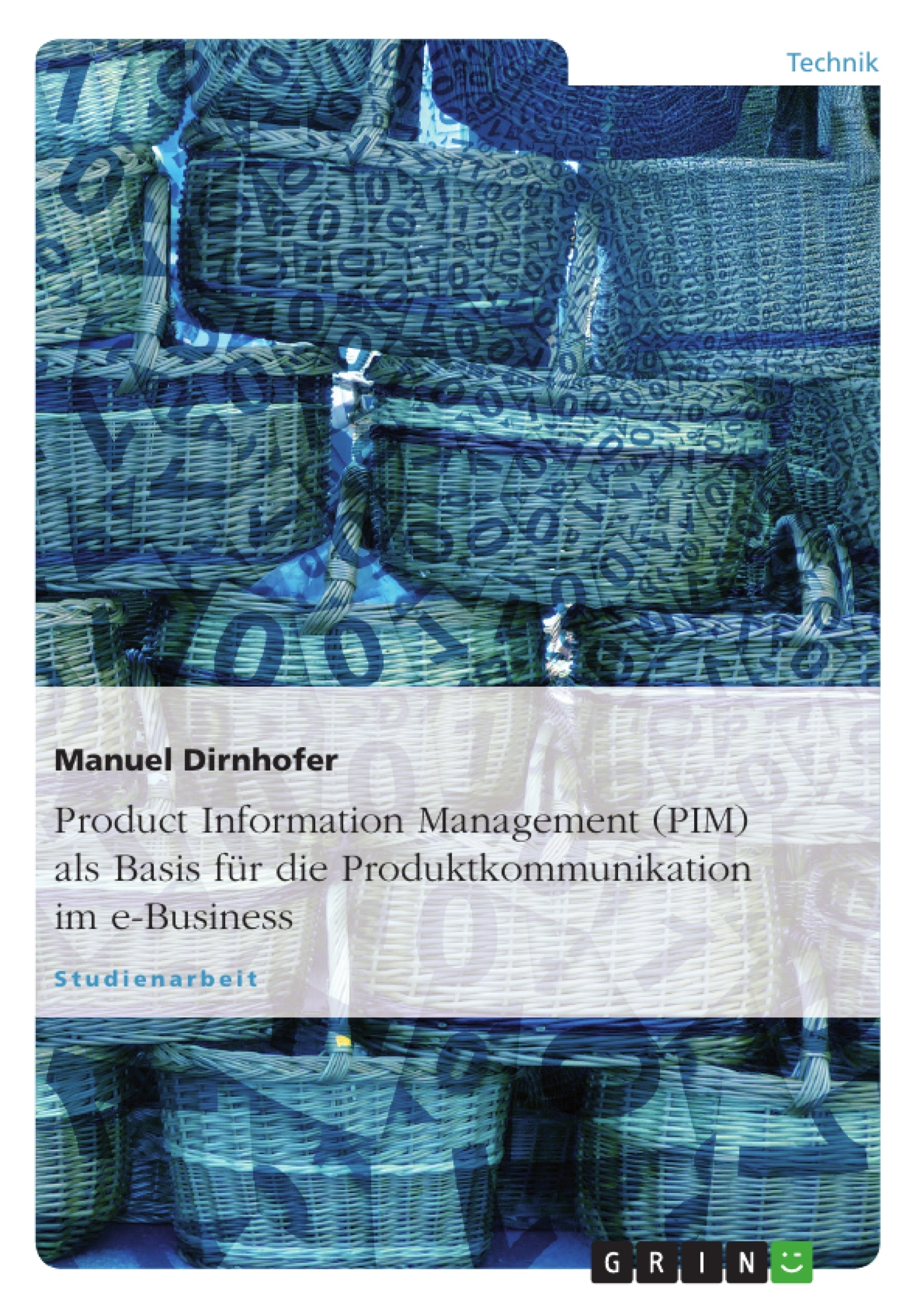Ziel der Studienarbeit ist es, eine Übersicht über das Thema „Product Information Management“ (im folgenden PIM) zu geben. Darüber hinaus wird aufgezeigt wie das Thema PIM im Zusammenhang mit dem e-Business, speziell e-Marketing und e-Commerce, für die Marktkommunikation- und Information genutzt werden kann. Es wird auf verschiedene Bereiche des e-Business und dessen Geschäftsbeziehungen eingegangen.
Die Eigenleistung besteht in der Anforderungsbeschreibung an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem im e-Commerce. Hier wird anhand eines Modells die Integration einer PIM-Lösung in die Systemlandschaft eines Unternehmens vorgestellt. Dabei wird auch auf die Probleme bei der Implementierung eines integrierten PIM-Prozesses eingegangen. Eine Schlussbetrachtung und Empfehlung an Unternehmen, die mit e-Commerce und PIM zukünftig Ihre Produktkommunikation verbessern möchten, bilden den Abschluss der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Inhalte und Ziele des Product Information Management
- 2.1 Charakterisierung des Product Information Managements
- 2.1.1 Definition und Einordnung
- 2.1.2 Abgrenzung von PIM zu verwandten Bereichen des e-Business
- 2.2 Ziele des Product Information Management
- 2.3 Bestandteile und Prinzipien eines PIM
- 2.3.1 Zentrale Produktdatenhaltung – Kernaspekt des PIM
- 2.3.2 Granularität der Produktdatenhaltung
- 2.3.3 Beschreibung von Produkten durch Klassifikationen
- 2.3.4 Datensynchronisation zwischen e-Business Systemen
- 2.3.5 Graphische Benutzeroberfläche und Pflegemasken
- 2.3.6 Zusätzliche Funktionalitäten und Bestandteile
- 2.1 Charakterisierung des Product Information Managements
- 3 Kriterien für den Einsatz eines PIM im e-Business
- 3.1 Waren- und Informationsfluss im elektronischen Geschäftsverkehr
- 3.1.1 Verschiedene Geschäftsbeziehungen im e-Business
- 3.1.2 Verschiedene Bereiche des e-Business
- 3.1.3 Beziehung zwischen Waren und Informationsfluss im e-Business
- 3.2 Rahmenbedingungen für den Einsatz eines PIM
- 3.3 Umsetzungsmöglichkeiten für die Marktkommunikation
- 3.1 Waren- und Informationsfluss im elektronischen Geschäftsverkehr
- 4 Anforderungen an ein PIM gestütztes Kommunikations-System im e-Commerce
- 4.1 Modell Integriertes Product Information Management
- 4.2 Anforderungen und Einflussfaktoren an Organisation und IT Systeme
- 4.3 Mögliche Probleme und Risiken
- 5 Schlussbetrachtung und Empfehlung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Rolle des Product Information Managements (PIM) für die Produktkommunikation im E-Business. Ziel ist es, die Bedeutung von PIM für effiziente und effektive Produktinformationen im Kontext verschiedener E-Business-Anwendungen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert die wesentlichen Bestandteile und Prinzipien von PIM, die Kriterien für den erfolgreichen Einsatz und die Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem.
- Definition und Einordnung von PIM
- Bestandteile und Prinzipien eines PIM-Systems
- Kriterien für den Einsatz von PIM im E-Business
- Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem
- Mögliche Probleme und Risiken bei der PIM-Implementierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Zielsetzung der Studienarbeit, die sich auf die Untersuchung des Product Information Managements (PIM) als Grundlage für die Produktkommunikation im E-Business konzentriert. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die methodische Vorgehensweise. Der Fokus liegt auf der praktischen Relevanz von PIM im Kontext von E-Business-Strategien und -Prozessen.
2 Inhalte und Ziele des Product Information Management: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Charakterisierung des Product Information Managements. Es definiert PIM, grenzt es von verwandten Bereichen ab und beschreibt seine zentralen Ziele. Der Fokus liegt auf der zentralen Produktdatenhaltung als Kernaspekt von PIM, der Granularität der Datenhaltung und der Beschreibung von Produkten mittels Klassifikationen. Die Datensynchronisation zwischen verschiedenen E-Business-Systemen und die Gestaltung der Benutzeroberfläche werden ebenfalls behandelt. Die Kapitel vermittelt ein tiefgreifendes Verständnis der Funktionsweise und der Bedeutung von PIM.
3 Kriterien für den Einsatz eines PIM im e-Business: Dieses Kapitel untersucht die Kriterien, die für den erfolgreichen Einsatz eines PIM-Systems im E-Business relevant sind. Es analysiert den Waren- und Informationsfluss im elektronischen Geschäftsverkehr, betrachtet verschiedene Geschäftsbeziehungen und Bereiche des E-Business und beleuchtet den Zusammenhang zwischen Waren- und Informationsfluss. Zusätzlich werden Rahmenbedingungen wie Zielgruppen, Distributionskanäle, Sprache, Sortimentsgröße und Marketingstrategien untersucht. Das Kapitel zeigt auf, wie PIM an die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher E-Business-Kontexte angepasst werden kann.
4 Anforderungen an ein PIM gestütztes Kommunikations-System im e-Commerce: Dieses Kapitel befasst sich mit den Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem im E-Commerce. Es präsentiert ein Modell für ein integriertes Product Information Management, untersucht die Anforderungen an Organisation und IT-Systeme und diskutiert mögliche Probleme und Risiken bei der Implementierung. Der Fokus liegt auf der erfolgreichen Integration von PIM in bestehende IT-Landschaften und Geschäftsprozesse.
Schlüsselwörter
Product Information Management (PIM), E-Business, Produktkommunikation, Produktdatenhaltung, Datensynchronisation, e-Commerce, Online-Katalog, Online-Shop, Markkommunikation, IT-Systeme, Geschäftsprozesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Product Information Management (PIM) im E-Business
Was ist das Thema der Studienarbeit?
Die Studienarbeit untersucht die Rolle des Product Information Managements (PIM) für die Produktkommunikation im E-Business. Sie analysiert die Bedeutung von PIM für effiziente und effektive Produktinformationen in verschiedenen E-Business-Anwendungen, die Bestandteile und Prinzipien von PIM, Kriterien für den erfolgreichen Einsatz und Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem.
Welche Ziele verfolgt die Studienarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von PIM für effiziente und effektive Produktinformationen im Kontext verschiedener E-Business-Anwendungen aufzuzeigen. Sie analysiert die wesentlichen Bestandteile und Prinzipien von PIM, die Kriterien für den erfolgreichen Einsatz und die Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Zentrale Themen sind die Definition und Einordnung von PIM, die Bestandteile und Prinzipien eines PIM-Systems, die Kriterien für den Einsatz von PIM im E-Business, die Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem und mögliche Probleme und Risiken bei der PIM-Implementierung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau. Kapitel 2 charakterisiert PIM, seine Ziele und Bestandteile. Kapitel 3 untersucht Kriterien für den PIM-Einsatz im E-Business. Kapitel 4 befasst sich mit Anforderungen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem. Kapitel 5 bietet eine Schlussbetrachtung und Empfehlungen.
Was wird unter Product Information Management (PIM) verstanden?
PIM wird als zentrale Produktdatenhaltung definiert, die die Granularität der Datenhaltung, die Beschreibung von Produkten mittels Klassifikationen, die Datensynchronisation zwischen verschiedenen E-Business-Systemen und die Gestaltung der Benutzeroberfläche umfasst. Es dient der effizienten und effektiven Bereitstellung von Produktinformationen.
Welche Kriterien sind für den erfolgreichen Einsatz von PIM im E-Business relevant?
Relevante Kriterien umfassen den Waren- und Informationsfluss im elektronischen Geschäftsverkehr, verschiedene Geschäftsbeziehungen und Bereiche des E-Business, den Zusammenhang zwischen Waren- und Informationsfluss, sowie Rahmenbedingungen wie Zielgruppen, Distributionskanäle, Sprache, Sortimentsgröße und Marketingstrategien.
Welche Anforderungen bestehen an ein PIM-gestütztes Kommunikationssystem im E-Commerce?
Die Anforderungen umfassen ein Modell für integriertes Product Information Management, Anforderungen an Organisation und IT-Systeme sowie die Berücksichtigung möglicher Probleme und Risiken bei der Implementierung und Integration in bestehende IT-Landschaften und Geschäftsprozesse.
Welche Probleme und Risiken können bei der PIM-Implementierung auftreten?
Die Arbeit diskutiert mögliche Probleme und Risiken bei der Implementierung eines PIM-Systems, die jedoch im Detail nicht explizit aufgeführt werden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die erfolgreiche Integration von PIM in bestehende IT-Landschaften und Geschäftsprozesse ein kritischer Faktor ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studienarbeit?
Schlüsselwörter sind: Product Information Management (PIM), E-Business, Produktkommunikation, Produktdatenhaltung, Datensynchronisation, e-Commerce, Online-Katalog, Online-Shop, Markkommunikation, IT-Systeme, Geschäftsprozesse.
- Quote paper
- Manuel Dirnhofer (Author), 2009, Product Information Management (PIM) als Basis für die Produktkommunikation im e-Business, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140536