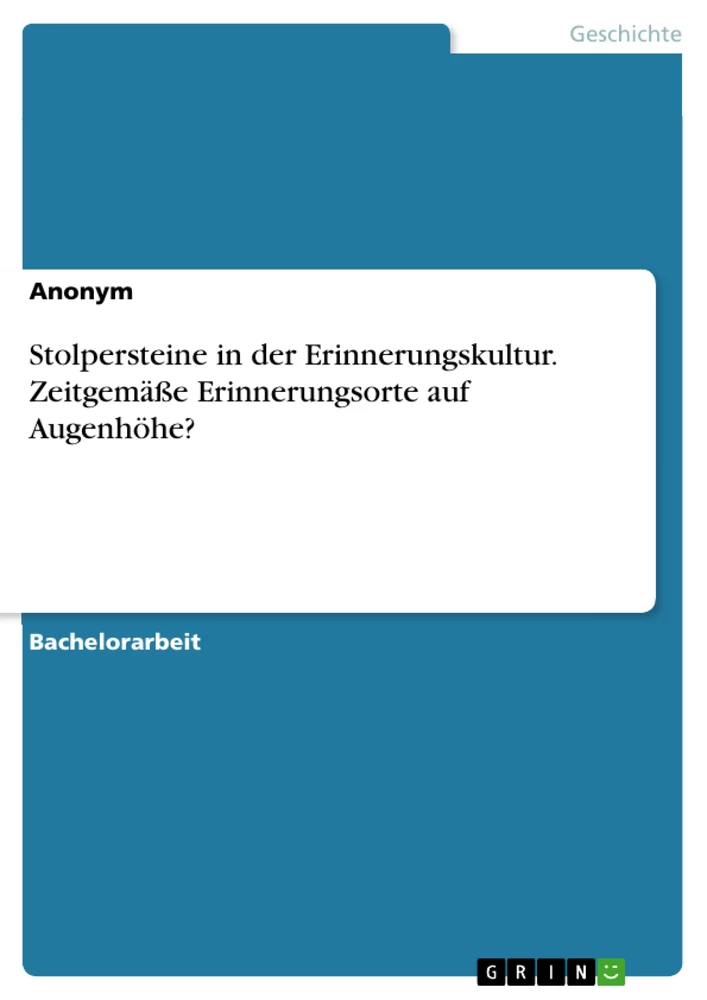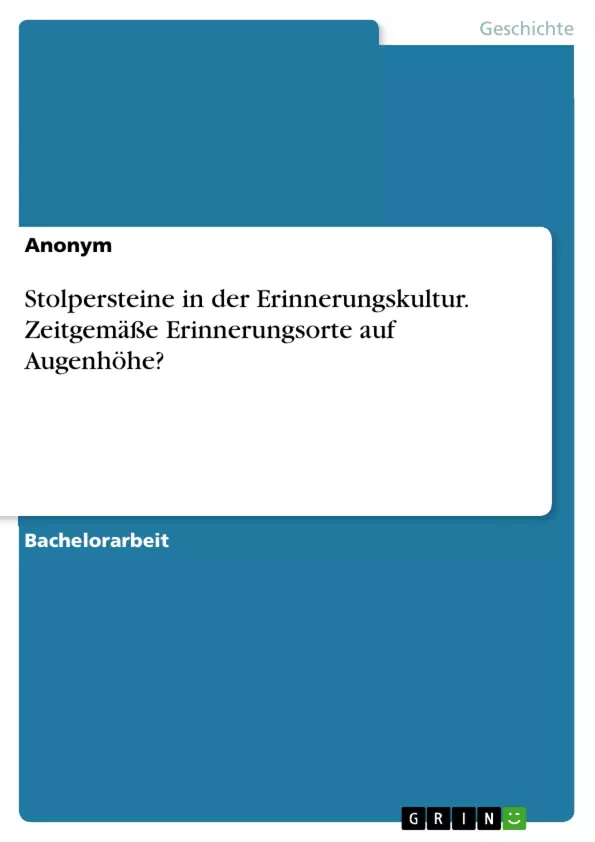Während Befürworter:innen die Stolpersteine als Höhepunkt einer gelungenen Erinnerungskultur loben, kritisieren Gegner:innen wie Charlotte Knobloch vor allem die Lage der Stolpersteine: „Auf dem Boden sind die Opfer wieder schutzlos – wie einst“. Doch steckt hinter dieser Kritik mehr als eine Debatte um Metaphern? Wie sind Stolpersteine als Erinnerungsorte zu bewerten? Entsprechen sie 25 Jahre nach ihrer Konzeption den aktuellen erinnerungskulturellen Ansprüchen?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, müssen zuerst weitere Fragen gestellt werden: Was ist überhaupt das Gedächtnis, das zum Erinnern befähigt? Was ist das kollektive Gedächtnis nach Maurice Halbwachs? Wie entwickelten Jan und Aleida Assmann sein Konzept weiter? Was meinte Pierre Nora mit seinem Begriff „Erinnerungsort“?
Nach dieser theoretischen Einführung in das Gedächtnis und seine Orte soll sich der praktischen Seite des Gedächtnisses, die sich in einer Erinnerungspraxis bzw. Erinnerungskultur niederschlägt, zugewandt werden. Was ist eine Erinnerungskultur? Wie entwickelte sich die deutsche Erinnerungskultur? Welchen Platz hatten und haben die NS-Opfer in der deutschen Erinnerungskultur? Im fünften Kapitel soll gefragt werden, welcher Idee die Stolpersteine folgen und welche Auswirkungen sie auf die deutsche Erinnerungskultur haben. Dann soll sich vor allem negativen Kritiken über die Stolpersteine zugewandt werden. Hierbei ist hervorzuheben, dass die Anzahl Unterstützer:innen des Stolperstein-Projekts um einiges höher ist als die der Gegner:innen.
Schließlich sind alle Voraussetzungen erfüllt, um in einem Fazit eine eigene Bewertung der Stolpersteine als Erinnerungsorte vor dem Hintergrund all dieser Themen zu versuchen. Diese Arbeit soll keinen Beitrag zur Erforschung der nationalsozialistischen Verbrechen leisten. Sie untersucht ausschließlich die Rezeption dieses Ereignisses in der Gedächtnisforschung sowie im Gedächtnisdiskurs seit 1945 bis heute. Dabei soll vor allem auf den Erinnerungsort als Strategie zum Umgang mit den Erinnerungen zu nationalsozialistischen Verbrechen eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gedächtnis in der Forschung
- Das kollektive Gedächtnis nach Maurice Halbwachs
- Das Gedächtnis nach Aleida und Jan Assmann
- Erinnerungsorte als Schnittstelle von Geschichte und Gedächtnis
- Der Ort als Gedächtnis
- Pierre Noras Lieux de mémoire und seine Folgen
- Der Holocaust in der deutschen Erinnerungskultur
- Der erinnerungskulturelle Diskurs nach 1945
- Das Gedächtnis der Holocaust-Opfer
- Aktuelle Herausforderungen und Chancen
- Stolpersteine - Idee, Konzept, Projekt
- Kritik an den Stolpersteinen
- Kritik aus Wissenschaft und Gedenkstättenarbeit
- Charlotte Knobloch und die Folgen für München
- Stolzesteine der Künstlerin Dessa
- Stolpersteine als Erinnerungsort?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Stolpersteine als Erinnerungsort im Kontext der deutschen Erinnerungskultur. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob Stolpersteine zeitgemäße Erinnerungsorte auf Augenhöhe sind.
- Erinnerungstheorie und Erinnerungskultur
- Das Konzept des kollektiven Gedächtnisses
- Die Bedeutung von Orten für das Gedächtnis
- Die deutsche Erinnerungskultur im Kontext des Holocaust
- Kritik und Rezeption der Stolpersteine
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die Forschungsfrage nach der Zeitgemäßheit der Stolpersteine. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Gedächtnis in der Forschung und beleuchtet die Theorien des kollektiven Gedächtnisses von Maurice Halbwachs sowie die Weiterentwicklungen durch Jan und Aleida Assmann. Kapitel 3 widmet sich dem Konzept des Erinnerungsortes und beleuchtet die Bedeutung von Orten für das Gedächtnis. Es werden insbesondere die Arbeiten von Pierre Nora und seine „Lieux de mémoire“ erläutert. In Kapitel 4 wird die deutsche Erinnerungskultur im Kontext des Holocaust betrachtet. Kapitel 5 stellt die Idee und das Konzept der Stolpersteine vor und untersucht deren Auswirkungen auf die deutsche Erinnerungskultur. Kapitel 6 widmet sich verschiedenen kritischen Perspektiven auf die Stolpersteine, darunter Kritik aus Wissenschaft und Gedenkstättenarbeit, die Kritik von Charlotte Knobloch und die künstlerische Perspektive von Dessa.
Schlüsselwörter
Stolpersteine, Erinnerungskultur, kollektives Gedächtnis, Erinnerungstheorie, Erinnerungsorte, Holocaust, deutsche Geschichte, Kritik, Rezeption.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2023, Stolpersteine in der Erinnerungskultur. Zeitgemäße Erinnerungsorte auf Augenhöhe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1405542