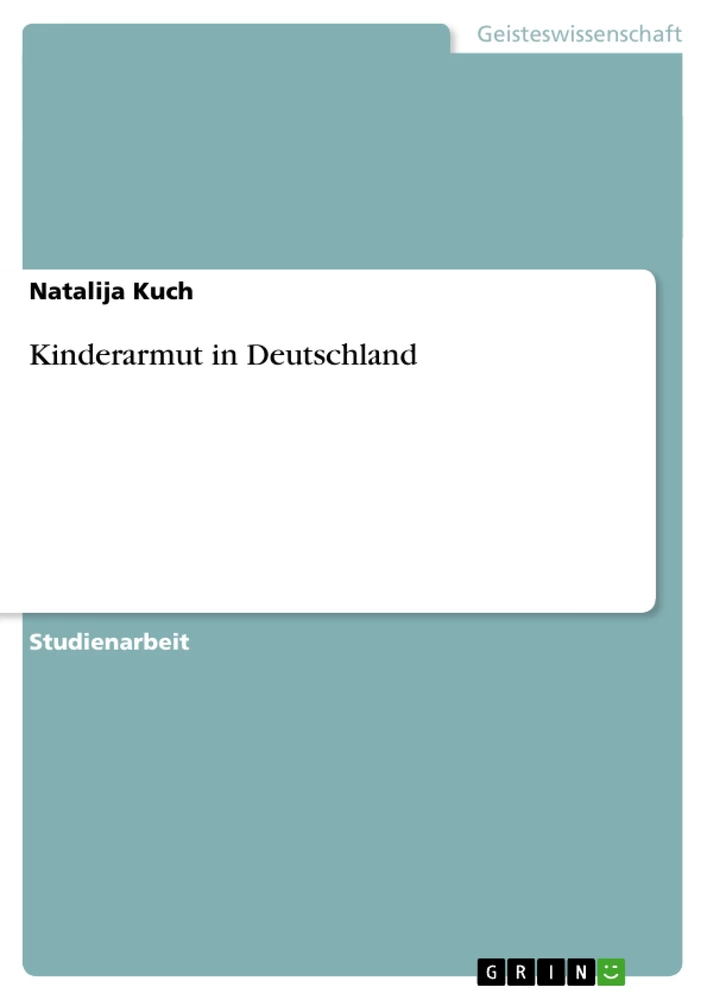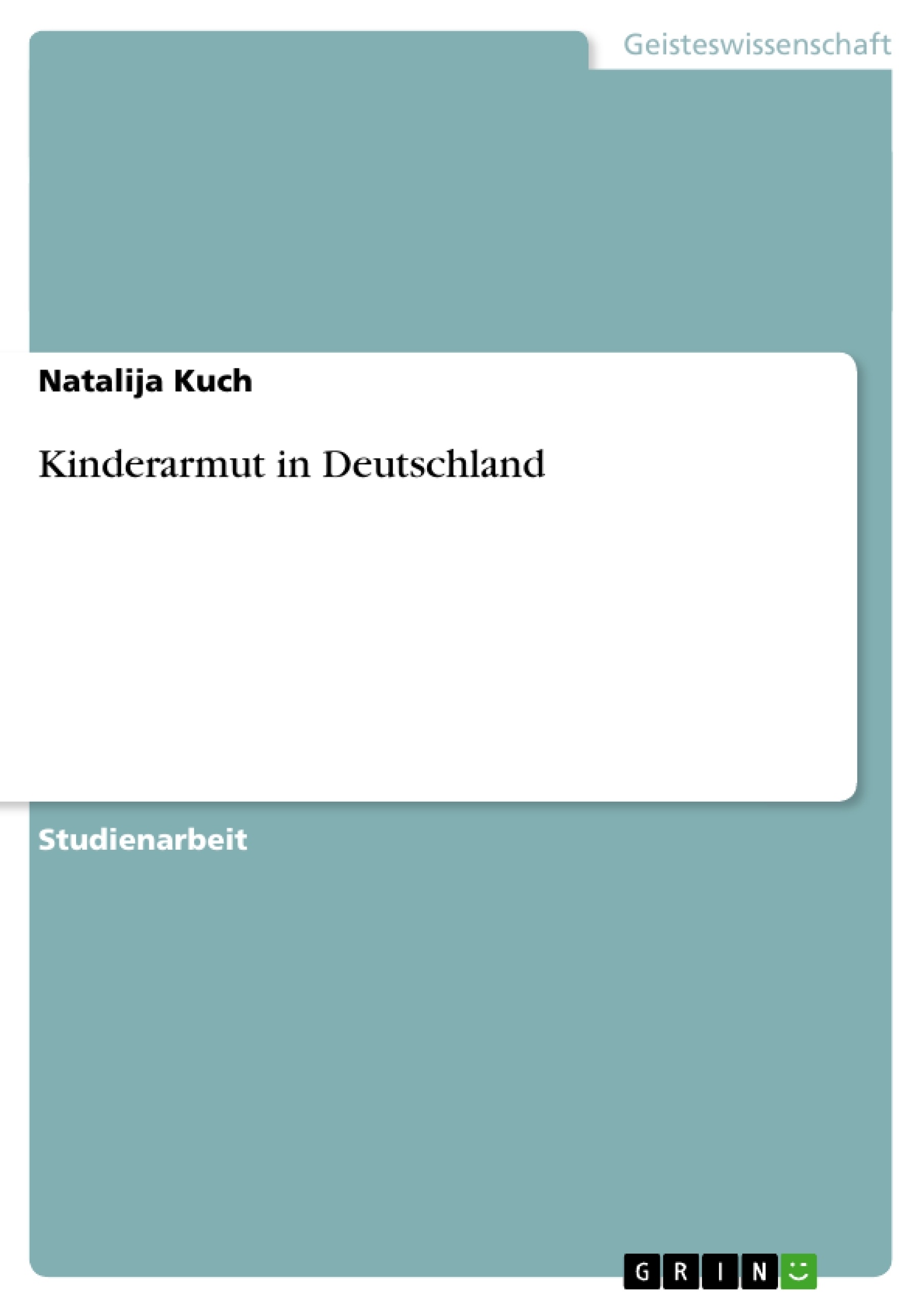Die Armut ist heutzutage nicht mehr ein Problem, das nur in den Entwicklungsländern auftritt. In vielen westlichen Industrienationen und unter anderem auch in Deutschland ist Armut weiter verbreitet, als allgemein angenommen wird. Nach Aussage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist in Deutschland jedes siebte Kind arm. Der 2. Armutsbericht der Bundesregierung 2005 stellt fest, dass rund 1,1 Mio. Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe Kinder unter 18 Jahren sind. Mit einer Sozialhilfequote von 7,2% (Ende 2003) weisen sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (3,4%) einen deutlich höheren Hilfebedarf auf. 55% von ihnen leben in Haushalten von Alleinerziehenden und nur 35% in Zwei-Eltern-Familien. Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Familienhaushalten. (siehe S. 9)
In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich auf Probleme der Armut eingehen und die Auswirkungen für die Kinder verdeutlichen. Hierbei werden speziell die physischen und psychischen Folgen betrachtet. Zuerst werde ich im Punkt 2 Definitionen von Armut beschreiben. Nach dem theoretischen Teil und der Vorstellung von Auswirkungen der Armut, werde ich die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung von Armut zusammenfassen.
Inhaltverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Armutsbegriff
2.1 Der ressourcentheoretische Ansatz
2.2 Der Lebenslagenansatz
2.3 Bekämpfte Armut
2.4 Andere Armutsindikatoren.
3. Spezifische Risikogruppen für Armut – wer ist besonders gefährdet
3.1 Von der Partnerschaft zur Elternschaft .
3.2 Trennung und Scheidung
3.3 Kinderreiche Familien
3.4 Ausländische Familien
4. Folgen und Konsequenzen der Armut
4.1 Gesundheitliche und psychische Konsequenzen
4.2 Soziale Konsequenzen
4.3 Konsequenzen in der Bildung
4.4 Wohnumfeld
5. Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Armut
6. Schlusswort
Literatur.
1. Einleitung
Die Armut ist heutzutage nicht mehr ein Problem, das nur in den Entwicklungsländern auftritt. In vielen westlichen Industrienationen und unter anderem auch in Deutschland ist Armut weiter verbreitet, als allgemein angenommen wird. Nach Aussage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist in Deutschland jedes siebte Kind arm. Der 2. Armutsbericht der Bundesregierung 2005 stellt fest, dass rund 1,1 Mio. Bezieherinnen und Bezieher von Sozialhilfe Kinder unter 18 Jahren sind. Mit einer Sozialhilfequote von 7,2% (Ende 2003) weisen sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (3,4%) einen deutlich höheren Hilfebedarf auf. 55% von ihnen leben in Haushalten von Alleinerziehenden und nur 35% in Zwei-Eltern-Familien. Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Familienhaushalten. (siehe S. 9)
In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich auf Probleme der Armut eingehen und die Auswirkungen für die Kinder verdeutlichen. Hierbei werden speziell die physischen und psychischen Folgen betrachtet. Zuerst werde ich im Punkt 2 Definitionen von Armut beschreiben. Nach dem theoretischen Teil und der Vorstellung von Auswirkungen der Armut, werde ich die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung von Armut zusammenfassen.
2. Der Armutsbegriff.
Bevor ich über Kinderarmut und ihre Auswirkungen berichte, möchte ich festlegen, was Armut überhaupt ist und ab wann eine Person als arm bezeichnet wird. Innerhalb der Armutsforschung existiert seit längerem eine Diskussion, was die Definition von „Armut“ angeht. Da der Begriff der Armut vielschichtig ist, gibt es keine einheitliche Definition, sondern eine Vielzahl von Begriffsbestimmungen und Konzepten. Die Forscher sind sich einig, dass Armut immer mit Unterversorgung, Mangel, Entbehrung und Einschränkung zu tun hat.
Die Weltgesundheitsorganisation definiert Armut beispielsweise anhand des Verhältnisses des individuellen Einkommens einer Person zum Durchschnittseinkommen im Heimatland. Danach ist arm, wer monatlich weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens einer Person seines Landes zur Verfügung hat.
Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen mehreren Kategorien, insbesondere zwischen absoluter, relativer und transistorischer Armut.
Der Begriff der absoluten Armut wurde vom den Präsidenten der Weltbank eingeführt. Er definiert absolute Armut in folgender Weise: „Armut auf absolutem Niveau ist Leben am äußersten Rande der Existenz. Die absolut Armen sind Menschen, die unter schlimmen Entbehrungen und in einem Zustand von Verwahrlosung und Entwürdigung ums Überleben kämpfen.“ Man spricht von absoluter Armut nicht nur im Bezug auf Entwicklungsländer. Auch in entwickelten Industriegesellschaften existiert absolute Armut zum Beispiel bei Suchtkranken, Obdachlosen oder bei Personen, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, soziale Sicherungssysteme in Anspruch zu nehmen. Der absolute Armutsbegriff definiert einen Einkommensmangel unterhalb einer festgelegten Existenzgrenze.
Dagegen steht das Konzept der relativen Armut. Hier ist die Bezugsgrenze ein relativer Wert, beispielsweise die Hälfte des Durchschnittseinkommens einer Person in Deutschland. Dieses Konzept wird meist in den so genannten Wohlstandsgesellschaften benutzt. Hier wird also Armut auf die Gesellschaftsverhältnisse des Individuums bezogen definiert. Wegen dieser Umfeldabhängigkeit wird demnach von "relativer Armut" gesprochen. Relative Armut kann als Unterversorgung mit materiellen und immateriellen Ressourcen von Menschen bestimmter sozialer Schichten im Verhältnis zum Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft bezeichnet werden.
Von transitorischer (vorübergehender) Armut spricht man, wenn Armut zeitweise vorhanden ist. Dies kann durch zyklische Schwankungen, wie bei Teilen einer Landbevölkerung kurz vor der Ernte, oder azyklisch, z.B. durch Katastrophen, auftreten.
Hinsichtlich der Armut in Deutschland sind jedoch folgende Aspekte unbestritten:
a) Armut in Deutschland ist nicht mit Armut in Entwicklungsländern vergleichbar. Sie ist
sowohl räumlich als auch zeitlich bedingt, d.h. dass Armut nicht zu einer bestimmten Zeit als ein Problem für die gesamte Gesellschaft auftritt. In Deutschland ist lediglich ein kleiner Teil der Gesellschaft von Armut betroffen, die überwiegend auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt ist.
b) Armut ist vielschichtig. Sie stellt nicht nur ein ökonomisch-materielles, sondern auch
ein soziales, kulturelles und psychisches Problem dar.
Durch Unterversorgung im Bereich von Gesundheit, Bildung und Erwerbstatus kommt es zu einem Ausschluss der Armen von der Partizipation am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben.
Armut ist in manchen Teilgruppen der Bevölkerung weiter verbreitet als in anderen. Hierzu zählen allein erziehende Mütter mit ihren Kindern, kinderreiche Familien und vor allem die verschiedenen Gruppen von Zuwandererfamilien.
c) Armut ist in Deutschland kein absolutes, sondern ein relatives Problem.
Absolute Armut bedeutet die Bedrohung der Existenz eines Menschen durch Hunger,
Obdachlosigkeit oder Krieg. Der in absoluter Armut lebende Mensch ist vom Tod bedroht.
Absolute Armut ist insofern eher ein Problem von Entwicklungsländern. In westlichen
Industrienationen ist sie nahezu verschwunden.
Deshalb erscheint es hier sinnvoller, Armut als relativen Begriff zu betrachten. Relativ, weil es
eigentlich unmöglich ist, eine objektive Armutsgrenze zu ziehen.
Der Begriff relative Armut definiert die Armut in Abhängigkeit zum Wohlstandsniveau der Gesellschaft. Er bestimmt also kein Existenzminimum. Hierbei geht man von einem
ressourcentheoretischen Ansatz aus.
2.1 Der ressourcentheoretische Ansatz
Armut wird als eine Unterausstattung an monetären (sämtliche Einkommen) bzw. nicht
monetären Ressourcen (Ergebnisse hauswirtschaftlicher Produktion) verstanden. Materielle Mittel stellen den wesentlichen Faktor für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Befriedigung von Bedürfnissen dar. Fehlen diese, kann es zur Ausgrenzung und Armut im nichtmateriellem Sinn (Kultur, Freizeitgestaltung) kommen. Empirische Studien fokussieren sich jedoch fast ausschließlich auf eine Ressource, nämlich das verfügbare Einkommen. Demzufolge liegt die offizielle Armutsgrenze bei 50% oder weniger des Durchschnitteinkommens eines vergleichbaren Haushalts
2.2 Der Lebenslagenansatz
Der Begriff des Lebenslagenansatzes wurde 1956 von Gerhard Weisser geprägt. Er bezeichnet Lebenslage als den „Spielraum, den einem Menschen die äußeren Umstände nachhaltig für die Befriedigung der Interessen bieten, die den Sinn seines Lebens bestimmen.“ (vgl. Weisser, S. 986) Hierbei wird auf die tatsächliche Versorgungslage eingegangen, in der Lebensbereiche wie Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mit einbezogen werden. Es erfolgt eine genauere Erfassung und Bewertung der sozial ausgrenzenden Wirkung von Armut. Es zeigt sich, dass mit materieller Armut auch immer andere Faktoren von Unterversorgung auftreten, z.B. auf dem Aubildungsniveau.
[...]
Häufig gestellte Fragen zur Kinderarmut in Deutschland
Wie viele Kinder sind in Deutschland von Armut betroffen?
Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist etwa jedes siebte Kind in Deutschland arm. Der 2. Armutsbericht bezifferte die Zahl der minderjährigen Sozialhilfeempfänger auf rund 1,1 Millionen.
Was ist der Unterschied zwischen absoluter und relativer Armut?
Absolute Armut bedeutet ein Leben am Rande des Existenzminimums (Hunger, Obdachlosigkeit). Relative Armut bezieht sich auf den Wohlstand der jeweiligen Gesellschaft; in Deutschland gilt man als arm, wenn man weniger als 50% des Durchschnittseinkommens zur Verfügung hat.
Welche Familien sind besonders armutsgefährdet?
Besonders gefährdet sind Kinder von Alleinerziehenden (55% der Betroffenen), kinderreiche Familien sowie ausländische Familienhaushalte.
Was versteht man unter dem Lebenslagenansatz?
Der Lebenslagenansatz betrachtet nicht nur das Einkommen, sondern den gesamten Spielraum für Interessen in Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Wohnen und soziale Teilhabe.
Welche Folgen hat Armut für die Entwicklung von Kindern?
Armut hat weitreichende Konsequenzen für die physische und psychische Gesundheit, die Bildungschancen, das soziale Umfeld und die allgemeine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
- Quote paper
- Natalija Kuch (Author), 2006, Kinderarmut in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140569