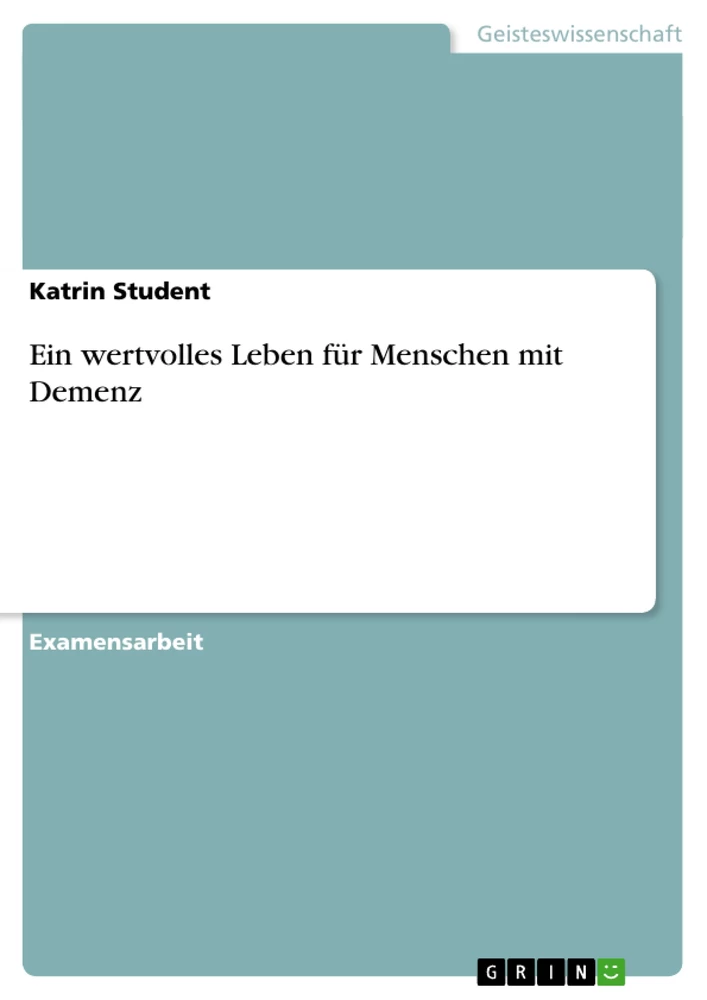Die Ausgangsfrage für diese Arbeit ist, wie ein menschenwürdiges Leben von Men-schen mit Demenz gelingen kann. Es erscheint jedoch sinnvoll genauer zu überlegen was unter Würde zu verstehen ist und welche Bedeutung sie für Menschen mit Demenz hat. Dafür ist es auch bedeutsam, den Begriff der Würde zu beschreiben und wie sie Menschen mit Demenz ermöglicht werden könnte. Zudem können sich für die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession viel eher Handlungsmöglichkeiten daraus ergeben. Ja, vielleicht könnte es gerade Aufgabe Sozialer Arbeit sein, den Blick immer wieder unter dem Aspekt der Menschenwürde und der Menschenrechte auf Menschen mit Demenz zu lenken. Um die Möglichkeiten nicht allein auf das Individuum einzuengen und über traditionel-le Formen der Versorgung (Heimunterbringung oder Betreuung durch Angehörige) hinaus zu denken, ist mir die Diskussion sozialräumlicher Aspekte wichtig. Deshalb sind weitere leitende Fragestellungen: Was leistet der Sozialraum? Wie kann dieser zu einem menschenwürdigen Leben mit Demenz beitragen? Zu überlegen ist auch, welche sozialräumlichen Handlungsansätze die Möglichkeiten allgemein und damit auch die Möglichkeiten zur Würde erweitern können. In der gesamten Arbeit knüpfe ich an theoretische Ressourcen der Jugendhilfe, Behindertenarbeit und allgemeinen sozialarbeiterischen und sozialwissenschaftlichen Theorien an. Diese beschreibe ich und übertrage sie dann auf das Arbeitsfeld Demenz, weil entsprechende deutschsprachige Literatur, die sich auf Demenz bezieht, bisher nicht existiert. Deshalb wurde der Demenzbezug fast immer durch mich hergestellt, basierend auf vorhandenen Erkenntnissen anderer Arbeitsfelder.
Inhaltsverzeichnis
1 EINLEITUNG
1.1 Ausgangspunkt
1.2 Gliederung der Arbeit
2 DEMENZ
2.1 Begriff der Demenz
2.2 Demenz – Herausforderung für das 21. Jahrhundert
2.3 Demenzmodelle
2.3.1 Medizinische Aspekte
2.3.1.1 Äthiologie (Ursachen) der Demenz
2.3.1.2 Prävalenz der Demenz
2.3.1.3 Inzidenz von Demenzerkrankungen
2.3.1.4 Risikofaktoren
2.3.1.5 Die Diagnose der Demenzen
2.3.2 Auswirkungen der Alzheimer-Erkrankung im Krankheitsprozess
2.3.3 Einschätzung des biomedizinischen Krankheitsmodell der Demenz
2.3.4 Soziologische Erklärungen
2.3.5 Sozialpychologische Erklärungen
2.3.6 Citizenship-Ansatz
2.4 Soziale Probleme im Zusammenhang mit Demenz
2.4.1 Exkurs: Gegenstandsdiskussion Sozialer Arbeit und Soziale Probleme
2.4.1.1 Ausstattungs- und Positionsprobleme
2.4.1.2 Austauschprobleme
2.5 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
2.6 Zwischenbilanz
3 MENSCHENWÜRDE
3.1 Bedürfnisse
3.2 Bedürfnisse von Menschen mit Demenz nach Kitwood
3.3 Menschenrechte
3.4 Zwischenbilanz
3.5 Konflikt-Lösungsansatz
3.5.1 Exkurs: Anerkennung und Identität
3.6 Exkurs: Lebensqualität
3.6.1 Zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen und subjektiven Wohlbefinden
3.6.2 Bedürfnisse, Ziele und Wohlbefinden
3.6.3 Gesellschaftliche Aspekte der Lebensqualität
3.6.4 Lebensqualität und Demenz
3.7 Menschenwürdige Lebensperspektiven für Menschen mit Demenz
3.8 Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung
4 SOZIALRAUM – EIN VIELSCHICHTIGER BEGRIFF
4.1 Physikalischer Raumbegriff als Erklärung für unser heutiges Raumverständnis auch in der Sozialen Arbeit
4.2 Sozialraumbegriff und der Nutzen für Menschen mit Demenz
4.2.1 Relationaler Sozialraumbegriff
4.2.2 Perspektive der Betroffenen
4.2.3 Sozialraum von Menschen mit Demenz
4.2.4 Exkurs: Zuhause von Menschen mit Demenz
4.2.5 Das Sozialraumverständnis, das Grundlage für diese Arbeit ist
4.2.6 Sozialraum als Ressource
4.3 Sozialräumliche Handlungsansätze und Arbeitsprinzipien für die Arbeit mit Menschen mit Demenz
4.3.1 Gemeinwesenarbeit
4.3.2 Sozialraumorientierung
4.3.3 Gemeindepsychologische Perspektive
4.3.4 Das Konzept der Community Care als Ergänzung
4.3.5 Die Rolle der Professionellen
5 NETZWERKARBEIT – EINE WICHTIGE RESSOURCE IM UMGANG MIT MENSCHEN MIT DEMENZ
5.1 Sozialkapital
5.2 Netzwerktypen
5.3 Netzwerkanalyse
5.3.1 Vorteile und Nutzen der Netzwerkanalyse
5.4 Soziale Netzwerke im Alter und bei Demenz
5.5 Soziale Netzwerkarbeit/Soziale Vernetzung
5.5.1 Begleitung von Gruppennetzwerken als Aufgabe Sozialer Arbeit
5.5.1.1 Anschubfunktion und Zielgruppenkontakt
5.5.1.2 Information, Beratung, Gründungshilfe
5.5.1.3 Netzwerkmanagement
5.5.1.4 Fortbildung
5.5.1.5 Koordination, Vernetzung bestehender Netze, Organisationsentwicklung
5.5.1.6 Evaluation
6 BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT UND DEMENZ
6.1 Nachbarschaft und die anderen solidaritätsstabilisierenden Institutionen
6.2 Was ist unter bürgerschaftlichen Engagement zu verstehen?
6.3 Stadtteilpolitik, Nachbarschaft
6.4 Motivation für bürgerschaftliches Engagement
6.5 Freiwilligenarbeit mit Menschen mit Demenz
7 ÜBERLEGUNGEN ZUR FINANZIERUNG SOZIALRÄUMLICHER ANSÄTZE IN DER ARBEIT MIT MENSCHEN MIT DEMENZ
8 VISIONEN FÜR EIN MENSCHENWÜRDIGES LEBEN FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ ALS TEIL DER GESELLSCHAFT
8.1 Demenz als kulturelle Variante
8.2 Assistierte Inklusion
8.2.1 Was brauchen nun Assistentinnen?
8.3 Was noch zu tun ist
8.4 Deklaration der Rechte von Menschen mit Demenz
8.5 „Wenn ich groß bin, will ich auch dement sein“
9 FAZIT
9.1 Zusammenfassende Überlegungen
9.2 Abschließende Fragen und Gedanken
10 LITERATURVERZEICHNIS
1 Einleitung
1.1 Ausgangspunkt
Die Ausgangsfrage für diese Arbeit ist, wie ein menschenwürdiges Leben von Men-schen mit Demenz gelingen kann. Es erscheint jedoch sinnvoll genauer zu überlegen was unter Würde zu verstehen ist und welche Bedeutung sie für Menschen mit Demenz hat. Dafür ist es auch bedeutsam, den Begriff der Würde zu beschreiben und wie sie Men-schen mit Demenz ermöglicht werden könnte. Zudem können sich für die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession viel eher Handlungsmöglichkeiten daraus ergeben. Ja, viel-leicht könnte es gerade Aufgabe Sozialer Arbeit sein, den Blick immer wieder unter dem Aspekt der Menschenwürde und der Menschenrechte auf Menschen mit Demenz zu len-ken. Um die Möglichkeiten nicht allein auf das Individuum einzuengen und über traditionel-le Formen der Versorgung (Heimunterbringung oder Betreuung durch Angehörige) hinaus zu denken, ist mir die Diskussion sozialräumlicher Aspekte wichtig. Deshalb sind weitere leitende Fragestellungen: Was leistet der Sozialraum? Wie kann dieser zu einem men-schenwürdigen Leben mit Demenz beitragen? Zu überlegen ist auch, welche sozialräumli-chen Handlungsansätze die Möglichkeiten allgemein und damit auch die Möglichkeiten zur Würde erweitern können.
In der gesamten Arbeit knüpfe ich an theoretische Ressourcen der Jugendhilfe, Be-hindertenarbeit und allgemeinen sozialarbeiterischen und sozialwissenschaftlichen Theo-rien an. Diese beschreibe ich und übertrage sie dann auf das Arbeitsfeld Demenz, weil entsprechende deutschsprachige Literatur, die sich auf Demenz bezieht, bisher nicht exis-tiert. Deshalb wurde der Demenzbezug fast immer durch mich hergestellt, basierend auf vorhandenen Erkenntnissen anderer Arbeitsfelder.
1.2 Gliederung der Arbeit
Nach dem erkenntnistheoretischen Ausblick auf diese Arbeit soll nun einmal ein li-nearer Überblick über die Arbeit gegeben werden. Dies ist aufgrund der Komplexität der Ausführungen durchaus sinnvoll, damit der Gesamtzusammenhang erkennbar wird.
Basis der gesamten Diskussion stellt das bisher vorhandene Wissen über Demenz-erkrankungen dar. In diesem Zusammenhang wird zunächst der Begriff der Demenz er-klärt (Kap. 2) und die Relevanz des Themas verdeutlicht. Daran anschließend werden Zugänge zur Demenz beschrieben, das medizinische Demenz-Konzept ebenso wie so-ziale Erklärungsansätze und diskutiert, was diese jeweils zu leisten vermögen. Die für die Soziale Arbeit im Zusammenhang mit der Demenz möglicherweise entstehenden sozi-alen Probleme werden beispielhaft benannt und erläutert, um erste Ansatzpunkte für sozi-alarbeiterisches Handeln erkennbar zu machen. Dazu erweist es sich als sinnvoll, anschließend auf Grundlage der von der IFSW (International Federation of Social Workers) herausgegebenen Definition zu diskutieren, was Soziale Arbeit ist. Es bietet sich da-bei an, schon ein wenig den folgenden Kapitel vorzugreifen, indem ethische Prinzipien Sozialer Arbeit erklärt werden und die sozialarbeiterische Tätigkeit auf eine menschen-rechtliche Basis gestellt wird.
Um Möglichkeiten einer menschenwürdigen Lebensperspektive zu diskutieren, ist es zudem unabdingbar, sich dem Würdebegriff (Seite 25 ff.) anzunähern und zu überle-gen, was Würde bedeutet, und welche Instrumente es zur Verwirklichung gibt. Es kann angenommen werden, dass die Menschenrechte die Würde sichern sollen. Die Menschen-rechte wiederum dienen dem Schutz und der Realisierung menschlicher Bedürfnisse. Zu-dem ist untersucht, dass Menschen sich in einem Zustand des Wohlbefindens befinden, wenn ihre Bedürfnisse weitestgehend verwirklicht sind (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 282). Deshalb erfolgt der Zugang zur Würde von Menschen mit Demenz über die Bedürf-nistheorie Obrechts (Seite 26 ff.). Konkret werden zudem die psychischen Bedürfnisse von
Menschen mit Demenz herausgestellt und diskutiert, da diese vielfach vernachlässigt wer-den. Mit den beiden Kapiteln zu Demenz und zur Würde ist der Ausgangspunkt für die Überlegung geschaffen, wie ein menschenwürdiges Leben mit Demenz gelingen kann.
Um den herkömmlichen, medizinisch geprägten und überwiegend individuum-zentrierten Horizont Chancen zur Erweiterung zu bieten, wähle ich eine sozialräumliche Herangehensweise (v. a. Kap. 4). Der Sozialraum und sozialräumliche Strategien erwei-sen sich als sehr vielfältig, und es kann keine einheitliche Definition von Sozialraum er-kannt werden. Aus diesem Grund diskutiere ich verschiedene Aspekte des Sozialraums und stelle die jeweiligen Möglichkeiten heraus, die mit ihm verbunden sind. Ein Exkurs be-schäftigt sich mit einer Ausführung zum Zuhause von Menschen, da „zu Hause sein“ und „nach Hause wollen“ für Menschen mit Demenz häufig Thema ist. Daneben kann Zuhause (sowohl als symbolischer Ort als auch physischer Raum) Teil des Sozialraums sein. Bei dieser Diskussion werde ich (wie bereits erwähnt) überwiegend auf Literatur aus der Ju-gendhilfe zurückgreifen, weil dort bereits vielfach sozialräumlich gearbeitet wird, während in der Arbeit mit älteren Menschen (insbesondere solchen mit Demenz) die Sozialraumori-entierung bislang kaum eine Rolle spielt und auch Soziale Arbeit dort weniger häufig anzu-treffen ist.
In diesem Kapitel werden zudem sozialräumliche Strategien skizziert, um erste Möglichkeiten für sozialräumliches Handeln aufzuzeigen. In den beiden darauf folgenden Kapiteln werden die Möglichkeiten sozialräumlichen Handelns weiter ausgeführt: Durch die Möglichkeiten, die soziale Netzwerke (Kap. 5) und bürgerschaftliches Engagement (Kap. 6,) bieten. Anschließend werden Chancen des bürgerschaftlichen Engagements – das vielfach in Netzwerken organisiert ist – für Menschen mit Demenz beleuchtet. Diese beiden Diskussionsflächen besitzen immer eine sozialräumliche Komponente, sind inner-halb eines Sozialraums verankert und stehen in Wechselbeziehung mit räumlichen Gege-benheiten.
Wie sozialräumliche Arbeitsweisen Sozialer Arbeit zur Verwirklichung der Würde von Menschen mit Demenz finanziert werden könnten, wird kurz überlegt (Kap. 7). Es geht nicht darum, einen fertigen Finanzierungsvorschlag zu liefern, sondern zum Weiterdenken anzuregen. Dieser kurze Abschnitt fungiert als Ergänzung des Vorangestellten.
Abschließend entwerfe ich unter Anwendung der Methode des Brainstorming (vgl. Clark 1989) eigene Ideen dafür, was getan werden könnte, um für Menschen, die der „demenziellen“ Kultur angehören, ein menschenwürdiges Leben zu gestalten und was un-ternommen werden kann, um für sie einen Sozialraum zu erschließen oder ihre eigenen, vorhandenen Sozialräume zu erhalten (Kap. 8, Seite 66 ff.). Es geht dabei keineswegs um ein ausgereiftes Konzept, sondern um erste Vorschläge, die hier zur Diskussion gestellt werden sollen. Dabei vollziehe ich zuletzt einen Perspektivwechsel von dem, was für Men-schen mit Demenz getan werden kann, zu den Rechten und Ansprüchen, die Menschen mit Demenz haben. Damit wird auch wieder der Bogen zu den ab Seite 32 aufgeführten Menschenrechten gespannt und der Citizenship-Ansatz (vgl. S. 17) erneut aufgegriffen.
2 Demenz
2.1 Begriff der Demenz
Der Begriff der Demenz kommt aus dem Lateinischen: „de“ bedeutet so viel wie „weg“; „mens“ kann mit Geist, Verstand übersetzt werden. Gemeint ist also ein Verlust der geistigen Fähigkeiten, die den Menschen hinsichtlich seiner Intelligenz, wie auch seiner Person verändern (Falk, 2004, S. 32). Die Demenz zählt zu den häufigsten und folgen-reichsten Erkrankungen des Alters neben Depressionen und Ängsten (Weyerer, 2005, S. 7, Schulz-Hausgenoss, 2004, S. 27).
2.2 Demenz – Herausforderung für das 21. Jahrhundert
Etwa 1,2 Millionen Menschen mit Demenz leben derzeit in Deutschland (vgl. BMFSFJ 2006, S. 5). Mit der steigenden Zahl älterer Menschen (Kondratowitz 1999) nimmt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen, speziell auch der Menschen mit Demenz eine Größenordnung an, die bislang menschheitsgeschichtlich völlig neu ist (vgl. Dörner 2007, S. 12 ff.). Im Jahre 2050 haben wir bereits mit 2,3 Mio. (Bickel 2006, S. 1) demenz-kranken Menschen zu rechnen. Das sind etwa doppelt so viele wie heute (Bickel 2006, S. 1 f.) und entspricht etwa 2 % der Gesamtbevölkerung.
Die Mehrheit dieser Menschen wird zu Hause betreut. Die Erkrankung stellt eine hohe Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen dar (vgl. Seite 17 ff. zu sozialen Problemen). Wie kann die Lebenssituation dieser Menschen, besonders die der Betroffe-nen verbessert werden? Allen Fortschritten der Demenzforschung zum Trotz kann nicht auf einen wissenschaftlichen Durchbruch gewartet werden, der zurzeit auch nicht in Sicht ist. Bereits jetzt müssen passende Hilfs- und Versorgungskonzepte bereitgehalten werden, um Betroffene und deren Familien in angemessener Weise zu begleiten (vgl. BMFSFJ 2006, S. 6). Denn auch das Leben mit Demenz hat eine Würde, die es anzuerkennen gilt. Ein wichtiger Faktor für die Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Demenz ist die Einbindung aller Bürgerinnen, damit längerfristig Ängsten und daraus re-sultierender Ausgrenzung entgegengewirkt werden kann. Denn: „Die Gesellschaft der Zu-kunft wird auch eine Gesellschaft mit Demenz sein“ (BMFSFJ 2006, S. 6). Dies erfordert insbesondere eine Toleranz gegenüber dieser gänzlich anderen Lebensform. Dazu könnte Demenz als eine „Zivilisation zweiter Ordnung“ angesehen werden, die sich zwar unseren im Laufe der Biographie erlernten Kulturtechniken und kulturellen Normen (z. B. Essver-halten) entzieht, jedoch eine gleichberechtigte Anerkennung verdient (vgl. Dörner 2007; Klie 2002b, S. 69 f.).
Demenz stellt nicht ein fernes Szenario dar, sondern geht uns alle an: Fast jede ist bereits heute mittel- oder unmittelbar von der Thematik betroffen, hat eine Angehörige (E-hepartnerin, Mutter, Großmutter), die an einer Demenz erkrankt ist oder kennt wenigstens jemanden, der mit einem Menschen, der an einer Demenz erkrankt ist, zu tun hat. Zudem können generell alle älteren Menschen davon betroffen werden (Klie 2002b, S. 66).
All diesen Menschen die Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben zu verweigern und ihre Menschenrechte und sozialen Bedürfnisse nicht zu berücksichtigen, kann dabei kaum als menschenwürdig angesehen werden.
Die Gruppe älterer Menschen ist jedoch keineswegs eine homogene Gruppe, son-dern auch hier können die allgemeinen Differenzierungs- und Heterogenisierungsprozesse wahrgenommen werden (vgl. Kondratowitz 1999, S. 247). Dementsprechend kann abge-leitet werden, dass es auch nicht DIE Menschen mit Demenz gibt, sondern eine Vielfalt demenzieller Ausprägungen besteht. Diese Vielfalt ist nicht allein durch die Erkrankung an sich bedingt, sondern steht auch im Zusammenhang mit unterschiedlichen Persönlich-keitsstrukturen, Lebensformen u. Ä.
Pflegequalität wird zwar als ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität von Menschen mit Demenz angesehen (vgl. BMFSFJ 2006, S 6). Jedoch lässt sich daraus noch lange nicht ableiten, dass gute Pflege – die durchaus wichtig ist – allein für ein men-schenwürdiges Leben ausreicht.
Aufgrund der Tatsache, dass es zukünftig noch weit mehr Menschen mit Demenz geben wird, lohnt es sich auch gesamtgesellschaftlich, darüber nachzudenken, wie ihnen ein menschenwürdiges Leben als Teil der Gesellschaft ermöglicht werden kann, wie Fä-higkeiten, Bedürfnisse berücksichtigt und auch die Rechte der Betroffenen stärker in den Blickpunkt gerückt werden. Die Aufgabe, wie wir mit Demenz kranken Menschen umgehen wollen, stellt deshalb eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar.
2.3 Demenzmodelle
Welche Erklärungen es für die Demenz als zunehmend auftretendes Phänomen gibt, soll im Folgenden ausgeführt werden. Medizinische Erklärungen kennzeichnen das gängige Paradigma. Gerade für die Soziale Arbeit sind jedoch auch soziologische und so-zialpsychologische Erklärungen relevant, die ab Seite 15 erörtert werden.
2.3.1 Medizinische Aspekte
Dem biomedizinischen Krankheitsbegriff liegt ein lineares Denken zugrunde: Ein Auslöser führt durch seine Schädigung zu einer Organveränderung, die schließlich be-stimmte Krankheitssymptome produziert (vgl. Waller 2002, S. 16 ff.). Bei der Demenz be-deutet dies, dass eine oder mehrere bislang nicht bekannte Ursachen zu neuropathologischen Veränderungen führen, die sich in spezifischen Symptomen zeigen und einen vorhersehbaren Verlauf haben. Demnach ist Demenz als ein Muster von Sym-ptomen zu verstehen, das bei Erkrankungen des Gehirns (neurodegenerative Erkrankun-gen) auftreten kann, wenn eine Schädigung oder Zerstörung von Nervenzellen stattfindet. Kennzeichen für dieses Syndrom ist ein allmählich fortschreitendes Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Orientierung, Denkvermö-gen, Sprache), mit der eine Beeinträchtigung bei den Alltagsaktivitäten einhergeht. Zunächst sind dabei komplexe Aufgaben betroffen, später immer einfachere, wie z. B. Aufnahme von Nahrung u. Ä. (vgl. Alzheimer Europe 2005, S. 1).
2.3.1.1 Äthiologie (Ursachen) der Demenz
Unterschiedliche Krankheiten können zu einer Demenz führen. (vgl. Alzheimer Europe 2005, S. 1). Grundsätzlich kann unterschieden werden zwischen
- primären Demenzen; diese werden durch direkte Hirnschädigung verursacht, sie ge-hen also direkt vom Gehirn aus. Bei den primären Demenzen – deren Ursache eigen-ständige Hirnerkrankungen sind – kommen vor allem degenerative (Alzheimer-Demenz) und vaskuläre (die Gefäße betreffend) Veränderungen in Frage. Für diese Demenzformen gilt, dass sie bislang irreversibel sind.
- sekundären Demenzen, die Folge einer anderen Erkrankung (z. B. Tumor, Vitamin-B12-Mangel, Multiple Sklerose, Infektionen u. a.) sind. Sie sind teilweise reversibel, d. h. sie können bei erfolgreicher Behandlung der Grunderkrankung wieder weitgehend abklingen.
(vgl. Falk 2004, S. 38 f.).
Aufgrund der verschiedenen Ursachen, die zu einer Demenz führen können, ergibt sich ein sehr vielschichtiges klinisches Bild und ein unterschiedlicher Verlauf (vgl. Hauser 2005, S. 19).
Hier soll lediglich auf die primären Demenzen eingegangen werden, da sie wesent-lich häufiger auftreten. Zudem sind deren Ursachen nicht behandelbar und deshalb muss mit den langfristigen Konsequenzen umgegangen werden. Das bedeutet, dass Soziale Arbeit hier neben der Medizin – gerade weil die Ursachen nicht beseitigt werden können – einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Häufigste Ursache der primärer Demenzen ist die Alzheimer-Krankheit [ca. 50-70 % der Demenzen (vgl. Falk 2004, S. 39, Alzheimer Europe 2005, S. 1, Kruse & Gaber, 2002, S. 18)]. Dem folgen Krankheiten der Blutgefäße (vaskuläre Demenzen) mit ca. 10-20 % (vgl. Alzheimer Europe 2005, S. 1, Kruse & Gaber 2002, S. 18), die die Blutver-sorgung des Gehirns einschränken und dadurch Gewebeuntergänge (Hirninfarkte) her-vorrufen (vgl. Alzheimer Europe 2005, S. 1). Bei alten Menschen sind Alzheimer-Krankheit und vaskuläre Demenz häufig miteinander kombiniert und treten bei ca. 20 % der Erkrankungsfälle als Mischformen auf (Kruse & Gaber 2002, S. 19). Alle übrigen Ur-sachen primärer Demenzen sind äußerst selten: Pick-Krankheit (Frontotemporale De-menz), Creutzfeld-Jakob-Krankheit, Chorea-Huntington-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Lewy-Körper-Krankheit. Diese sollen hier nicht weiter diskutiert werden, denn sie sind gemessen an der Gesamtzahl der Demenzen eher unbedeutend (vgl. Alzheimer Europe 2005, S. 1).
Die folgende Abbildung 1 veranschaulicht den prozentualen Anteil von Demenzur-sachen. Zur Vereinfachung wurden mittlere Werte herangezogen und gerundet (Quellen: Alzheimer Europe 2005, S. 1 ff., Hirsch & Holler 1999, S. 24; Kruse & Gaber, 2002, S. 19; Hauser 2005, S. 16; Stoppe 2007, S. 12. ff.)
Abbildung 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Alter an sich ist keine Ursache für eine Demenz, doch steigt das Risiko an ei-ner Demenz zu erkranken mit zunehmendem Alter deutlich.
2.3.1.2 Prävalenz der Demenz
Die Prävalenz ist definiert als Häufigkeit der Krankheitsfälle (neu Erkrankte und be-reits länger Kranke) einer bestimmten Krankheit pro Zeiteinheit und Bevölkerungsgruppe (vgl. Waller 2002, S. 40).
Bislang gibt es kaum gesicherte Daten über die Prävalenz der demenziellen Krankheitsfälle. In internationalen Studien schwanken die Werte der Prävalenz sehr stark, da es keine klar definierten Kriterien zur Abgrenzung leichter kognitiver Störungen zum frühen Stadium der Demenz gibt (vgl. Hauser 2005, S. 9 f.). Bickel (2001, S. 109) gibt die Gesamtprävalenz im Mittel mit eine Rate von 7,2 % für die Altersgruppe über 65 Jahre an.
Lediglich zur Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT) gibt es eine relativ gute Datenla-ge, da nur hier ein Konsens über diagnostische Kriterien besteht. Bei der vaskulären De-menz (VaD) hingegen ist die Falldefinition weniger präzise und damit auch die Datenlage weniger umfangreich (vgl. Stoppe 2007, S. 12).
Es zeigt sich einerseits, dass Frauen eine leicht erhöhte Prävalenz (0,1 – 3,2) (Weyerer 2005, S. 13) aufweisen, an einer Demenz zu erkranken. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass diese älter werden, es also in dieser Altersgruppe aufgrund der höheren Lebenserwartung mehr Frauen als Männer gibt. Andererseits wird – unabhängig von den Abweichungen zwischen verschiedenen Studien – offensichtlich, dass die Prävalenz mit zunehmendem Alter steigt. (Abweichende Daten zwischen den Einzelnen Definitionen könnten auf unterschiedlichen Diagnose-Kriterien oder ungleichen Erhebungsmethoden beruhen.)
2.3.1.3 Inzidenz von Demenzerkrankungen
Mit der Inzidenz wird die Rate der Neuerkrankungen an einer bestimmten Erkran-kung pro Jahr beziffert. Sie ist unbeeinflusst von der Krankheitsdauer. In den meisten Studien wird die Inzidenz für demenzielle Erkrankungen in der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen mit 1,5 – 2% angegeben (Hauser 2005, S. 10). Damit erkranken in Deutschland jährlich ca. 200.000 Menschen neu an einer Demenz (Weyerer 2005, S. 15).
Alzheimer-Krankheit und Alter:
Mit steigendem Lebensalter tritt die neurodegenerative Erkrankung vom Typ „Alzheimer“ häufiger auf. Von 1 % bei den 60-64-Jährigen steigt die Prävalenz auf 35 % bei den über 90-Jährigen (vgl. Stoppe 2007, S. 13). Die Inzidenz (Neuerkrankungsrate) steigt ebenfalls: von 0,36 % pro Jahr bei den 60- bis 64-Jährigen auf 0,66 % bei den über 90-Jährigen (vgl. Stoppe 2007, S. 13).
Auch der prozentuale Anteil der Alzheimer-Demenz an demenziellen Erkrankungen insgesamt steigt mit zunehmendem Alter. Somit ist die Wahrscheinlichkeit des Auftritts einer DAT (Demenz vom Alzheimer-Typ) umso höher, je älter ein Mensch ist (Stoppe, 2007, S. 13). Damit kann das Alter als größter Risikofaktor angesehen werden, an einer Demenz zu erkranken (Hauser 2005, S. 10).
2.3.1.4 Risikofaktoren
Risikofaktoren für die Demenz vom Alzheimertyp
Als sicherster Risikofaktor, an einer Alzheimer-Demenz zu erkranken, wird also, wie erwähnt, das höhere Lebensalter angesehen.
Ein erhöhtes Risiko (mindestens dreimal so hoch wie der Durchschnitt) besteht e-benso, wenn in direkter Verwandtschaft (Geschwister, Eltern) eine Demenz aufgetreten ist (Stoppe 2007, S. 17). Mutationen (Abwandlungen der Erbinformationen) verschiedener Chromosomen (1, 14, 21) konnten als genetische Faktoren lokalisiert werden (Alzheimer Europe 2005, S. 2, Stoppe 2007, S. 17). Sie führen zu einer vermehrten Produktion oder Ablagerung von Amyloid im Gehirn (vgl. Kurz & Diehl 2003, S. 10). Diese erbliche Form der Alzheimer Krankheit ist durch frühes Einsetzen (vor dem 65. Lebensjahr) und einen raschen Krankheitsverlauf gekennzeichnet (vgl. Alzheimer Europe 2005, S. 2). Häufiger ist jedoch eine Alzheimer-Variante mit Beginn nach dem 65. Lebensjahr. Hier spielen die-se erblichen Faktoren keine Rolle (vgl. Kurz & Diehl 2003, S. 11).
Bei den nicht-genetischen Faktoren wird u. a. der Einfluss von (Schul-)Bildung diskutiert. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, da mit Bildung auch ein anderer Lebensstil einhergeht und neuropsychologische Tests u. U. anders bearbeitet werden. So ist festzu-stellen, dass Menschen mit höherer Bildung zwar zeitlich später erkranken, aber bei Er-krankungsbeginn neurobiologisch fortgeschrittenere Befunde aufzeigen. Dies deutet lediglich auf einen späteren Zeitpunkt des Krankheitsbeginns hin, weniger auf einen prä-ventiven Effekt von Bildung (vgl. Stoppe 2007, S. 18 f.). Wahrscheinlich können Men-schen mit höherer Bildung die krankheitsbedingten Ausfälle länger kompensieren.
Mäßiger Alkoholgenuss kann als Risikofaktor weitestgehend ausgeschlossen werden (Kurz & Diehl 2003, S. 14). Allerdings kann erhöhter Alkoholkonsum zur Alkohol-demenz führen (nutritiv-toxisch oder metabolisch verursachte Demenzen [vgl. Weyerer 2005, S. 8]). Das Rauchen wird unterschiedlich bewertet (vgl. Stoppe 2007, S. 19, Kurz & Diehl 2003, S. 12).
Als weitere Risikofaktoren werden zwar diskutiert, können aber weitestgehend ausgeschlossen werden:
- Weibliches Geschlecht: Die häufigere Betroffenheit von Frauen lässt sich auf die un-terschiedliche Lebenserwartung und (Ko-)Morbidität zurückführen.
- Depressionen können eher als ein frühes Zeichen, denn als Risiko bewertet werden. Sie stellen außerdem eine vielfache Differentialdiagnose dar.
- Auch der Einfluss von Ernährung erscheint nicht besonders wahrscheinlich (vgl. Stoppe 2007, S. 19).
Zwischen den einzelnen Risikofaktoren (Gene, Bildung, sozioökonomischer Status, Ernährung, Aktivität, Umwelt) können Wechselbeziehungen festgestellt werden. Mögli-cherweise werden bestimmte Risikofaktoren nur in bestimmten Lebensabschnitten, bei einer bestimmten Dauer oder in Kombination mit anderen Faktoren wirksam (vgl. Stoppe 2007, S. 18).
Risikofaktoren für vaskuläre Demenzen
Vaskuläre Demenzen werden durch Erkrankungen der Hirngefäße verursacht (vgl. Hauser 2005, S. 18). Bei diesen Formen der Demenz existiert eine weniger gesicherte Daten-lage (Stoppe 2007, S. 20). Der einzig gesicherte und sehr bedeutende Risikofaktor stellt die arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) dar. Daneben werden Diabetes mellitus, Hyperli-pidämie (bei Übergewicht), Rauchen und extremer Alkoholkonsum als Risikofaktoren dis-kutiert (vgl. Kruse & Gaber 2002, S. 19), also Faktoren mit schädigendem Effekt der Blutgefäße.
2.3.1.5 Die Diagnose der Demenzen
ICD und DSM
Die für Demenzen im internationalen Kontext entwickelten Kriterien sollen kurz um-rissen werden. Die diagnostischen Kriterien für ein Demenz-Syndrom sind durch die DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen, 5. Ausgabe) und die ICD-10 (International Classification of Deseases 10, Internationale Klassifikation für Krankheiten und Todesursachen, 10. Revision) operationalisiert (vgl. Weyerer 2005, S. 32.
Beide Klassifikationen ähneln sich sehr stark, sodass sie an dieser Stelle zusam-mengefasst dargestellt werden sollen.
Kriterien sind:
1. Beeinträchtigungen des Gedächtnisses (die Fähigkeit, neue Informationen zu verarbeiten und erlernte Inhalte abzurufen ist vermindert)
2. mindestens eines der folgenden Störungsbilder
- Sprachstörung (Aphasie)
- Eingeschränkte Fähigkeit Bewegungen auszuführen, obwohl die Bewegungs-funktionen intakt sind (Apraxie)
- Schwierigkeiten, Dinge und Sachverhalte (wieder)-zuerkennen bzw. zu benen-nen, obgleich die sensorischen Funktionen vorhanden sind (Agnosie)
- Eingeschränkte Fähigkeit zu planen, zu organisieren, Reihenfolgen einzuhalten, zu abstrahieren (Störungen der Exekutivfunktionen)
Weiterhin müssen diese kognitiven Defizite aus Bereich 1. und 2. die soziale und berufliche Funktionsfähigkeit beeinträchtigen und eine Verschlechterung zum vor-herigen Leistungsniveau darstellen. Die Auffälligkeiten müssen mindestens 6 Mona-te bestehen (vgl. Stoppe 2003, S. 24).
Diagnose der Alzheimer Demenz
Um die Differentialdiagnose „Alzheimer-Erkrankung“ zu stellen, müssen weitere Kri-terien erfüllt sein:
Die Kriterien für die Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT) sind nach der ICD-10 und der DSM-IV als Ausschlussdiagnose definiert (vgl. Stoppe, 2006, S. 39). Neben den o-ben angeführten Kriterien, ist für die Demenz vom Alzheimer Typ ein schleichender, all-mählicher Beginn mit leichten Gedächtnisstörungen und fortschreitender Verschlechterung kennzeichnend (vgl. Weyerer 2005, S. 8; Hauser 2005, S. 17). Damit
von einer Alzheimererkrankung ausgegangen werden kann, muss ausgeschlossen wer-den, dass die kognitiven Einbußen nicht zurückgeführt werden können auf:
- eine andere Krankheit des zentralen Nervensystems, die fortschreitende Gedächtnis-einbußen verursacht (z. B. Hirntumore, subdurale Hämatome [Blutergüsse])
- systemische Erkrankungen, welche eine Demenz bewirken können (z. B. HIV-Infektion)
- Durch toxische Substanzen verursachte Erkrankungen (z. B. Alkoholgebrauch, der zum Korsakoff-Syndrom führen kann) (vgl. Stoppe, 2006, S. 39)
- Eine Depression. Im Zweifel sollte zunächst eine Behandlung des depressiven Syn-droms erfolgen, um festzustellen, ob mit der Stimmungsaufhellung die kognitiven Stö-rungen nachlassen (vgl. Gutzmann 2003, S. 84).
Tritt die Erkrankung bereits vor dem 65. Lebensjahr auf, spricht man von einem präsenilen Beginn. Beginnt die Erkrankung erst nach dem 60 bzw. 65. Lebensjahr – in der Regel im Rentenalter – spricht man von senilem Beginn.
Schon zu Beginn der Erkrankung ist die Aufmerksamkeitsleistung beeinträchtigt. Frühe Kennzeichen einer Demenz vom Alzheimer-Typ können sein: Konzentrationsprob-leme, Gefühl der Überforderung und rasche Erschöpfbarkeit. Auch depressive Verstim-mungen, Antriebsarmut, Interesselosigkeit und unklare Ängst e können frühe Anzeichen einer Demenz sein (vgl. Stoppe, 2006, S. 36 f).
Diagnostische Instrumente
Um die Diagnose „Demenz“ zu stellen ist eine ausführliche ärztliche Diagnostik er-forderlich. Diese umfasst:
- Die Eigenanamnese und
- Fremdanamnese (Angehörige), die Fragen nach Gedächtnis, Orientierung, Alltagsak-tivitäten, früherer Leistungsfähigkeit und depressiven Symptomen einschließt
- Eine allgemeine körperliche Untersuchung
- Eine neurologische Untersuchung
- Den psychopathologischen Befund
- Testpsychologische Untersuchungen zur Feststellung der Leistungsfähigkeit, wie bei-spielsweise der Minimal-Mental-Status-Test (MMST), bei dem die kognitiven Funktio-nen erhoben werden.
- Laborparameter
- Elektrokardiogramm (EKG)
- Elektroenzephalogramm (EEG)
- Kraniales Computertomogramm (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) (vgl. Weyerer 2005, S. 9; Stoppe 2007, S. 50 ff.)
Zweck dieser Untersuchungen ist es vornehmlich, jene Ursachen der Demenz, die behandelt werden können, auszuschließen oder zu erkennen (vgl. Weyerer 2005, S. 9). Bisher konnten aus diesen Forschungen zur Demenz keine ursächlich ansetzenden therapeutischen Interventionen abgeleitet werden (vgl. Stoppe 2007, S. 25), mit denen die Demenz geheilt werden kann. Die Wirkung der derzeit auf dem Markt erhältlichen Antide-mentiva erzielen äußerst geringe Effekte. Negativergebnisse werden vielfach unterdrückt (Arznei-Telegramm 2007, S. 59). Deshalb empfiehlt z. B. das britische National Institut for Clinical Excellence (NICE) die gängigen Alzheimermittel Memantin, Galantamin, Rivastig-min und Donepezil nicht mehr durch den National Health Service zu bezahlen. Denn es konnte nicht festgestellt werden, dass diese Medikamente einen relevanten Einfluss auf die Lebensqualität haben (Arznei-Telegramm 2005, S. 31).
2.3.2 Auswirkungen der Alzheimer-Erkrankung im Krankheitsprozess
Die genannten Symptome (Seite 11) der Demenz gehen also weit über den Verlust rein geistiger Fähigkeiten hinaus und beeinflussen Wahrnehmung, Verhalten und Erleben der Betroffenen.
Ereignisse und Dinge besitzen in der Welt der Menschen mit Demenz häufig eine andere Bedeutung als in der Welt der so genannten „Gesunden“. Da sich die Betroffenen nur im Anfangsstadium sprachlich mitteilen können, müssen die Bezugspersonen später versuchen, sich in die Situation des kranken Menschen einzufühlen. Ein Schlüssel zum Verständnis für Verhaltensweisen lässt sich dabei in der Biografie des Betroffenen finden (vgl. BMG 2005, S. 24 f). Nahe Angehörige können hier wichtige Hinweise geben, einer-seits was das Verständnis von Verhaltensweisen betrifft, andererseits hinsichtlich der Wünsche und Einstellungen des Menschen mit einer Demenzerkrankung. Wichtig er-scheint es, auf einer Gefühls-Ebene zu kommunizieren, indem man sich in die Gefühlswelt des Demenzkranken hineinversetzt (vgl. Trilling et al. 2001, S. 25).
Zu Beginn der Krankheit steht in der Regel eine Verminderung der Merkfähigkeit im Vordergrund. Meist merken die Betroffenen den Verlust ihrer Fähigkeiten schneller als das Umfeld. Sie geraten häufig durcheinander, fühlen sich beschämt und verlegen. Ihre Ver-gesslichkeit versuchen sie z. B. durch Zurückhaltung in Gesprächen zu vertuschen und ziehen sich deshalb nicht selten zurück (BMG 2005, S. 34). Als Reaktion auf kognitive Probleme entwickeln Menschen mit einer Demenzerkrankung häufig depressive Sympto-me (vgl. Weyerer 2005, S. 16).
Schreitet die Krankheit weiter fort, sind den Betroffenen ihre Gedächtnisstörun-gen in der Regel nicht mehr bewusst. Dennoch leiden sie weiter an den indirekten Folgen, besonders dem Verlust der Unabhängigkeit. Durch den fortschreitenden Gedächtnisabbau gehen auch bereits eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses verloren. Daraus resul-tiert, dass erworbene Fähigkeiten abnehmen und das Sprachvermögen nachlässt. Schließlich kann auch das Wissen über die eigene Person verloren gehen und damit die eigene Identität (BMG 2005, S. 26,).
Der Verlust der Urteilsfähigkeit und des Denkvermögens bewirkt weiter, dass Ein-drücke und Informationen nicht mehr mithilfe des Verstandes geordnet und verarbeitet werden und keine logischen Schlussfolgerungen mehr getroffen werden können. Deshalb werden Erklärungen gegenüber dem demenzkranken Menschen, die auf Logik beruhen, nicht verstanden.
Beispiel: Ein demenzkranker Mensch will nicht mehr richtig essen. Es ist wenig hilf-reich, den Betroffenen mit logischen Argumenten zu überzeugen, z. B. „Wenn du nicht genügend isst, wirst du krank!“. Stattdessen sollte den Betroffenen liebevoll begegnet werden und auf ihr besonderes Essverhalten Rücksicht genommen wer-den. Hierzu gehört z. B. das Angebot von „Fingerfood“. Das ist Nahrung, die im Vo-rübergehen mit den Fingern aufgenommen und in den Mund gesteckt werden kann, ohne dass Hilfsmittel wie Messer und Gabel benutzt werden müssen (vgl. Schwerdt 2004, S. 87, Wellerdiek 2005, S. 23 ff.).
Ebenso wenig können Menschen mit Demenz Fragen nach Gründen für ein be-
stimmtes Verhalten und für Gefühlsäußerungen beantworten. Logische Argumente helfen auch hier nicht weiter. Sinnvoller ist es, den Betroffenen auf der Gefühlsebene anzuspre-chen, Verständnis für seine Situation zu zeigen und gleichzeitig zu beruhigen, z. B empa-thisch auf ihn einzugehen. Denn bei einer demenziellen Erkrankung lassen zwar Denk-und Erinnerungsvermögen nach, doch Erlebnisfähigkeit und Gefühlserleben bleiben bis zum Tod erhalten (vgl. BMG 2005, s. 29 f.).
Beispiel1: Frau Kunze besucht mit einer Gruppe ebenfalls an Demenz erkrankter Frauen eine Ausstellung im historischen Museum. Das Museum ist ziemlich spärlich beleuchtet, die Räume überwiegend ohne Tageslicht, Gegenstände werfen Schat-ten, Ausgänge sind nicht leicht zu finden. Von Anbeginn wirkt Frau Kunze leicht be-unruhigt. Schließlich äußert sie aufs höchste irritiert: „Das ist doch alles nicht richtig!“ „Das darf man nicht!“ „Was soll das hier?“ „Da stimmt doch etwas nicht!“. Eine der beiden begleitenden Gruppenleiterinnen versuchte Frau Kunze abzulen-
ken: „Ach, schauen Sie mal da drüben, was es da interessantes gibt.“ „Wollen Sie nicht mal schauen?“ Durch diese Einwürfe steigerte sich ihre Beunruhigung eher noch. Jetzt greift die zweite Begleiterin ein: Sie fasst behutsam am Ellenbogen und Unterarm. „Ich bleibe bei Ihnen und bringe sie sicher wieder nach Hause.“ Frau Kunze beruhigte sich und der Museumsbesuch konnte in dieser schützenden Be-gleitung fortgesetzt werden. – Die entscheidende Unterstützung für Frau Kunze be-stand darin, die Bedürfnisse nach Sicherheit und Orientierung zu erkennen und durch vor allem emotionale Gesten darauf einzugehen.
Der Verlust der Kompetenzen kann deshalb als besonders schmerzlich erlebt wer- den, weil nicht mit dem Verstand regulierend auf die Gefühle eingewirkt werden kann. So fehlt die Erinnerung an ähnliche Situationen, die erfolgreich bewältigt wurden und damit auch die Hoffnung, dass es wieder bessere Zeiten geben wird (vgl. BMG 2005, S. 39).
Zunehmend verliert die Wirklichkeit ihren Sinn, mit einfachen Gegenständen (wie Bleistift, Besteck, Teller, Zahnbürste) kann nichts mehr angefangen werden und Tätigkei-ten des Alltags (z. B. Nahrungsaufnahme) können nicht mehr selbständig bewerkstelligt werden (vgl. BMG 2005, S. 26 ff).
Im fortgeschrittenen Stadium der Demenz nehmen auch die Kommunikations-möglichkeiten immer weiter ab. Im emotionalen Bereich sind dennoch Fähigkeiten vorhan-den. Z. B. emotionale Stimmungen wahrnehmen. Auch die Bereitschaft, auf Außenreize zu reagieren wird durch nachlassende kognitive Fähigkeiten nicht aufgehoben. Selbst wenn die Aussagen von Menschen mit Demenz für ihre Mitmenschen häufig unverständlich wir-ken und nur einfühlend interpretiert werden können, so wird doch angenommen, dass die „emotionale Kontaktfähigkeit bis zum Lebensende erhalten“ (Weyerer 2005, S. 16) bleibt.
Hilfreich ist in der Regel ein Leben in vertrauter Umgebung und mit konstanten Be-zugspersonen (vgl. Weyerer 2005, S. 16).
2.3.3 Einschätzung des biomedizinischen Krankheitsmodell der Demenz
Das (bio-)medizinische Erklärungsmodell ist in der fachlichen Diskussion vorherr-schend, wenn es um die Annäherung an das Phänomen der Demenz geht. Nicht zuletzt wird dies dadurch bewirkt, dass es klar und einleuchtend wirkt und medizinische Erklärun-gen gesellschaftlich allgemein sehr angesehen sind. Die Diagnose ist auch als Vereinba-rung unter Fachleuten hilfreich. Zwar ist dieser Erklärungsansatz gerade aufgrund der Linearität sehr einleuchtend, jedoch kann er kaum dem gesamten Erscheinungsbild ge-recht werden. Denn es können z. B. beträchtliche neuropathologische Veränderungen vor-liegen, ohne dass gleichzeitig eine klinisch relevante Demenz besteht. Genauso wie eine Demenz ohne charakteristische Neuropathologie bestehen kann (vgl. Kitwood 2005, S. 60 ff.). Das Maß der Beeinträchtigung bildet sich nämlich nicht unbedingt in den neuropatho-logischen Veränderungen ab und umgekehrt.
Neben der Möglichkeit, sich durch die Diagnosestellung auf die Erkrankung einstel-len zu können – was jedoch meist auch Unterstützung voraussetzt – ist eine Diagnose auch deshalb wichtig, weil sie wenigstens einen Teil des Verhaltens von Menschen mit Demenz erklärt. Das kann Angehörigen helfen, das veränderte Verhalten des Menschen mit Demenz zu verstehen und besser damit umgehen zu können.
Für die Sozialarbeiterinnen ist das Wissen über medizinische Erklärungen aus zwei-erlei Gründen wichtig: Erstens ist ein Grundwissen an medizinischen Erklärungen für den Austausch im multiprofessionellen Team wichtig (z. B. um mit Ärztinnen2 zu kommunizie-ren). Zweitens kann es hilfreich sein, die Anzeichen für eine Demenz zu erkennen, wenn man in der sozialarbeiterischen Praxis mit älteren Menschen in Kontakt kommt.
2.3.4 Soziologische Erklärungen
Für Soziale Arbeit ist jedoch auch über die medizinische Definition hinausgehendes Wissen obligatorisch. Um das Verhalten zu verstehen und Handlungsspielräume für So-ziale Arbeit zu eröffnen, haben soziale Ansätze eine große Bedeutung.
Soziologische Erklärungen gehen davon aus, dass Demenz eine Abweichung dar-stellt, die eine Behinderung zur Folge hat. Demnach sind nicht allein die Schädigung der Nervenzellen und die daraus resultierenden Symptome entscheidend, sondern die Folgen, die sich daraus ergeben. Wobei die Definition der WHO in der Internationalen Klassifikati-on der Behinderung IDIDH-1 noch von einer Schädigung (Impairment) ausgeht, die eine Behinderung/Einschränkung (Disability) für den individuellen Menschen hat und zu einer Benachteiligung (Handicap) führt (vgl. Cloerkes 2001, S. 4).
Diese eher individuumzentrierte und defektorientierte Sichtweise wurde 2000 von der ICIDH-2 abgelöst, die den gesellschaftlichen Kontext berücksichtigt, in dem Menschen mit Behinderung leben und positive Möglichkeiten aktiver, selbst bestimmter Teilhabe als Ziel erfasst. Behinderung wird unter diesem Blickwinkel als prozesshaftes Geschehen mit positiven wie negativen Möglichkeiten beschrieben (Cloerkes 2001, S. 5). Denn durch ge-eignete Bedingungen, z. B. einen verständnisvollen Umgang und geeignete Wohnformen können die Auswirkungen der Demenz gemildert werden. Wegen ihrer Komplexität ist die-se Definition jedoch etwas schwer zu fassen.
Die Definition der WHO stellt also einen recht umfassenden Zugang zur Behinde-rung dar, dennoch ist kritisch anzumerken, dass der Ansatzpunkt eine Schädigung als ob-jektive Abweichung von einer Norm angesehen wird. Was ist jedoch die „Norm“, wenn nahezu 40 % der über 90jährigen (Gaebel et al. 2001) an einer Demenz erkrankt sind? Fraglich ist auch, woran sich die Normabweichung misst. Inwieweit ist die Schädigung zu-dem objektiv z. B. durch medizinische Diagnosestellung sicher festzustellen? Denkbar wä-re auch, dass eine Behinderung einen sozialen Bewertungs- und Abwertungsprozess wiedergibt, der dann eine Schädigung verursacht (vgl. Cloerkes 2001, S. 5), wie dies auch von Kitwood (2005) in dessen Überlegungen einbezogen wird.
Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass an der Behinderung nicht allein die Veränderung im Gehirn (biomedizinisches Modell) beteiligt ist, sondern auch Umweltfak-toren, die auf vorhandene Veränderungen einwirken und diese beeinflussen und in ir-gendeiner Weise als abweichend beschrieben werden.
2.3.5 Sozialpychologische Erklärungen
Der dialektische Erklärungsansatz der Demenz nach Kitwood (2005) bezieht eben-falls Umweltfaktoren mit ein, legt den Schwerpunkt jedoch auf die Interaktion. Es wird darin deutlich, dass an dem Abbauprozess auf jeden Fall sozialpsychologische und ge-sellschaftliche Faktoren beteiligt sind.
Dieser Sichtweise zu Folge ist die Ursache der Demenz „nicht linear, sondern viel-fältig und interaktional“ (Kitwood 2005, S. 62). Danach ist die Demenz ein andauerndes Wechselspiel zwischen Neuropathologie einerseits und sozialpsychologischen Faktoren (z. B. der Interaktion) andererseits.
Kitwood geht dabei gar so weit, aufzuzeigen (und bezieht sich auf eine Studie von Michael Meacher, 1972), dass im Einzelfall allein psychische, soziale und allgemeine Be-schaffenheiten ausreichen können, um Menschen dement werden zu lassen (Kitwood 2005, S. 74). Auch konnte festgestellt werden, dass es aufgrund belastender Ereignisse, z. B. Verlust eines geliebten Menschen, bei Menschen mit Demenz häufig zu einem dra-matischen Einbruch der Funktionsfähigkeit kommt. Dies kann nicht allein damit erklärt werden, dass der verstorbene Mensch bestehende Defizite kompensierte (vgl. Morton 2002, S. 125). Denkt man dies konsequent weiter, so lassen Kitwoods Überlegungen den Schluss zu, dass umgekehrt sogar personale und auch geistige Funktionen teilweise wie-der hergestellt werden können (Morton 2002, S. 126), wenn entsprechende Rahmenbe-dingungen bestehen. Hier könnte – mit aller Vorsicht – schließlich sogar von einem
Therapie-Ansatz gesprochen werden, der völlig anderer Art ist als der, der sich aus dem medizinischen Krankheitsparadigma ergibt. Dies könnte z. B. bedeuten, dass ein demen-zieller Prozess dadurch aufgehalten oder verlangsamt werden kann, wenn für den betrof-fenen Menschen eine schützende und zugleich spezifisch anregende Lebensumgebung gestaltet wird.
Kitwood (2005) leugnet dabei keineswegs die Neuropathologie der Demenz und kri-tisiert nicht, dass im medizinischen Konzept der Demenz falsche Behauptungen aufgestellt würden. Was er kritisiert ist, dass das medizinische Krankheitsmodell für sich beansprucht, ein vollständiges Bild der Demenz zu entwerfen, während es psychologische und soziale Faktoren vernachlässigt (vgl. Morton 2002, S. 127 ff.).
Aus Kitwoods Sicht kann die Demenz als Folge einer komplexen Interaktion von Persönlichkeit, Biographie, körperlicher Gesundheit, neurologischern Beeinträchtigungen und Sozialpsychologie verstanden werden (vgl. Morton 2002, S. 129 ff.).
Zentraler Ansatzpunkt Kitwoods ist das Person-Sein der Menschen mit Demenz. Seinen Forschungen zufolge wird gerade das Person-Sein durch die Art, wie mit Men-schen mit Demenz umgegangen wird, vielfach untergraben. Person-Sein erklärt er dabei nicht in Abhängigkeit von bestimmten Eigenschaften, sondern vielmehr als Interaktion, die das Person-Sein ausmacht. Der Mensch ist Person durch andere Menschen (vgl. Buber 2006). Sein „Person-Sein“ hängt also von zwischenmenschlichen Beziehungen, von Inter-aktion ab, davon, von anderen als Person wahrgenommen zu werden.
Kitwood kritisiert, dass das Person-Sein eines Menschen mit Demenz dadurch un-tergraben wird, dass eine Entwertung der subjektiven Realität des Erlebens der Kranken stattfindet. Indem alles Verhalten allein durch den hirnorganischen Prozess erklärt wird, kommt die Bedeutung der Interaktion mit anderen und den daraus resultierenden Reaktio-nen zu kurz (vgl. Kitwood 2005, S. 75 f.). Deshalb geht es vor allem um den Erhalt des Person-Seins.
Interessant an diesen Überlegungen ist, dass die Interaktion und die Person in den Mittelpunkt des Interesses gerückt und berücksichtigt werden. Nicht allein hirnorganische Veränderungen durchdringen den Demenzprozess, sondern auch Umweltfaktoren und die Menschen im Umfeld und deren Verhalten prägen die Demenz. Die Anerkennung, die Wertschätzung und die Beziehungen der Menschen mit Demenz haben entscheidende Rückwirkungen auf die Demenz.
Wichtig an Kitwoods (2005) Darlegungen ist zudem, dass die Demenz beeinflusst werden kann. Diejenigen, die mit Menschen mit Demenz arbeiten, können positiv oder ne-gativ auf die Demenz einwirken. Auch wenn Kitwood als Psychologe den Schwerpunkt auf den Einfluss der Interaktion und menschliche Beziehungen legt, berücksichtigt sein Kon-zept dennoch, dass auch sozial-strukturelle Wertsysteme auf die Demenz einwirken. Dies zeigt sich z. B. daran, dass nur geringe Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eine um-fangreiche Betreuung von Menschen mit Demenz zu gewährleisten. Dies wirkt sich u. a. auch auf die Pflegenden und deren Zufriedenheit und damit Leistungsfähigkeit negativ aus (vgl. Morton 2002, S. 138 ff.).
Somit ergibt sich eine Wechselbeziehung zwischen Umweltfaktoren (vor allem an-deren Menschen) einerseits und der Neuropathologie andererseits.
Sozialpsychologische Auseinandersetzungen mit der Demenz scheinen also der Realität besonders gerecht zu werden, weil sie die Wechselbeziehungen zwischen ver-schiedenen Faktoren berücksichtigen. Zudem ermöglichen sie ein weites Spektrum von (auch sozialarbeiterischen) Handlungsmöglichkeiten, weil der Demenzprozess beeinflusst werden kann.
Stärker als der medizinische Ansatz eröffnen soziologische und sozialpsychologi-sche Begründungszusammenhänge Handlungsmöglichkeiten, auch und gerade für die Soziale Arbeit. Demenz wird damit verstanden als ein Interaktionsprozess, der positiv wie negativ für die Betroffenen beeinflusst werden kann.
2.3.6 Citizenship-Ansatz
Viele Überlegungen gehen von der Frage aus, was für Menschen mit Demenz ge-tan werden kann. Selten wird darüber nachgedacht, was Menschen mit Demenz uns ge-ben können. Das Citizenship-Modell (Citizenship bedeutet Bürgerschaft) nimmt solch eine eher ungewöhnliche Perspektive ein: Menschen mit Demenz werden hier als Bürgerinnen betrachtet, die ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum leisten und dafür auch die Möglichkeiten erhalten müssen (Marshall & Tibbs 2006, S. 18). Es geht insofern nicht nur darum, dass wir etwas Gutes für die Menschen mit Demenz tun, sondern dass sie die gleichen Rechte beanspruchen wie gesunde Menschen auch (vgl. Menschenrechte S. 32). So haben Menschen das Bedürfnis sich auszudrücken, sich sinnvoll zu betätigen, sich als wertvoll zu erfahren, Anerkennung zu bekommen und in Kontakt und Austausch miteinan-der zu treten. Demokratische Gesellschaften sind dabei verpflichtet, die Rahmenbedin-gungen zu gestalten, die ihren Bürgerinnen die Befriedigung ihrer Bedürfnisse ermöglicht.
Meist sind Menschen mit Demenz jedoch davon ausgeschlossen. Einen alternati-ven Ansatz demonstriert das Ausstellungsprojekt „demenz art“. Hier können sich Men-schen mit Demenz künstlerisch ausdrücken, werden ihre Bilder in einem Ausstellungsprojekt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und andere können dadurch erfreut werden (vgl. Wißmann 2006).
Ein weiteres Beispiel der Teilhabe von Menschen mit Demenz am gesellschaftli-chen Prozess und des Citizenship-Ansatzes: In einem Theaterprojekt in Moers standen Menschen mit Demenz gemeinsam mit Schauspielern auf der Bühne, haben also diese künstlerische Ausdrucksform aktiv mitgestaltet. Auf diese Weise konnte über die künstleri-sche Sichtweise der Demenz der Dialog gefördert werden (Schröder 2005, mehrkultur 55plus 2007). Künstlerische Ausdrucksformen sind typisch menschliche Möglichkeiten, sich kreativ auszudrücken und mit anderen zu kommunizieren. Gleichzeitig benötigen Menschen dafür keine rationalen, sondern emotional-kreative Fähigkeiten, die Menschen mit Demenz noch zur Verfügung stehen und mit denen sie sich gegenüber normalsinnigen Menschen behaupten können. Hierfür benötigen sie allerdings die entsprechenden Chan-cen (Rahmenbedingungen, Anregungen, materielle und personale Ressourcen).
Aufgabe der Sozialen Arbeit in diesem Zusammenhang ist es, einmal wieder „kata-lysatorische Wirkung“ zu entfalten: Dies bedeutet, nicht die entsprechenden Leistungen selbst zu erbringen, sondern Menschen mit Demenz in angemessener Weise mit Fachleu-ten (z. B. Kunsttherapeutinnen) so in Verbindung zu bringen, dass sie innerhalb der von der Sozialarbeit mitgestalteten Rahmenbedingungen kreativ-kommunikative Wirksamkeit entfalten können. Es wäre notwendig, auf dieser Basis weitere Möglichkeiten zu entwi-ckeln, damit Menschen mit Demenz ihre Bürgerrechte leben können.
Jede der dargestellten Sichtweisen (Medizin, Sozialpsychologie usw.) konzentriert sich auf einen Ausschnitt der Demenz. Sie müssen jedoch nicht als unvereinbare Gegen-sätze gesehen werden, sondern können als verschiedene Seiten eines Würfels gesehen werden, der zusammengenommen die Demenz ausmacht. Je nachdem, von welcher Seite dieser angeblickt wird, zeigt sich ein bestimmter Ausschnitt. Nur, wenn man sich ihm von verschiedenen Seiten annähert, ergibt sich ein Gesamtbild. Marshall & Tibbs (2006, S. 15) sprechen von einem „Dreieck“, wahrscheinlich gibt es jedoch weitaus mehr Ansatzpunkte.
2.4 Soziale Probleme im Zusammenhang mit Demenz
Die oben aufgeführten Auseinandersetzung mit verschiedenartigen Erklärungsmög-lichkeiten – oder besser gesagt: Annäherungen – an das komplexe Geschehen der De-menz geht also über den medizinischen Bereich hinaus. Vielleicht sind gar die sozialen Probleme, die mit der Demenz einhergehen, ein weitaus größeres Problem als das (rein) medizinische Problem. Mit den im Folgenden auszugsweise aufzuzeigenden Problemen zeichnet sich das Handlungsfeld ab, in dem Soziale Arbeit tätig werden könnte. Zunächst soll dazu jedoch in einem Exkurs das Thema „soziale Probleme“ auf allgemeiner Ebene diskutiert werden.
2.4.1 Exkurs: Gegenstandsdiskussion Sozialer Arbeit und Soziale Probleme
Die Gegenstandsdiskussion in der Sozialen Arbeit erscheint fast uferlos. Am we-nigstens strittig ist wohl die Überlegung, dass es soziale Arbeit auf irgendeine Weise mit den Individuen und der Gesellschaft zu tun hat. Jedoch teilt sie diesen wirklich sehr allge-meinen Gegenstandsbereich mit einigen anderen Professionen (Erziehungswissenschaft, Recht, Pflegewissenschaften) (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 181).
In der Soziologie ist ein „soziales Problem“ eine Sammelbezeichnung für eine Menge ungleicher gesellschaftlicher Erscheinungen, „denen immer eine Diskrepanz zwischen sozialen Standards oder Wertvorstellungen und deren Realität bzw. den tatsächlichen Ab-läufen zugrunde liegt“ (Cloerkes 2001, S. 16).
Die Theorie Sozialer Arbeit von Kaspar Geiser (2007) jedoch erklärt soziale Prob-leme als Anforderungen, denen Menschen gegenübergestellt sind.
Soziale Probleme als Gegenstandsbereich Sozialer Arbeit zu beschreiben wird viel-fach wegen der damit verbundenen negativen Zuschreibungen, potentieller Stigmatisie-rung und dem negativen Bild heftig kritisiert (vgl. Sahle 2004, S. 296 ff.). Dem ist entgegenzuhalten, dass Soziale Arbeit tatsächlich mit Problemen beschäftigt ist – und wenn es auch nur um deren Prävention geht. Mit der Vermeidung, dem Ausweichen vor sozialen Problemen in der Gegenstandsdiskussion werden diese gewiss nicht verhindert.
Es erscheint mir als ein hilfreiches Instrument, Soziale Probleme als Gegenstands-bereich der Sozialen Arbeit anzunehmen, um überhaupt zu entscheiden, ob es einen sozi-alarbeiterischen Handlungsbedarf gibt. Hinzu kommt, dass „soziale Probleme“ zwar problematisch sind, jedoch jeder Mensch sozialen Problemen und Anforderungen gegen-übergestellt ist. Die meisten Menschen sind jedoch in der Lage, ihre Probleme überwie-gend mithilfe interner oder externer Ressourcen zu bewältigen. Nur wenn diese nicht ausreichen, sind (sozialarbeiterische) Hilfen notwendig (vgl. Geiser 2007).
Des Weiteren ist es nützlich, Probleme klar zu benennen, zu begründen und nicht schönzureden, dabei aber trotzdem die Ressourcen einzubeziehen, die zur Bewältigung sozialer Problem beitragen können. Denn andernfalls besteht die Gefahr, dass unklar bleibt, was und warum mit welchem Ziel getan wird.
Es ist schließlich auch Aufgabe sozialer Arbeit, auf Probleme aufmerksam zu ma-chen und sich für Menschen einzusetzen, die nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse aus eigenen Kräften zu bewältigen. Andernfalls würden gerade jene Menschen, die besonders vulnerabel sind (wie dies z. B. bei Menschen mit Demenz der Fall ist) nicht berücksichtigt werden. Wichtig ist dabei sicherlich, dies reflektiert zu tun und Menschen nicht zu entmün-digen, aber ihnen die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Was ist jedoch unter „sozialen Problemen“ zu verstehen, die für die Soziale Arbeit relevant sind? Bei der systemischen Sichtweise Staub-Bernasconis (2007) werden Indivi-duen als Teile sozialer Systeme betrachtet. In dieser Beziehung wird weder ein Individuum als Funktionsträger für funktionale Ganzheiten (Gesellschaft) betrachtet (soziozentrisch-holistisches Paradigma), noch stehen Individuum als Analyseeinheit im Zentrum, denen immer der Vorrang gewährt wird (individualistisches, subjektzentriertes Paradigma). Viel-mehr werden Individuen als psychobiologische Systeme gesehen, die Fähigkeiten besit-zen und soziokulturelle Gegebenheiten gestalten können (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 169). Diese systemische Sicht erscheint mir deshalb hilfreich, weil dabei sowohl die indivi-duellen Merkmale einer Person, als auch die gesellschaftlichen Einflussfaktoren erklärt und berücksichtigt werden. Auf Demenz bezogen bedeutet dies, dass der Prozess sowohl durch krankheitsbedingte und persönliche (Charakter-)Eigenschaften, als auch durch ge-sellschaftliche und Interaktionelle Faktoren beeinflusst wird und darüber erklärt werden kann.
„Soziale Probleme“ bezeichnen das Paket an Problemen, das mit den Bedürfnissen von Individuen nach Einbindung in die soziale Umwelt zusammenhängt (Obrecht 2001, S. 14). Wenn ein Individuum, also ein Mensch, vorübergehend oder dauernd nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse und Wünsche aufgrund seiner Einbindung in soziale Systeme in ausreichendem Maße zu befriedigen, dann entstehen soziale Probleme (Staub-Bernasconi 2007, S. 182). D. h., aufgrund unzureichender Einbindung in soziale Systeme, fehlende individuelle Kompetenzen, unzureichende Austauschbeziehungen in Form von Unterstützungsnetzwerken oder mangelnder Macht können die Bedürfnisse eines Indivi-duums nicht befriedigt werden (Staub-Bernasconi 2007, S. 66).
In der Regel sind Menschen in der Lage, die meisten ihrer Bedürfnisse aus ihren in-ternen und externen Ressourcen heraus zu befriedigen und Mangelsituationen selbst aus-zugleichen. Wenn diese Ressourcen fehlen oder diese nicht bekannt sind, um aus eigener Anstrengung die bestehenden Probleme auszugleichen, zu lösen oder zu mildern, ist So-ziale Arbeit gefordert (vgl. Geiser 2007, S. 66). Verfügen Menschen im Zusammenhang mit der Demenz also nicht über ausreichende Ressourcen oder haben keinen Zugang zu ihnen, um Bedürfnisspannungen auszugleichen (vgl. Obrecht 2005), ergibt sich sozialar-beiterischer Handlungsbedarf. Manchmal genügt es dann schon, wenn auf die Rechtsan-sprüche des Klienten hingewiesen wird, wie sie im Sozialgesetzbuch formuliert sind.
Staub-Bernasconi (2007, S. 183 ff.) unterscheidet dabei verschiedene Dimensio-nen, in denen sich soziale Probleme abzeichnen (können). Es kann dabei nicht davon ausgegangen werden, dass die Adressaten als „Experten in eigener Sache“ ihre Probleme selbst als soziale Probleme erkennen und artikulieren können. Dieser Aspekt ist gerade für die Arbeit mit Menschen mit Demenz bedeutsam, die ganz speziell ihre Probleme eher schamvoll verheimlichen und sie teilweise auch nicht artikulieren können bzw. deren Be-dürfnisse auch nicht ausreichend von der Umwelt wahrgenommen werden. Nach dem Motto: „Die beschwert sich ja nicht“. Dabei kann auch z. B. das „Umherwandern“, das für Menschen mit Demenz typisch ist und oftmals einfach als „Unruhe“ abgewertet wird, als Möglichkeit erkannt werden, Bedürfnisse auszudrücken (vgl. Marshall & Tibbs 2006, S. 71). Aus ethischer Sicht ist dabei zu fragen, unter welchen Bedingungen von außen bei sozialen Problemen eingegriffen werden kann, zumal es häufig außerhalb des Betreu-ungsrechts und der Pflegeversicherung keinerlei rechtliche Grundlage gibt. Wer weiß also, was gut für einen Menschen ist?
Beispielhaft sollen hier einige soziale Probleme beleuchtet werden, die bei Men-schen mit Demenz besonders häufig vorzufinden sind, vielfach jedoch aus meinen Erfah-rungen heraus im Vergleich zu pflegerischen Problemen nur recht wenig Beachtung finden, oder gar nicht als soziale Probleme erkannt werden und als „störendes Verhalten“ medikamentös behandelt werden.
2.4.1.1 Ausstattungs- und Positionsprobleme
Folgende individuelle Ausstattungs- bzw. Positionsprobleme (vgl. Geiser 2007;
Staub-Bernasconi 2007) kommen in Frage:
Im Zusammenhang mit Demenz tritt häufig abweichendes, von Außenstehenden als
störend beurteiltes Verhalten auf, z. B. die bereits erwähnte Unruhe. Dieses abweichende Verhalten kann jedoch auch als gesellschaftliche verhinderte Entwicklung von Hand-lungskompetenzen beurteilt werden. Das Bedürfnis nach Fähigkeiten zur Bewältigung von Situationen, nach Kontrolle und Kompetenz ist damit verletzt.
Beispiel: Frau Schulz lebte in dem Altenheim, in dem ich ein Praktikum ab-solvierte. Beim Frühstück und Abendessen war sie nicht in der Lage, ihr Brot selbst zu schmieren. Deshalb bediente sie sich immer bei Herrn Schmitt, ihrem Tisch-nachbarn, nahm sein Brot, sobald es fertig bestrichen war. Herrn Schmitt schien das an sich nicht zu stören: „Ach, dann mach ich mir eben noch eins. Wir haben ja genug. Soll ja keiner hungern hier“, war seine Reaktion. Damit war die Sache für Beide geklärt. Jedoch griff eine Pflegekraft immer in die Situation ein, um dieses von der Pflegekraft als „unangemessen“ deklarierte Verhalten von Frau Schulz zu unterbinden. Dadurch war Frau Schulz nicht in der Lage, ihre noch vorhandene Kompetenz in dieser Situation zu nutzen. Die Kompetenz von Frau Schulz bestand
darin, dass sie sich Hilfe holte und dank Herrn Schmitts nachbarschaftlichen Verhal-tens zu ihrem Brot hätte kommen können.
Die Erkrankung bzw. Behinderung und besonders deren soziale und psychische Folgen stellen ein soziales Problem dar (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 183). So wird die demenzielle Erkrankung als eine Abweichung von der gesellschaftlichen Norm bewertet, auch wenn kritisch gefragt werden kann, ob die Demenz nicht einfach eine mögliche Le-bensform darstellt (vgl. Klie 2002b, S.66 ff.). Trotzdem wird die Erkrankung eindeutig ne-gativ bewertet. Folglich sind Menschen mit einer Demenz in unserer Gesellschaft eher wenig anerkannt. Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit sowie das nach gesell-schaftlicher Anerkennung werden nicht erfüllt. Dies scheint ein entscheidender Faktor. Hinzu kommt, dass vielfach auch diejenigen, die mit Menschen mit der Behinderung De-menz arbeiten, beispielsweise Altenpflegekräfte, eher weniger anerkannt werden im Ver-gleich zu anderen Berufsgruppen, die mit sozial respektierten Klientel arbeiten.
Auch die Erkenntniskompetenzen (Staub-Bernasconi 2007, S. 183) können bei Menschen mit Demenz verhindert sein, denn oft bekommen Menschen mit Demenz keine Informationen darüber, was um sie herum vor sich geht oder auf eine Weise, die nicht ih-ren Kompetenzen und Einschränkungen gerecht wird.
Beispiel: Frau Schlauer, die im Altenheim lebte, wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht, um dort geröntgt zu werden. Allerdings fuhr aus Mangel an Zeit niemand von den Pflegekräften mit, sondern Frau Schlauer wurde lediglich bei den Fahrern des Krankenwagens „abgegeben“. Zwar wurde ihr gesagt, dass sie ins Krankenhaus gefahren werde, aber auf ihre Fragen und ihre Verunsicherung ging niemand ein. Sie schien nicht zu verstehen, was um sie herum vor sich ging. Mit den kurzen Erklärungen des Krankenwagenfahrers konnte sie nichts anfangen. Sie verstand die Situation nicht und begann zu schimpfen, sich „aggressiv“ zu verhalten und sich bei der Untersuchung so wenig „kooperativ“ zu verhalten, dass die Unter-suchung abgebrochen werden musste.
Das Bedürfnis nach Informationen zur Orientierung und dem Verstehen, was um sie herum vor sich ging, war nicht erfüllt.
Zudem fehlen Menschen mit Demenz – besonders wenn die Erkrankung weiter fortschreitet – soziale Mitgliedschaften, weil z. B. die Gruppen, zu denen sie bislang ge-hörten, nicht auf die Erkrankung eingerichtet sind. Beispielsweise fühlen sie sich u. U. nicht mehr in ihrem Freundeskreis zugehörig, denn sie können sich nicht an Gesprächen beteiligen und niemand macht sich die Mühe, ihnen geduldig zuzuhören.
Ähnlich ging es Frau Blauer in dem Chor, in dem sie seit Jahrzehnten mit-wirkte: Eine Zeit lang konnte sie sich auch mit der Demenzerkrankung bei den Pro-ben und Auftritten beteiligen, las die Texte vom Blatt. Irgendwann jedoch war sie im Chor nicht mehr zu tragen, denn bei neuen Liedern sang sie häufig völlig falsch mit. Somit fehlte ihr diese für sie wichtige soziokulturelle Zughörigkeit , denn sie fühlte sich dem Chor sehr zugehörig. Zudem konnte auch ihr Bedürfnis nach sozialer Mit-gliedschaft in dem Bereich nicht mehr befriedigt werden und die Anerkennung , die mit Singen verbunden war, fiel weg.
Insgesamt ist die soziale Zugehörigkeit in Form einer Funktion, verbunden mit Rechten und Pflichten auch im näheren Umfeld und der Gesellschaft nicht gewährleistet. Eine pflegerische (SGB XI) und soziale (SGB XII) Grundversorgung ist zwar in der Regel sichergestellt, soziale Bedürfnisse werden jedoch nicht oder weniger berücksichtigt.
2.4.1.2 Austauschprobleme
Auch hinsichtlich des Austausches (des Nehmens und Gebens) treten bei Men-schen mit Demenz verstärkt soziale Probleme auf. Menschen mit Demenz leben z. B. durch Pflege in abhängigen Beziehungen, sind auf andere angewiesen und haben nicht immer das Gefühl, etwas zurückgeben zu können. Sie werden vielleicht von der eigenen Tochter gepflegt, werden aber nicht mehr dafür eingesetzt, die Enkelkinder zur Schule zu bringen oder auf andere Weise für sie zu sorgen. Das Bedürfnis nach Austauschgerech-
tigkeit ist damit verletzt. Auch im Heimkontext bestehen zwischen Pflegenden und Pfle-gebedürftigen meist abhängige Beziehungen. Zu fragen ist deshalb, wie Menschen in der Pflege z. B. stärker einbezogen werden könnten, damit ihre verbleibenden Fähigkeiten gezielter genutzt werden können und es zu einem fairen Tausch von Gütern und Ressour-cen kommen kann. Denn vielfach erkennen ältere Menschen auch nicht, dass sie für die Pflege Geldleistungen erbringen und somit ein Anrecht auf Pflege haben, sodass die Hilfe nur schwer angenommen werden kann.
Zusätzlich ist ein entscheidendes Problem, dass gemeinsame „Erkenntnis-/Empathie-/Reflexionsprozesse“ (Staub-Bernasconi 2007, S. 184) bei Menschen mit Demenz behindert sein können. Für sie hat z. B. Zukunft keine Bedeutung. Sie leben ü-berwiegend in der Vergangenheit oder schließlich nur noch in der Gegenwart – ohne Ver-gangenheit (und das entwickelte Vertrauen und Erfahrung) und Zukunft. Die gesunden Menschen in ihrem Umfeld jedoch leben in der Gegenwart, haben eine Vergangenheiten und planen für die Zukunft. Sie beschäftigen sich mit Alltagsproblemen, die für Menschen mit Demenz lediglich in ihren Konsequenzen bedeutsam sind. Insofern ist es schwierig, eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Über Biographiearbeit kann Kommu-nikation und darüber Empathie verwirklicht werden (Bruce 2003, S. 43f.). Über gemeinsa-mes Singen von biographisch bedeutsamen Liedern z. B. können gemeinsame positive Aktivitäten verwirklicht werden. Über die Brücke der Vergangenheit (dies können auch Lieder aus der Vergangenheit sein) wird Kommunikation in der Gegenwart möglich.
Auch die Validation (Feil 2005) bietet – bei aller Umstrittenheit des Konzepts – eine Kommunikationsmöglichkeit. Hinzu kommt, dass in unserer Gesellschaft Gefühle eher we-nig ernst genommen werden, was auch die Gefahr birgt, die Gefühlsäußerungen von Men-schen mit Demenz wenig zu berücksichtigen. Folglich kann das Bedürfnis nach emotionaler wie kognitiver Zuwendung, Liebe, Freundschaft und Sinngebung verletzt sein (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 184).
Bei den beispielhaft aufgeführten Problemen, handelt es sich weniger um pflegeri-sche Probleme und Aufgaben, sondern um soziale Probleme und dahinter stehende sozia-le Bedürfnisse, die das gesamte Leben der Betroffenen betreffen. So ist eine behinderte Teilhabe weniger ein pflegerisches, denn ein soziales Problem. Insofern ist sind Menschen mit Demenz durchaus eine Zielgruppe Sozialer Arbeit, die durch ihren Generalismus und den Bezug zur gesamten Lebenswelt einen breiteren Blick als andere Berufsgruppen ein-nimmt und soziale Probleme berücksichtigt.
2.5 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
„Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen Wandel und die Lösung von Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen, und sie befähigt die Menschen, in freier Ent-scheidung ihr Leben besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnis-se über menschliches Verhalten und soziale Systeme greift soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit ihrer Umwelt in Interaktion treten. Grundlagen der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit“. So definiert die International Federation of Social Workers (2000) Soziale Arbeit.
Allgemein beschäftigt sich Soziale Arbeit also mit der Lösung sozialer Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen, die oben beschrieben wurden, und fördert den sozi-alen Wandel (IFSW 2000, Staub-Bernasconi 2007). Es sollte ihr also auch darum gehen, die soziale Situation von Menschen mit Demenz zu verbessern, damit Betroffene ihr Le-ben besser gestalten können (vgl. IFSW 2000). Handlungsgrundlage bilden soziale Ge-rechtigkeit und die Prinzipien der Menschenrechte, die in dieser Arbeit – zusammengefasst als Würde – die Leitlinie der Diskussion markieren. Aus dem Respekt und vor der Würde und Gleichheit der Menschen resultieren humanitäre und demokrati-sche Ideale, denen sich Soziale Arbeit verpflichtet fühlt. Dabei konzentriert sich Soziale Arbeit – wie ab Seite 26 weiter ausgeführt – auf die Bedürfnisse und unterstützt im Sinne eines ressourcenorientierten Vorgehens die Stärken von Menschen. (In ihren Bedürfnis- sen) verletzte, ausgestoßene Menschen sollen befreit werden, ihre Stärken erkannt und Integration gefördert werden (IFSW 2000). Das bedeutet, dass es Aufgabe Sozialer Arbeit sein muss, verletzte Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu benennen und durchzu-setzen, dabei ihre Stärken zu nutzen. Weiterhin zeichnet sich das Ziel ab, zu ihrer Integration beizutragen (IFSW 2000).
Professionelle Soziale Arbeit ist dabei als Zusammenschluss von Praxis und Theo-rie auf einer Wertebasis zu verstehen, die Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit be-tont. Diese Werte ergeben sich aus der Achtung vor der Gleichheit und Würde aller Menschen und den Rechten, die daraus folgen (vgl. IFSW 2000; IFSW 2004). Im Zentrum steht damit die Wahrung der körperlichen, psychischen, emotionalen und spirituellen In-tegrität und das Wohlergehen jeder Person (vgl. IFSW 2004). Daraus resultieren folgende Prinzipien:
Prinzipien Sozialer Arbeit:
1. Die Achtung der Selbstbestimmung
„Sozialarbeiter/innen sollten das Recht der Menschen achten und fördern, eigene Wahl und Entscheidungen zu treffen, ungeachtet der Werte und Lebensentschei-dung, vorausgesetzt, dass dadurch nicht die Rechte und legitimen Interessen eines anderen gefährdet werden“ (IFSW 2004).
Angesichts knapper Ressourcen kann dieses Prinzip zu einem zweischneidigen
Schwert werden: Dann z. B., wenn ein Mensch mit Demenz eine wenig gute Lösung „au-tonom“ wählt, weil die Alternativen ähnlich miserabel wären. Zum Beispiel wird Menschen mit Demenz, die aufgrund ihres beeinträchtigten Essverhaltens Untergewicht bekommen, als „Lösung“ eine Magensonde angeboten. Diese würde sie aber von oralen Erlebnismög-lichkeiten weitgehend abkoppeln. Die erfahrene Sozialarbeiterin könnte stattdessen auf die Möglichkeit verweisen, verstärkt Wunschkost oder Fingerfood (vgl. Schwerdt 2004) anzubieten. Würde stattdessen nur die Alternative „Abmagerung / Verhungern“ oder „Ma-gensonde“ angeboten, wäre dies zynisch. Aufgabe Sozialer Arbeit muss es darum sein, die Möglichkeiten der Betroffenen so zu erweitern, dass sie den tatsächlichen Bedürfnis-sen gerecht wird.
2. Förderung des Rechts auf Beteiligung
„Sozialarbeiter/innen sollten das volle Einbeziehen und die Teilnahme der Men-schen, die ihre Dienste nutzen, fördern, so dass sie gestärkt werden können in allen Aspekten von Entscheidungen und Handlungen, die ihr Leben betreffen“ (IFSW 2004).
Hier geht es also darum, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen zu stärken, eine
angemessene Beteiligung zu ermöglichen. Das betrifft nicht nur die Beteiligung an Ent-scheidungen der Hilfe, sondern alle Lebensbereiche. Als Aufgabe Sozialer Arbeit resultiert damit, Bedingungen so zu gestalten, dass zur Beteiligung in gesellschaftlichen Situationen beigetragen wird. Sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen kann für Menschen mit Demenz z. B. heißen, bei einem Theaterstück mitzuwirken, das aufgeführt wird (vgl. Seite 17 f.).
3. Mit jeder Person ganzheitlich umzugehen
„Sozialarbeiter/innen sollten sich mit der Person als Ganzes innerhalb der Familie, der Gemeinschaft, sowie der sozialen und natürlichen Umwelt beschäftigen, und sollten darauf bedacht sein, alle Aspekte des Lebens einer Person wahrzunehmen“ (IFSW 2004).
Dieses Prinzip ist eigentlich selbstverständlich und selbsterklärend. Angesichts der
Komplexität von Problemlagen und der Dringlichkeit bestimmter Anliegen, müssen jedoch manchmal einzelne Aspekte gesondert behandelt werden.
4. Stärken erkennen und fördern
„Sozialarbeiter/innen sollten den Schwerpunkt auf die Stärken des Einzelnen, der Gruppen und der Gemeinschaften richten um dadurch ihre Stärkung weiter zu för-dern“ (IFSW 2004).
Anlass dafür, dass Sozialarbeit tätig wird, sind in der Regel Probleme. Für die Lö-sung dieser Probleme empfiehlt es sich, die Stärken der Personen, Gruppen oder Ge-meinschaften zu nutzen und diese weiter auszubauen. Es sollten außerdem nicht allein die Ressourcen der Betroffenen einbezogen werden, sondern auch die des Umfeldes. Zu den Stärken von Menschen mit Demenz im persönlichen Bereich (interne psychische Ressourcen) gehört die Gefühlswelt, die sehr lange erhalten bleibt. Zudem bleibt auch das Langzeitgedächtnis (insbesondere frühe Kindheitserinnerungen) relativ lange erhalten. Automatisierte Abläufe, d. h. einfache motorische Tätigkeiten, die immer ausgeübt wurden, ohne darüber nachdenken zu müssen, können sehr lange ausgeführt werden. – Externe Ressourcen können z. B. günstige familiäre und nachbarschaftliche Bedingungen sein, eine gute Infrastruktur an unterstützenden Einrichtungen, eine gemütliche Wohnung, in der sich die Betroffene sicher fühlt usw.
Damit Soziale Arbeit nicht allein von juristischer Fremdbestimmung lebt, müsste die Leitidee der Menschenwürde und der Menschenrechte mit allen theoretischen, praktischen und empirischen Grundlagen in die Ausbildung und Praxis integriert werden. Zusammen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung könne dies zu einer Anerkennung als Profession führen (vgl. Staub-Bernasconi 2006, S. 287).
Leitlinie und Handlungsbasis Sozialer Arbeit sind also die Menschenrechte und es geht darum, die Würde der Menschen mit Demenz anzuerkennen und ihnen Würde zu ermöglichen. Bei allen Handlungen dienen die Prinzipien der Menschenrechte und der Menschenwürde (Seite 25 ff.), als Leitplanke. Über vorhandene oder zu erschließende Ressourcen kann zur Verwirklichung von Bedürfnissen beigetragen werden.
Soziale Probleme sind Ausgangspunkt für sozialarbeiterisches Handeln. Die Art der Probleme und deren Inhalte bestimmen dann, welche Verfahren angewandt werden, um zu Lösungen zu gelangen. Hierzu können verschiedene Handlungstheorien genutzt wer-den (vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 271 ff.):
- Ressourcenerschließung
- Bewusstseinsbildung
- Modell-, Identitäts- und Kulturveränderung
- Handlungskompetenz-Training und Teilnahmeförderung
- Soziale Vernetzung und Ausgleich von Rechten und Pflichten
- Umgang mit Machtquellen und Machtstrukturen
- Kriterien- oder Öffentlichkeitsarbeit
- Sozialmanagement
Diese Handlungstheorien können und müssen teilweise miteinander kombiniert werden.
2.6 Zwischenbilanz
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Demenzerkrankungen eine häufige Beeinträchtigung von älteren, speziell hochaltrigen Menschen sind. Nach wie vor wird dabei Demenz ausschließlich oder wenigstens überwiegend als medizinisches Problem betrachtet. Neben dem medizinischen Ansatz, der die Demenzerkrankungen weder umfassend erklären kann, noch Heilung für die Demenzerkrankung bietet, wurden (bio-)psychosoziale Aspekte vorgestellt und hinsichtlich ihrer Bedeutung diskutiert. Dabei wird von der Medizin immer wieder in Aussicht gestellt, in Zukunft wenigstens einige Formen der Demenz heilen zu können. Allerdings hilft das weder den Menschen, die im Moment an einer Demenz leiden, noch ist zu erwarten, dass bei der Komplexität der Materie alle Formen der Demenz heilbar werden. Das verweist auf die besondere Bedeutung psycho-sozialer Ansätze im Umgang mit Menschen mit Demenz.
Dabei lässt sich die Bedeutung Sozialer Arbeit in diesem Feld entdecken: Soziale Arbeit ist vor allem für die Bearbeitung sozialer Probleme, die im Zusammenhang mit der Demenz auftreten, zuständig. Sie stellt ein Zusammenspiel von praktischer Tätigkeit und Theorie auf einer gemeinsamen Wertebasis dar.
Menschen mit Demenz werden zahlenmäßig in der Zukunft noch bedeutsamer wer-den, die Frage aber ist, ob ihnen auch eine größere Bedeutung zugestanden werden wird,
ob sie mehr Anerkennung erfahren werden und als Teil unserer Gesellschaft anerkannt werden und ob ihre Fähigkeiten zukünftig deutlicher berücksichtigt werden. Ziel sollte es sein, menschenwürdige Lebensperspektiven für Menschen mit Demenz zu entwickeln.
[...]
1 Alle Beispiele stammen aus der praktischen Erfahrung der Autorin in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Die darin vorkommenden Namen und personenbezogenen Daten wurden aus Gründen des Datenschutzes verändert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt das Thema Demenz und die Frage, wie ein menschenwürdiges Leben für Menschen mit Demenz gelingen kann. Er untersucht verschiedene Demenzmodelle, soziale Probleme im Zusammenhang mit Demenz, den Begriff der Menschenwürde, die Bedeutung des Sozialraums und Netzwerkarbeit, bürgerschaftliches Engagement sowie Überlegungen zur Finanzierung sozialräumlicher Ansätze.
Welche Demenzmodelle werden im Text behandelt?
Der Text behandelt das medizinische Demenz-Konzept, soziologische Erklärungsansätze und sozialpsychologische Erklärungen, einschließlich des dialektischen Erklärungsansatzes nach Kitwood. Er diskutiert auch den Citizenship-Ansatz.
Welche sozialen Probleme im Zusammenhang mit Demenz werden erwähnt?
Der Text beleuchtet Ausstattungs- und Positionsprobleme sowie Austauschprobleme, die bei Menschen mit Demenz besonders häufig auftreten. Dazu gehört u.a. gesellschaftlich verhinderte Entwicklung von Handlungskompetenzen, fehlende soziale Mitgliedschaften, abhängige Beziehungen und behinderte Erkenntnis-/Empathie-/Reflexionsprozesse.
Welche Bedeutung hat der Begriff der Menschenwürde im Kontext von Demenz?
Der Text untersucht den Würdebegriff und überlegt, was Würde bedeutet und welche Instrumente es zur Verwirklichung gibt. Es wird angenommen, dass die Menschenrechte die Würde sichern sollen. Die Menschenrechte wiederum dienen dem Schutz und der Realisierung menschlicher Bedürfnisse. Der Zugang zur Würde von Menschen mit Demenz erfolgt über die Bedürfnisstheorie Obrechts.
Welche Rolle spielt der Sozialraum in der Arbeit mit Menschen mit Demenz?
Der Text untersucht den Sozialraum und sozialräumliche Strategien als Möglichkeiten zur Erweiterung der traditionellen, medizinisch geprägten und überwiegend individuum-zentrierten Versorgung. Es werden verschiedene Aspekte des Sozialraums diskutiert, einschließlich des relationalen Sozialraumbegriffs und der Perspektive der Betroffenen.
Welche Bedeutung haben Netzwerkarbeit und bürgerschaftliches Engagement im Umgang mit Menschen mit Demenz?
Der Text beleuchtet die Möglichkeiten, die soziale Netzwerke und bürgerschaftliches Engagement für Menschen mit Demenz bieten. Es wird die Bedeutung von Sozialkapital, Netzwerktypen und Netzwerkanalyse hervorgehoben.
Welche sozialräumlichen Handlungsansätze werden im Text skizziert?
Es werden die Gemeinwesenarbeit, die Sozialraumorientierung, die Gemeindepsychologische Perspektive und das Konzept der Community Care als sozialräumliche Handlungsansätze skizziert. Es wird auch die Rolle der Professionellen in diesem Kontext betrachtet.
Wie könnte eine menschenwürdige Lebensperspektive für Menschen mit Demenz aussehen?
Der Text entwirft eigene Ideen dafür, was getan werden könnte, um für Menschen mit Demenz ein menschenwürdiges Leben zu gestalten und was unternommen werden kann, um für sie einen Sozialraum zu erschließen oder ihre eigenen, vorhandenen Sozialräume zu erhalten. Dabei wird ein Perspektivwechsel von dem, was für Menschen mit Demenz getan werden kann, zu den Rechten und Ansprüchen, die Menschen mit Demenz haben, vollzogen.
Was ist die Rolle der Sozialen Arbeit in Bezug auf Demenz?
Soziale Arbeit wird als Menschenrechtsprofession betrachtet, die sich mit der Lösung sozialer Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt und den sozialen Wandel fördert. Sie soll die soziale Situation von Menschen mit Demenz verbessern, damit Betroffene ihr Leben besser gestalten können. Handlungsgrundlage bilden soziale Gerechtigkeit und die Prinzipien der Menschenrechte.
Welche Finanzierungsmodelle für sozialräumliche Ansätze in der Arbeit mit Menschen mit Demenz werden angesprochen?
Der Text liefert keinen fertigen Finanzierungsvorschlag, sondern regt zum Weiterdenken an, wie sozialräumliche Arbeitsweisen Sozialer Arbeit zur Verwirklichung der Würde von Menschen mit Demenz finanziert werden könnten.
- Quote paper
- Katrin Student (Author), 2009, Ein wertvolles Leben für Menschen mit Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140614