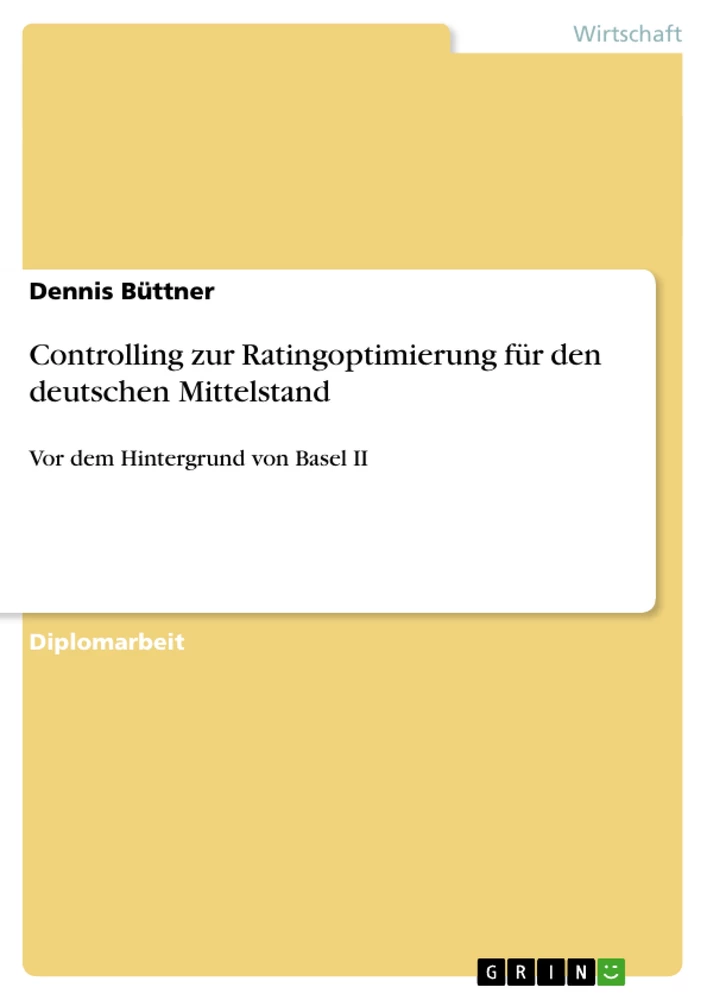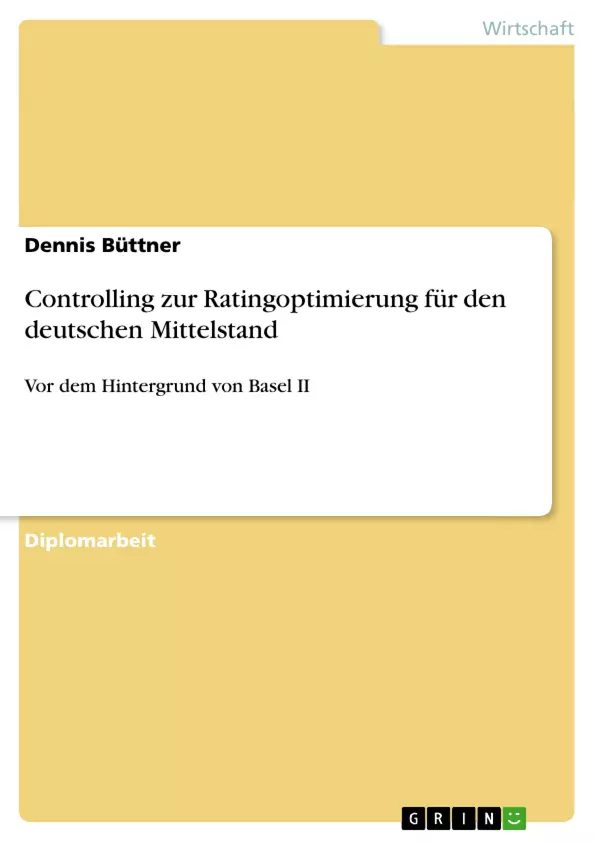Problemstellung
Besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) birgt der radikale Umbruch in der Kreditwirtschaft durch Basel II erhebliche Risiken. Sie begründen sich unter anderem durch höhere Insolvenzquoten des Mittelstandes, der Eigenkapitalschwäche und der Unerfahrenheit mit den hervorgehenden Ratings. Wie sind die aus den Risiken resultierenden Gefahren zu minimieren und die möglichen Chancen optimal zu nutzen? Zur Lösung der Fragestellung ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik unausweichlich. Es erscheint somit empfehlenswert sich, wie die Kreditinstitute, aktiv und rechtzeitig den „neuen“ Herausforderungen zu stellen.
Die Konsequenzen aus Basel II schlagen sich zeitversetzt über den Bankensektor bis auf die kleinen und mittleren Unternehmen durch. In Presse und Literatur werden die Wirkungen kontrovers diskutiert.
...
Eine mangelnde strategische Ausrichtung und Auseinandersetzung mit den Erfolgspotentialen der Unternehmen gepaart mit einer fehlenden Frühaufklärung sind häufig auffindbare Krisenursachen. Die Anwendung von Grundinstrumenten der strategischen Planung ist häufig unzureichend. Gründe finden sich in der zeitlichen Auslastung der Geschäftsleitung mit dem operativen Tagesgeschäft, diverser Vorbehalte und mentaler Widerstände ggü. den entsprechenden Maßnahmen zu deren Einführung.
.....
Schwächen in der langfristigen Erfolgssicherung werden zum Teil von unsystematischen und unregelmäßigen operativen Planungen und Erfolgskontrollen begleitet. Deren Ursachen liegen oftmals im nicht ausreichend installierten internen Rechnungswesen und seinem ungeklärten Verantwortungsbereich.
....
Sich aus dem typischen Krisenverlauf etablierende Liquiditätsengpässe können häufig nur mit Hilfe von Aufstockungen der Kreditlinien bei Banken überbrückt werden. Ursächlich hierfür sind i.d.R. zu geringe Eigenkapitalausstattungen, der fehlende Zugang zu den Kapitalmärkten und einem volatilen Finanzmittelbedarf, der sich durch ausgeprägte Finanzierungsspitzen bemerkbar macht.
...
Resümierend wird für diese Arbeit die Annahme getroffen, dass Liquiditätskrisen regelmäßig auf ein mangelhaftes Controlling zurückzuführen sind und im Zuge von Basel II nicht mehr durch ungeprüfte Erhöhungen der Kredite abgefedert werden können.
Auf Basis dieser Entwicklungen und dem oben festgestellten Handlungsbedarf zur Vorbereitung auf Basel II können die Ziele der Arbeit abgeleitet werden, um Grundlagen zu deren Aufbau und Ablauf zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Abgrenzung der Themenstellung
- GRUNDLAGEN
- Abgrenzung KMU
- Definition Mittelstand
- Quantitative Merkmale
- Qualitative Merkmale
- Rating
- Definition
- Abgrenzung zur Kreditwürdigkeitsprüfung
- Abgrenzung zur Unternehmensbewertung
- Abgrenzung zur Bilanzanalyse
- Abgrenzung zur Prüfung
- Basel
- Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
- Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- BASEL II: DIE NEUE BASELER EIGENKAPITALVEREINBARUNG
- Notwendigkeit für die Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- Ziele und Aufgaben der Baseler Eigenkapital-Vereinbarungen
- Chronologie
- Rechtsgrundlagen
- Basel I: Heutiger Stand
- Grundidee und Funktionsweise
- Schwachstellen und Kritik an Basel I
- Basel II, „Der neue Baseler Akkord“
- Erstes Konsultationspapier
- Zweites Konsultationspapier und Drei Säulen Konzept
- Säule Eins: Mindesteigenkapitalanforderungen
- Säule Zwei: Aufsichtsrechtliches Überprüfungsverfahren
- Säule Drei: Marktdisziplin
- Drittes Konsultationspapier
- Kredit-Sicherheiten
- RATING
- Entwicklungslinien
- Ratingvarianten
- Ausprägungen von Ratings
- Unternehmensrating / Mittelstandsrating
- Kreditrating
- Rechtsgrundlagen von Ratings
- Bankenrecht
- Gesellschaftsrecht
- Externes Rating
- Standardansatz
- Retail-Portfolio im Standardansatz
- Prozess eines externen Ratings
- Ratingagenturen - Anbieter externer Ratings
- Bankinternes Rating - IRB-Ansatz
- Basisansatz (Foundation Approach)
- Retailportfolio im IRB-Ansatz
- Fortgeschrittener Ansatz (Advanced Approach)
- Größenanpassung für KMU
- Kritik an den IRB-Ansätzen
- Ratingsymbole, -noten und ihr Aussagengehalt
- AUSWIRKUNGEN AUF KMU
- Einfluss auf Kreditkostenkalkulation der Banken
- Potentiale und Chancen durch Ratings
- Potentiale interner Ratings
- Interne Potentiale interner Ratings
- Externe Potentiale interner Ratings
- Potenziale externer Ratings
- Interne Potentiale externer Ratings
- Externe Potentiale externer Ratings
- Nachteile und Gefahren
- Kosten der Ratings
- Verschlechterung der Finanzierungskonditionen
- Ausschluss bzw. Verwehrung von Bankkrediten
- Entscheidungsgrundlagen: internes / externes Rating
- Fazit
- FINANZIERUNGSALTERNATIVEN
- Außenfinanzierung
- Kreditfinanzierung
- Einlagen- und Beteiligungsfinanzierung
- Hybride Finanzierung
- Kreditsubstitute
- Leasing
- Factoring
- Asset Backed Securities
- Lieferantenkredit
- Innenfinanzierung
- Selbstfinanzierung
- Sonstige Innenfinanzierung
- Aussicht
- RATINGOPTIMIERUNG
- Generelle Ratingkriterien und Risikoanalysemodelle
- Analyse der eigenen Situation
- Einführung - „eigene“ Rating
- Durchführung des eigenen Ratings
- Maximalrisiko-Bestimmung
- Branchen-Rating
- Finanz-Rating
- Erfolgspotentiale
- Zusammenfassung der Teil-Ratings
- Vom Unternehmens- zum Kredit-Rating
- Nutzung der Ergebnisse
- Risikobewältigung
- Rating-Strategien und Ratingadvisory
- Unternehmenswertsteigerung
- Optimierung der Finanzplanung
- Transparenz und Kommunikation
- Kritische Rating-Parameter des Beispielunternehmens
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema Controlling zur Ratingoptimierung für den deutschen Mittelstand vor dem Hintergrund von Basel II. Ziel ist es, die Auswirkungen der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung auf den deutschen Mittelstand zu analysieren und Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Ratingoptimierung zu entwickeln.
- Die Bedeutung von Ratings für die Finanzierungsmöglichkeiten des Mittelstands
- Die Auswirkungen von Basel II auf die Ratingpraxis
- Die Herausforderungen der Ratingoptimierung für mittelständische Unternehmen
- Möglichkeiten und Strategien zur Verbesserung der Rating-Performance
- Die Rolle des Controllings bei der Ratingoptimierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Problemstellung, die Zielsetzung, den Aufbau der Arbeit sowie die Abgrenzung der Themenstellung. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Grundlagen des Themas, indem es die Abgrenzung des Mittelstands, die Definition von Rating sowie die Bedeutung des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht und der Baseler Eigenkapitalvereinbarung beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung Basel II. Es werden die Notwendigkeit, die Ziele und Aufgaben der Vereinbarung sowie die Chronologie ihrer Entwicklung dargestellt. Zudem werden die Grundidee und Funktionsweise von Basel I sowie die Schwachstellen und Kritik an diesem System erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung von Basel II, insbesondere auf dem Drei-Säulen-Konzept, das die Mindesteigenkapitalanforderungen, das aufsichtsrechtliche Überprüfungsverfahren und die Marktdisziplin umfasst.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Thema Rating. Es werden die Entwicklungslinien von Ratings, die verschiedenen Ratingvarianten und die Rechtsgrundlagen von Ratings beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Beschreibung von externen und bankinternen Ratings, wobei die Standardansätze und die IRB-Ansätze im Detail erläutert werden. Zudem werden die Ratingsymbole, -noten und ihr Aussagengehalt dargestellt.
Kapitel 5 analysiert die Auswirkungen von Ratings auf den Mittelstand. Es werden die Einflüsse auf die Kreditkostenkalkulation der Banken, die Potentiale und Chancen durch Ratings sowie die Nachteile und Gefahren von Ratings beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Entscheidungsgrundlagen für die Wahl zwischen internen und externen Ratings.
Kapitel 6 befasst sich mit den Finanzierungsmöglichkeiten des Mittelstands. Es werden die verschiedenen Formen der Außenfinanzierung, wie Kreditfinanzierung, Einlagen- und Beteiligungsfinanzierung, hybride Finanzierung und Kreditsubstitute, sowie die Innenfinanzierung, wie Selbstfinanzierung und sonstige Innenfinanzierung, dargestellt. Zudem wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Finanzierungsmöglichkeiten gegeben.
Kapitel 7 widmet sich der Ratingoptimierung. Es werden generelle Ratingkriterien und Risikoanalysemodelle vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Analyse der eigenen Situation, der Durchführung des eigenen Ratings und der Nutzung der Ergebnisse. Zudem werden die Themen Risikobewältigung, Rating-Strategien und Ratingadvisory, Unternehmenswertsteigerung, Optimierung der Finanzplanung, Transparenz und Kommunikation sowie die kritischen Rating-Parameter des Beispielunternehmens behandelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Controlling, die Ratingoptimierung, den deutschen Mittelstand, Basel II, die Baseler Eigenkapitalvereinbarung, die Kreditkostenkalkulation, die Finanzierungsmöglichkeiten, die Risikoanalyse und die Unternehmenswertsteigerung. Der Text beleuchtet die Auswirkungen der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung auf den Mittelstand und entwickelt Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Ratingoptimierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat Basel II auf den deutschen Mittelstand?
Basel II führt zu einer stärkeren Abhängigkeit der Kreditkonditionen von bankinternen oder externen Ratings, was KMU vor Herausforderungen bei der Eigenkapitalausstattung stellt.
Wie kann das Controlling zur Ratingoptimierung beitragen?
Controlling hilft durch strategische Planung, Liquiditätssteuerung und Transparenz, die Kennzahlen zu verbessern, die für ein positives Rating entscheidend sind.
Was ist der Unterschied zwischen internen und externen Ratings?
Interne Ratings werden von der Hausbank (IRB-Ansatz) durchgeführt, während externe Ratings von spezialisierten Ratingagenturen erstellt werden.
Welche Finanzierungsalternativen gibt es neben dem Bankkredit?
Die Arbeit nennt Leasing, Factoring, Mezzanine-Kapital (hybride Finanzierung) und Beteiligungsfinanzierung als Alternativen zum klassischen Kredit.
Was sind typische Krisenursachen im Mittelstand laut der Arbeit?
Mangelnde strategische Ausrichtung, fehlende Frühaufklärungssysteme und ein unzureichendes internes Rechnungswesen sind häufige Ursachen für Liquiditätskrisen.
- Arbeit zitieren
- Dennis Büttner (Autor:in), 2003, Controlling zur Ratingoptimierung für den deutschen Mittelstand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140624