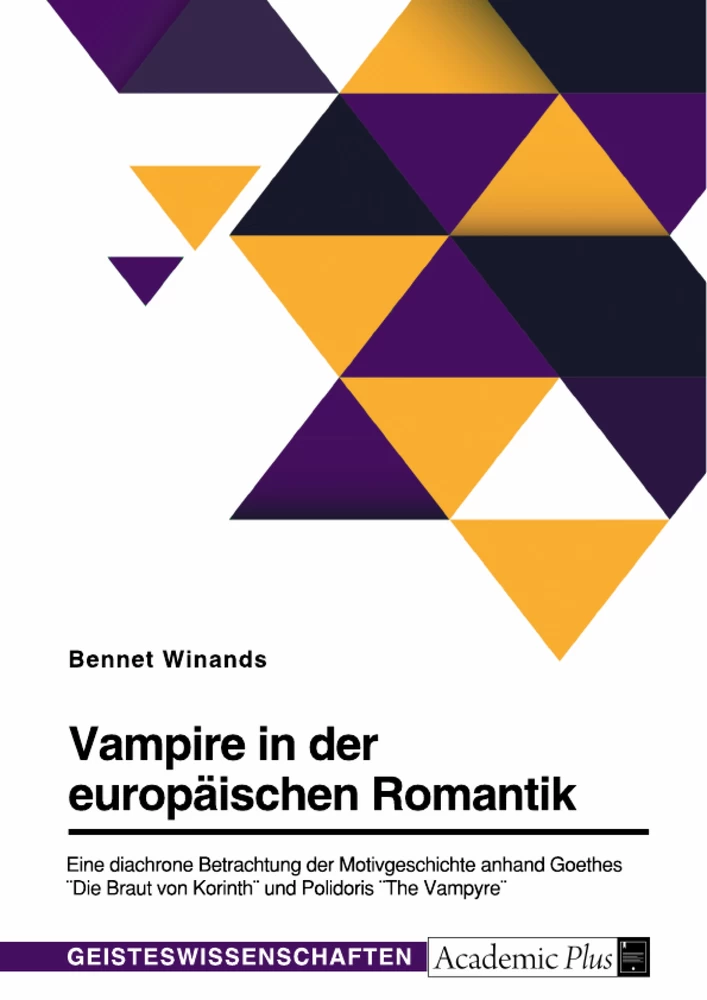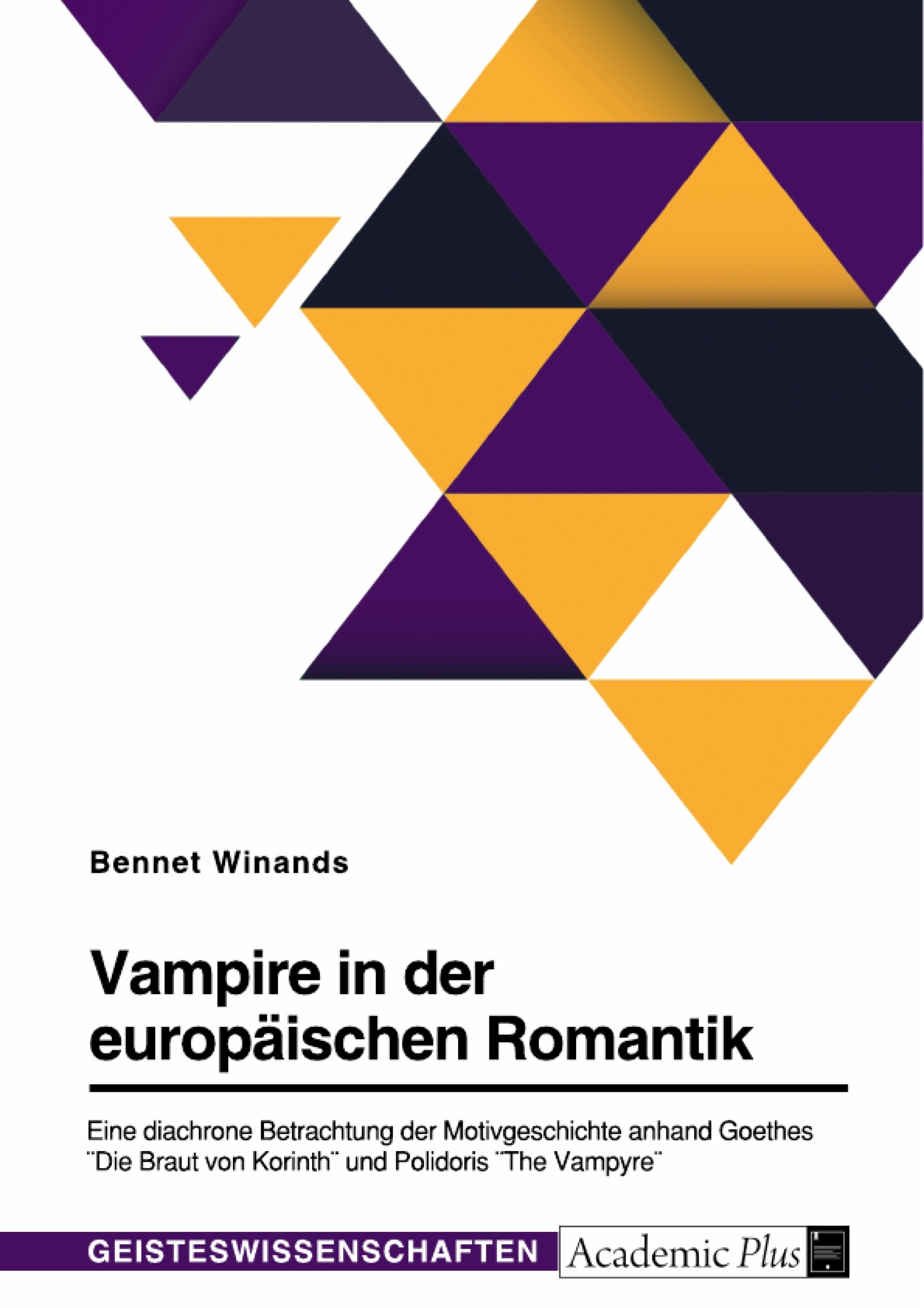In dieser Arbeit steht die eingehende Untersuchung und Analyse des faszinierenden Motivs des Vampirs in der europäischen Romantik im Vordergrund. Konkret werden die beiden ausgewählten Werke, nämlich Johann Wolfgang von Goethes Ballade "Die Braut von Korinth" und John William Polidoris gothic novel "The Vampyre," genauer unter die Lupe genommen.
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit besteht in der Erfassung und Darlegung mehrerer Schlüsselaspekte. Die Entwicklung eines mehrdimensionalen Motivbegriffs bildet den Ausgangspunkt. Dieser dient dazu, eine umfassende Definition des Vampirmotivs zu schaffen, die als Grundlage für die gesamte Analyse dient und die vielfältigen Interpretationen dieses Motivs abdeckt.
Des Weiteren erfolgt die Untersuchung, wie die beiden Autoren Goethe und Polidori das Vampirmotiv in ihren Werken verwenden. Dabei liegt der Fokus auf der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Darstellung des Vampirs sowie deren Funktion und Bedeutung innerhalb der jeweiligen Werke.
Die Arbeit beleuchtet zudem die historische Entwicklung des Vampirmotivs von seinen antiken Ursprüngen bis zur europäischen Romantik. Hierbei wird insbesondere auf die Veränderungen und Innovationen eingegangen, die das Motiv im Laufe der Zeit erfahren hat.
Ein zentrales Anliegen dieser Arbeit ist die metaphernhafte Darstellung gesellschaftlicher und ideologischer Themen im Kontext des Vampirmotivs. Es wird untersucht, wie dieses Motiv als Metapher für gesellschaftliche Strukturen, Unterdrückung und Bemächtigung in den untersuchten Werken eingesetzt wird.
Schließlich werden die Interpretationen von Goethe und Polidori hinsichtlich des Vampirmotivs miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Verwendung des Motivs sowie deren Einbettung in die Romantik zu identifizieren.
Die Ergebnisse dieser Analyse sollen ein umfassendes Verständnis für die Vielfalt und die sich wandelnde Natur des Vampirmotivs in der europäischen Romantik vermitteln. Dabei wird das Motiv des Vampirs nicht nur als literarisches Element betrachtet, sondern auch als Spiegel gesellschaftlicher und ideologischer Entwicklungen dieser Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Motiv und Motivgeschichte
- 2.1. Motiv - Definition und Abgrenzung
- 2.2. Motivgeschichte – Fortführung kollektiver Denkmuster
- 2.3. Motive als Indikator für historische Mentalitäten
- 2.4. Mehrdimensionaler Motivbegriff
- 3. Das Vampirmotiv
- 3.1. Grundlegende Definition
- 3.2. Zentrale Elemente
- 3.2.1. Zwischenfazit
- 3.3. Entstehung und Entwicklung
- 3.3.1. Ursprünge und verwandte Motive
- 3.3.2. Wissenschaftliche Entdeckung und literarische Wiederentdeckung in der europäischen Aufklärung und Romantik
- 4. Die Verwendung des Vampirmotivs bei Goethe und Polidori
- 4.1. Goethes „Die Braut von Korinth“
- 4.1.1. Inhalt und Aufbau
- 4.1.2. Der Vampir in „Die Braut von Korinth“
- 4.1.2.1. Motivtradition und intertextuelle Bezüge
- 4.1.2.2. Konzeption und Funktion des Vampirmotivs in „Die Braut von Korinth“
- 4.1.2.3. Zwischenfazit
- 4.2. Polidoris „The Vampyre“
- 4.2.1. Inhalt und Erzählweise
- 4.2.2. Der Vampir in „The Vampyre“
- 4.2.2.1. Motivtradition und intertextuelle Bezüge
- 4.2.2.2. Konzeption und Funktion des Vampirmotivs in „The Vampyre“
- 4.2.2.3. Zwischenfazit
- 4.3. Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verwendung des Vampirmotivs in Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Die Braut von Korinth“ (1797) und John William Polidoris Gothic Novel „The Vampyre“ (1819). Ziel ist es, die Motivtradition und die jeweilige Konzeption des Vampirs in den beiden Werken zu analysieren, sowie die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung und Funktion des Motivs herauszuarbeiten.
- Motivgeschichte und Entwicklung des Vampirmotivs
- Das Vampirmotiv in „Die Braut von Korinth“ und „The Vampyre“
- Vergleich der beiden Werke
- Funktion des Vampirmotivs als Ausdruck von gesellschaftlichen und ideologischen Konflikten
- Intertextuelle Bezüge und die Bedeutung von Motivtraditionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Vampirmotiv als ambivalenten Bestandteil der Literatur vor. Der Vampir vereint Leben und Tod, Lust und Schrecken und stellt so die Grenzen zwischen gesellschaftlichen und ideologischen Kategorien in Frage.
Kapitel 2 behandelt den Begriff des Motivs und die Entwicklung des Vampirmotivs in der Literaturgeschichte. Hier werden wichtige Elemente wie die Ursprünge des Motivs, die Rolle des Vampirs in der europäischen Aufklärung und die literarische Wiederentdeckung in der Romantik beleuchtet.
In Kapitel 3 werden zentrale Elemente des Vampirmotivs definiert und erläutert. Diese dienen als Grundlage für den Vergleich von „Die Braut von Korinth“ und „The Vampyre“ in Kapitel 4.
Kapitel 4 analysiert Goethes „Die Braut von Korinth“ und Polidoris „The Vampyre“ hinsichtlich der Verwendung des Vampirmotivs. Dabei werden die Motivtraditionen und intertextuellen Bezüge der Werke, die Funktion des Vampirs im jeweiligen Text sowie die Konzeption der Vampirfiguren untersucht.
Schlüsselwörter
Vampirmotiv, Motivgeschichte, „Die Braut von Korinth“, „The Vampyre“, Gothic, Romantik, Aufklärung, Literaturgeschichte, Vergleichende Literaturwissenschaft, Motivtradition, Intertextualität, Funktion des Motivs, gesellschaftliche und ideologische Konflikte, Unterdrückung, Machtstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Vampirmotiv in Goethes "Die Braut von Korinth" dargestellt?
Goethe stellt den Vampir als eine tragische, aus dem Grab zurückkehrende Braut dar, was als Metapher für den Konflikt zwischen Heidentum und Christentum dient.
Was ist die Bedeutung von Polidoris "The Vampyre"?
Polidori schuf mit Lord Ruthven den ersten aristokratischen Vampir der Weltliteratur und prägte damit das Bild des Vampirs als verführerischen, aber tödlichen Gentleman.
Wie entwickelte sich das Vampirmotiv historisch?
Es reicht von antiken Mythen über den wissenschaftlichen Diskurs der Aufklärung bis hin zur literarischen Wiederentdeckung in der Romantik.
Was symbolisiert der Vampir in der europäischen Romantik?
Er dient als Metapher für gesellschaftliche Unterdrückung, verbotene Leidenschaften und das Überschreiten moralischer sowie ideologischer Grenzen.
Welche Gemeinsamkeiten haben Goethe und Polidori in ihrer Darstellung?
Beide nutzen das Motiv, um das Unheimliche und die Ambivalenz zwischen Leben und Tod zu thematisieren, wobei sie den Vampir als Bedrohung für die bestehende Ordnung einsetzen.
- Quote paper
- Bennet Winands (Author), 2022, Vampire in der europäischen Romantik. Eine diachrone Betrachtung der Motivgeschichte anhand Goethes "Die Braut von Korinth" und Polidoris "The Vampyre", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1406291