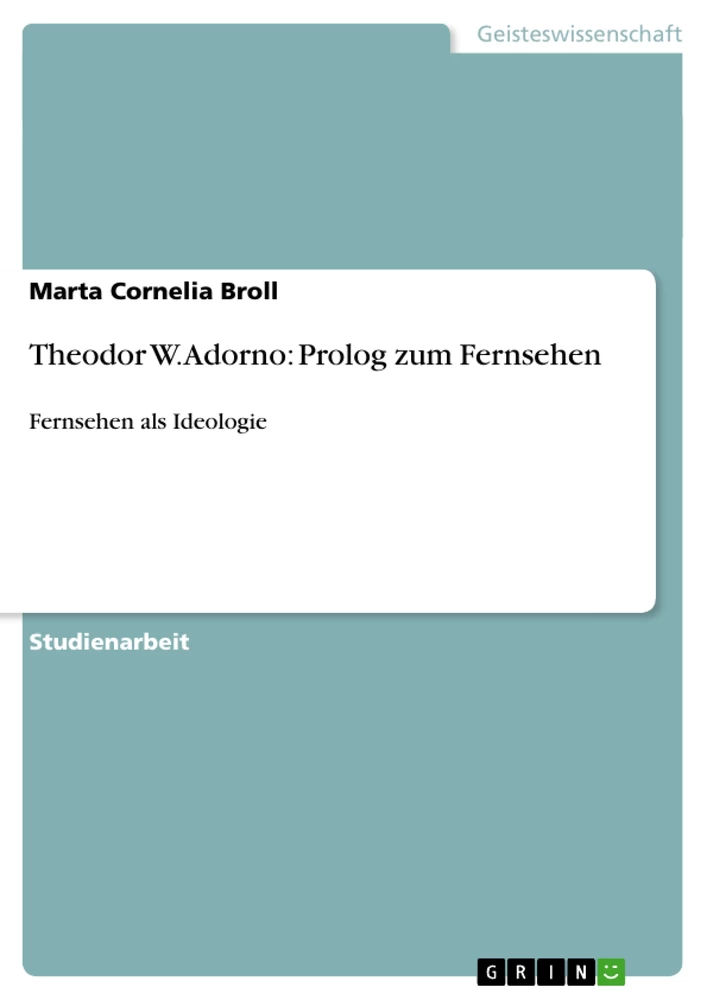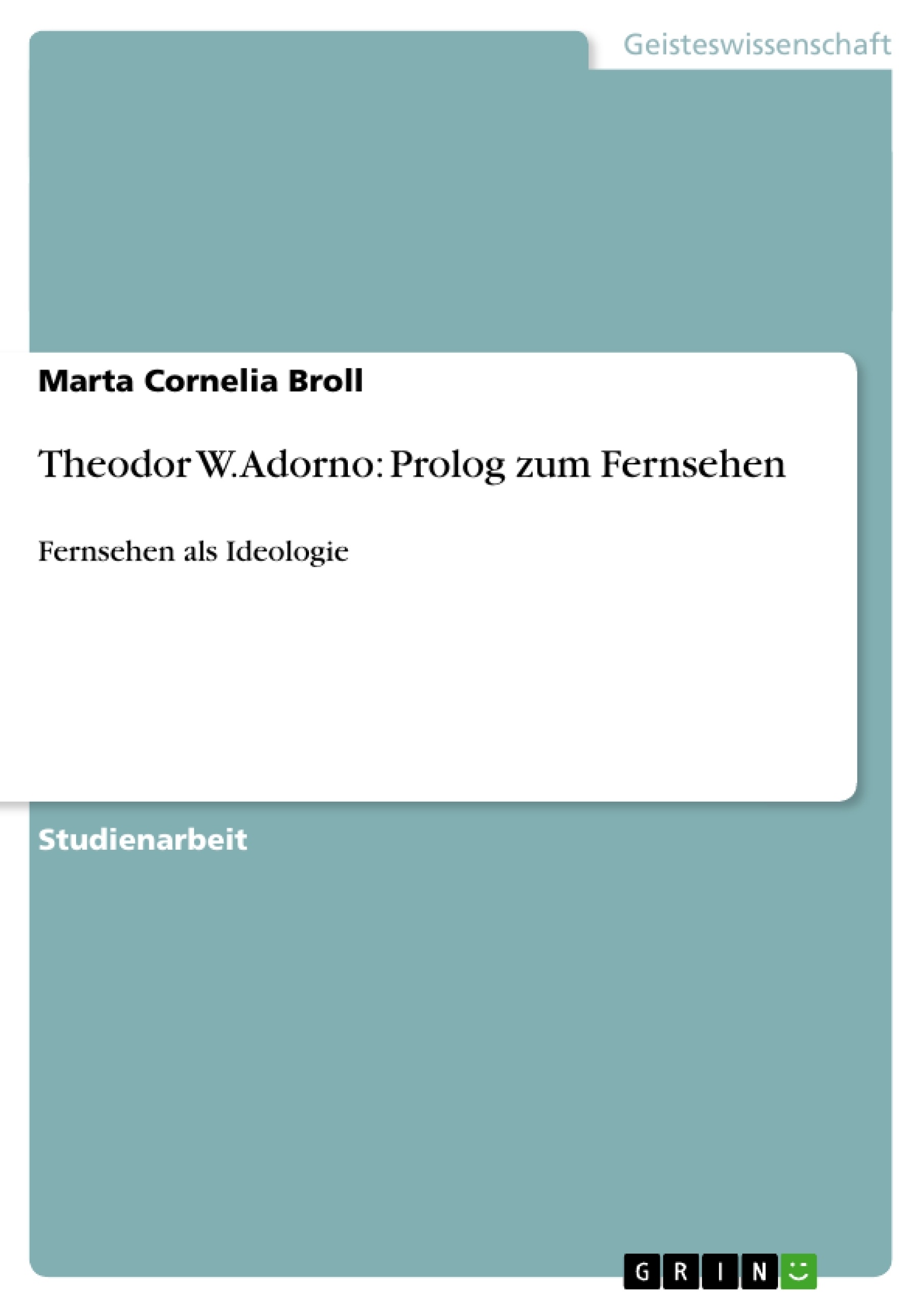Der Verdacht, daß die Realität,
die man serviert, nicht die sei,
für die sie sich ausgibt, wird wachsen.
Theodor W. Adorno: Prolog zum Fernsehen (1953)
Adorno stand zeit seines Lebens kritisch, wenn nicht schon eher pessimistisch in der
Beurteilung und Bewertung neuer Medien gegenüber. Er bezweifelte die Möglichkeit einer
»nachauratischen« neuen Kunst und sprach Rundfunk, Film und Fernsehen absolut jeden
Erkenntniswert ab und das nicht nur im Vergleich zur alten bürgerlichen autonomen Kunst.
Für Adorno bedeutete technische Reproduktion immer einen Verlust, 1959 formulierte er dies
für den Rundfunk folgendermaßen: „So hat in Amerika Edward Suchman in einer ingeniösen Studie dargetan, daß von zwei Vergleichgruppen, die
sogenannte ernste Musik hörten und von denen die eine diese Musik durch lebendige Aufführungen, die andere
nur vom Radio her kannte, die Radiogruppe flacher und verständnisloser reagierte als die erste.“
Für ihn liegt dies nicht ausschließlich an einem möglichen sozialen und/oder
bildungsrelevanten Gefälle zwischen den beiden Untersuchungsgruppen, und ebenso wenig
an der Verwendung des neuen Mediums Rundfunk, sondern an den Eigenarten der
technischen Reproduktion selbst. Das Verfahren der technischen Reproduktion ist untrennbar
mit den Standards der Kulturindustrie, der Verflachung, der Wiederholung und Verdoppelung
etc. verknüpft. Der Inhalt der Ideologien trete stets in seiner Bedeutung hinter deren Form
zurück und so ändert sich „mit der Technik der Verbreitung zugleich das Verbreitete“.
Für Adorno bedinge die Form der technischen Reproduktion automatisch auch den Verlust an
Möglichkeiten zur objektiven Einsicht des reflektierenden Individuums.
Beispielsweise bezweifelte er u. a. auch, ob eine »Rundfunk« -Symphonie überhaupt noch
eine Symphonie genannt werden dürfe. So bewirken beide Prozesse, d.h. also die
Veränderung in der Produktion wie die der technischen Reproduktion und Distribution eine
Vervollkommnung der Reproduktionsleistungen, so dass die Produkte der Kulturindustrie die
Realität immer „realistischer“ abbilden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theodor W. Adorno - "Anwalt des Nicht-Identischen"
- Eine Einführung
- Probleme der Begriffsbestimmung
- Adornos Theorie der Kulturindustrie
- Prolog zum Fernsehen
- Fernsehen als Ideologie
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Theodor W. Adornos Kritik am Fernsehen und seiner Theorie der Kulturindustrie. Ziel ist es, Adornos Analyse des Fernsehens als Ideologie im Kontext seiner umfassenderen Kritik an der Kulturindustrie zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Adorno die technischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Fernsehens als Mittel der Manipulation und Kontrolle des Bewusstseins analysiert.
- Adornos Kritik an der Kulturindustrie und der technischen Reproduktion
- Die Rolle des Fernsehens als Instrument der Ideologie und Manipulation
- Die Auswirkungen der Kulturindustrie auf das Bewusstsein des Einzelnen
- Adornos Konzept der "umgekehrten Psychoanalyse" und die Kritik an der Massenkommunikation
- Die Bedeutung von Adornos Werk für die heutige Medienkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt Adornos kritische Haltung gegenüber neuen Medien, insbesondere dem Fernsehen, dar. Sie beleuchtet seine Kritik an der technischen Reproduktion und deren Auswirkungen auf die Kunst und das Bewusstsein.
Das erste Kapitel widmet sich Adornos Philosophie und seiner Rolle als "Anwalt des Nicht-Identischen". Es beleuchtet seine Kritik an der traditionellen Philosophie und seine Auseinandersetzung mit der Kultur der bürgerlichen Gesellschaft.
Das zweite Kapitel behandelt Adornos Theorie der Kulturindustrie und ihre Bedeutung für seine Analyse des Fernsehens. Es untersucht die Mechanismen der Kulturindustrie, die auf die Manipulation und Kontrolle des Bewusstseins abzielen.
Das dritte Kapitel analysiert Adornos "Prolog zum Fernsehen" und "Fernsehen als Ideologie". Es beleuchtet seine Kritik am Fernsehen als Instrument der Ideologie und Manipulation und untersucht die Auswirkungen der Kulturindustrie auf das deutsche Fernsehen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Theodor W. Adorno, Kulturindustrie, Fernsehen, Ideologie, technische Reproduktion, Massenkommunikation, Manipulation, Bewusstsein, "umgekehrte Psychoanalyse", Kritik, Medienkritik.
- Quote paper
- Marta Cornelia Broll (Author), 2004, Theodor W. Adorno: Prolog zum Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140662