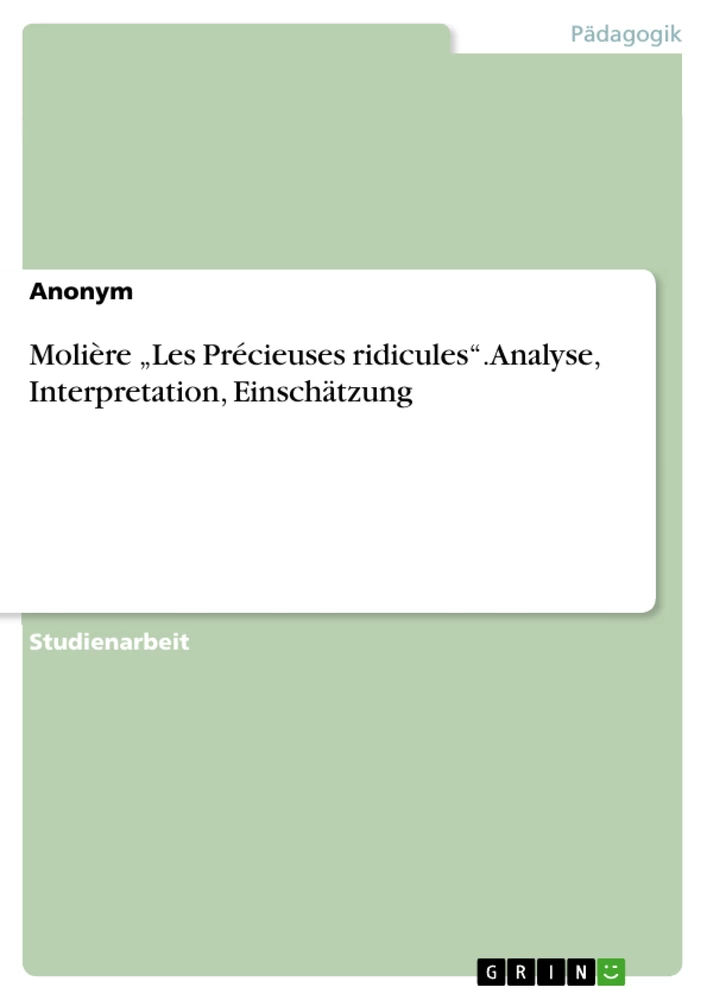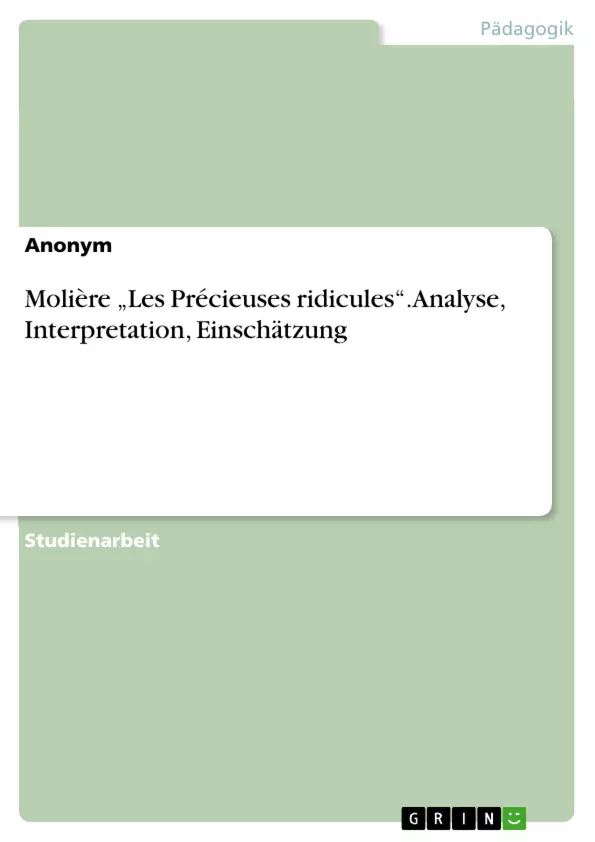Molières 1659 erschienenes Werk „Les Précieuses ridicules“(im Folgenden: PR) erregte die Gemüter verschiedener Gesellschaftsschichten, besonders die der Vertreterinnen der damals populären Salonkultur. Mit den PR löste Molière sich von den komödienhaften, überspitzten Darstellungen eines bizarren Charakters und fing an, satirisch-gesellschaftskritische Komödien zu verfassen. In der nachfolgenden Arbeit wird zunächst eine eingehende Darstellung der Salonkultur im siebzehnten Jahrhundert angefertigt.
Des Weiteren werden die wichtigsten Vertreterinnen dieser „Bewegung“ genannt, ihre Biographien dargelegt und Besonderheiten der einzelnen „Salons“ aufgezeigt.
Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich vorab mit einer bündigen Inhaltsangabe des Werkes PR, gefolgt von einer Darstellung der Umstände, die um dieses Werk kursierte. So wird die Rezeption der PR beleuchtet, speziell unter dem Gesichtspunkt, wie die Preziösen das Werk aufnahmen und was für Konsequenzen Molières lächerliche Darstellung der Salonkultur nach sich zog.
Im Folgenden wird die Charakterisierung der Salonkultur in den PR untersucht und anhand von Textbeispielen belegt. Es werden erste interpretatorische Ansätze erarbeitet, die herausstellen sollen, welche Absichten Molière mit der Darstellung der beiden „Provinzgänse“ Magdelon und Cathos hatte und welche Form der Kritik er an den beiden Protagonisten üben wollte. Anschließend werden die Hauptdarsteller intensiv charakterisiert und anhand von Textzitaten ihrer Lächerlichkeit überführt.
Zum Abschluss dieser Arbeit erfolgt die Schilderung der Reaktionen der Preziösen auf die PR, welche Art von Vorhaltungen gemacht wurden und wer von den preziösen Damen sich auf welche Weise engagierte, diese molièresche Darbietung zu widerlegen. Erarbeitet wird zudem, wen er genau mit seiner Kritik treffen wollte und wie seine Grundeinstellung zu dem Preziösentum seiner Zeit war.
Das Fazit dieser Arbeit stellt eine übergeordnete Darstellung der erarbeiteten Thesen heraus und beantwortet die in der Einleitung aufgeworfenen Frage- und Problemstellungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Salonkultur und Preziösentum im 17. Jahrhundert
- Darstellung/ Begriffsdefinition
- Vertreterinnen der Salonkultur im 17. Jahrhundert
- Madame de Sévigné
- Madame du Deffand
- Ninon de Lenclos
- Madeleine de Scudéry
- ,,Les Précieuses ridicules"
- Inhaltsangabe
- Aufführung und Rezeption
- Darstellung und Analyse der Protagonisten
- Reaktion der Preziösen
- Fazit/Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die soziale Funktion der Komödie bei Molière, insbesondere am Beispiel seines Werkes „Les Précieuses ridicules“. Das Ziel ist es, die damalige Salonkultur und die Preziösentum-Bewegung im 17. Jahrhundert zu beleuchten und Molières satirische Kritik an dieser Kulturform zu analysieren.
- Darstellung der Salonkultur und des Preziösentums im 17. Jahrhundert
- Analyse der Inhaltsangabe und der Rezeption von „Les Précieuses ridicules“
- Charakterisierung der Protagonisten und deren Lächerlichkeit
- Untersuchung der Reaktionen der Preziösen auf Molières Komödie
- Deutung der Intentionen und Kritikpunkte Molières
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Molières Werk „Les Précieuses ridicules“ vor und erläutert dessen Bedeutung als satirische Komödie, die sich von früheren Werken des Autors abhebt. Kapitel 2 widmet sich der Darstellung und Begriffsdefinition der Salonkultur und des Preziösentums im 17. Jahrhundert, wobei die wichtigsten Vertreterinnen dieser Bewegung vorgestellt werden. Kapitel 3 analysiert die Inhaltsangabe von „Les Précieuses ridicules“, beleuchtet die Aufführung und Rezeption sowie die Darstellung und Analyse der Protagonisten. Abschließend werden die Reaktionen der Preziösen auf Molières Komödie diskutiert.
Schlüsselwörter
Salonkultur, Preziösentum, Molière, „Les Précieuses ridicules“, französische Klassik, gesellschaftliche Kritik, satirische Komödie, Frauenbewegung, Emanzipation, Feminismus, „Querelles des femmes“, aristokratisches Bewusstsein, Literatur, Sprache, Kultur, 17. Jahrhundert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Molière „Les Précieuses ridicules“. Analyse, Interpretation, Einschätzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140717