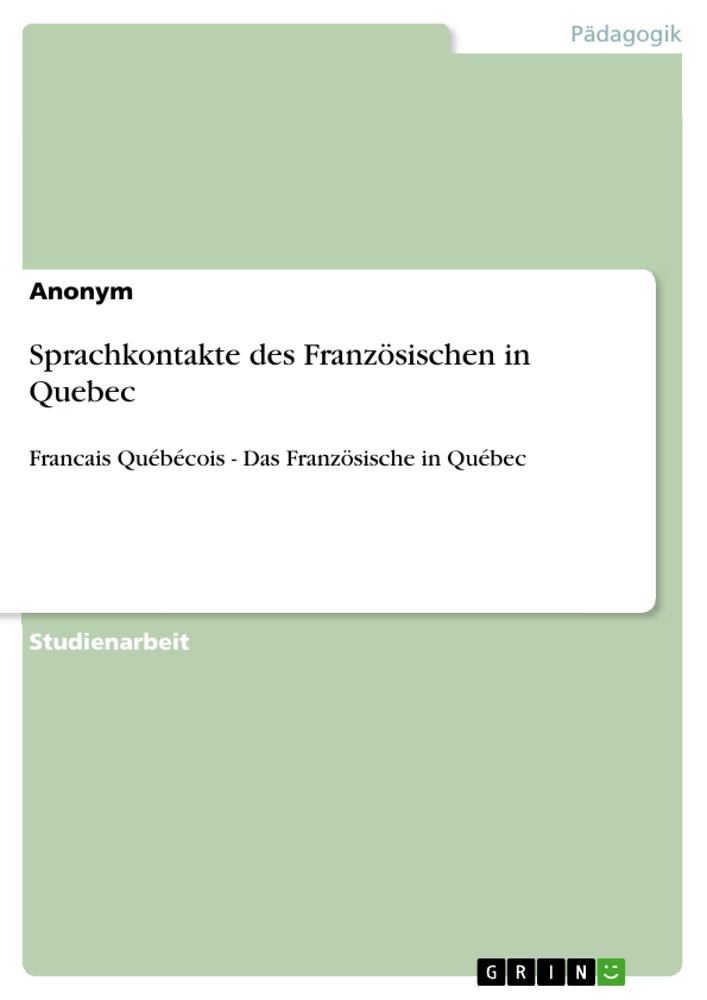[...] Im Folgenden beschäftigt sich diese Arbeit mit den Besonderheiten des kanadischen Französisch. Hierbei werden die Sprachelemente, wie die Morphologie, die Semantik, der Wortschatz und der Syntax analysiert, um einen Einblick in die heutige Form des „Francais québécois“ zu bekommen.
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit der anglophonen Beeinflussung auf die französische Sprache im Laufe der Jahre.
Da die Anglizismen im „Francais québécois“ eine unterschiedliche Form haben und auch verschiedenen Ursprungs sind, ist es unabdingbar, die einzelnen Erscheinungsformen getrennt
voneinander zu betrachten. Auf den verschiedenen Ebenen der Sprachforschung( semantisch, lexikalisch, phonetisch, morphologisch, syntagmatisch) werden die einzelnen Entlehnungen
dargestellt und anhand von Beispielen belegt.
Diese Arbeit wird sich im Folgenden aber ausschließlich mit Anglizismen auseinandersetzen, da die englischen Entlehnungen das Sprachbild des „Francais québécois“ am stärksten prägen.
Andere Entlehnungen, wie den Ameriandismen, die vorwiegend im Sprachbereich der Flora und Fauna auftreten, sowie den Spracheinflüssen der italienischen Sprache werden nicht berücksichtigt, werden an dieser Stelle der Vollständigkeit halber aber genannt.
Die Arbeit hat den Anspruch sich differenziert und ausführlich mit den Anglizismen zu beschäftigen und diese genauer darzustellen.
Zum Abschluss der Arbeit wird versucht, einen Ausblick der Sprachentwicklung des „Francais québécois“ zu geben und Tendenzen, die man in der Zukunft erwarten kann, aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlegende Daten und Informationen zur Provinz Quebec
- 2.1 Aktuelle Sprachverteilung in der Provinz Quebec
- 3. Geschichte Quebecs von der Entdeckung bis 1763
- 4. Die Sprachenfrage in der Kolonialherrschaft
- 4.1 „La Révolution tranquille“
- 4.2 „Office de la langue francaise“ (OLF)
- 5. Besonderheiten des kanadischen Französischen
- 5.1 Bewahrung der älteren Sprachstufe
- 5.2 Aussprache
- 5.3 Morphologie
- 5.4 Syntax
- 5.5 Wortschatz
- 6. Entlehnungen aus dem Englischen (Anglizismen)
- 6.1 « Anglicismes lexicaux »
- 6.2 « Anglicismes d'attraction »
- 6.3 « Anglicismes faux amis »
- 6.4 « Anglicismes de maintien »
- 6.5 « Anglicismes sémantiques »
- 6.6 « Anglicismes de culture »
- 6.7 « Anglicismes syntagmatiques »
- 6.8 « Anglicismes de prononciation »
- 6.9 « Anglicismes morphologiques »
- 6.10 « Anglicismes typographiques »
- 6.11 « Anglicismes de marque »
- 7. Fazit / Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachkontakte des Französischen in Quebec, insbesondere die Auswirkungen des Englischen auf das Quebecois. Ziel ist es, die Entwicklung des Französischen in Quebec vor dem Hintergrund seiner Kolonialgeschichte und der anhaltenden Sprachkonflikte zu analysieren.
- Die Geschichte der französischen Kolonisierung und Besiedlung Quebecs
- Die Rolle der Kolonialmacht und die damit verbundenen Sprachbestimmungen
- Die Entwicklung des "Francais québécois" und seine Besonderheiten
- Die Einflüsse des Englischen auf die französische Sprache in Quebec (Anglizismen)
- Die unterschiedlichen Arten und Ebenen der Anglizismen im Quebecois
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung präsentiert Quebec als ein einzigartiges Beispiel für Sprachentwicklung in einem vom Mutterland entfernten Gebiet. Sie betont die Herausforderungen, denen sich das Französische in einem von anglophonen Gebieten umgebenen Umfeld gegenübersieht und kündigt die Untersuchung der Siedlungsgeschichte und der Sprachenfrage in der Kolonialherrschaft an, um die heutige Form des "Francais québécois" zu verstehen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Anglizismen, die das Sprachbild maßgeblich prägen.
2. Grundlegende Daten und Informationen zur Provinz Quebec: Dieses Kapitel liefert grundlegende geografische und demografische Daten über die Provinz Quebec, einschließlich ihrer Größe, Bevölkerungszahl und der aktuellen Sprachverteilung. Es hebt hervor, dass 80 Prozent der Bevölkerung Französisch als Muttersprache sprechen, während neun Prozent Englisch sprechen. Die Konzentration der englischsprachigen Bevölkerung in Montreal wird ebenfalls erwähnt, ebenso wie die Anwesenheit ethnischer Minderheiten.
3. Geschichte Quebecs von der Entdeckung bis 1763: Das Kapitel beschreibt die Entdeckungsgeschichte Quebecs, beginnend mit John Cabot und Jacques Cartier, der das Gebiet für Frankreich in Besitz nahm. Es beleuchtet die frühen Kolonisationsversuche, die Herausforderungen des harten Winters und die Bedeutung des Pelzhandels für die weitere Entwicklung der Region. Der Name "Quebec" wird im Kontext seiner Algonkin-Wurzeln erklärt, und die strategische Lage am Zusammenfluss der Flüsse St. Charles und St. Lorenz wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Französisch, Quebec, Sprachkontakte, Anglizismen, Kolonialgeschichte, Sprachentwicklung, "Francais québécois", Sprachpolitik, Morphologie, Syntax, Semantik, Wortschatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Sprachkontakte des Französischen in Quebec
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Sprachkontakte des Französischen in Quebec, insbesondere die Auswirkungen des Englischen auf das Quebecois. Sie analysiert die Entwicklung des Französischen in Quebec vor dem Hintergrund seiner Kolonialgeschichte und der anhaltenden Sprachkonflikte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte der französischen Kolonisierung und Besiedlung Quebecs, die Rolle der Kolonialmacht und die damit verbundenen Sprachbestimmungen, die Entwicklung des "Francais québécois" und seine Besonderheiten, die Einflüsse des Englischen auf die französische Sprache in Quebec (Anglizismen) und die unterschiedlichen Arten und Ebenen der Anglizismen im Quebecois.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlegende Daten und Informationen zur Provinz Quebec (inklusive aktueller Sprachverteilung), Geschichte Quebecs von der Entdeckung bis 1763, Die Sprachenfrage in der Kolonialherrschaft ("La Révolution tranquille", "Office de la langue francaise"), Besonderheiten des kanadischen Französischen (Aussprache, Morphologie, Syntax, Wortschatz), Entlehnungen aus dem Englischen (Anglizismen) mit detaillierter Untergliederung verschiedener Anglizismen-Typen und Schlussbemerkung/Fazit.
Welche konkreten Aspekte des kanadischen Französisch werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert die Besonderheiten des kanadischen Französisch, einschließlich der Bewahrung älterer Sprachstufen, der Aussprache, Morphologie, Syntax und des Wortschatzes. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Anglizismen und deren verschiedenen Kategorien ("Anglicismes lexicaux", "Anglicismes d'attraction" etc.).
Wie wird die Bedeutung des Englischen für das Quebecois dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die starken Einflüsse des Englischen auf das Quebecois durch die Analyse von Anglizismen. Sie differenziert zwischen verschiedenen Arten von Anglizismen (lexikalisch, semantisch, syntaktisch, morphologisch, typografisch etc.) und zeigt deren Auswirkung auf die Sprache auf.
Welche Rolle spielt die Kolonialgeschichte?
Die Kolonialgeschichte Quebecs spielt eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für die heutige Sprachsituation bildet. Die Arbeit untersucht die Sprachenfrage während der Kolonialherrschaft und deren Einfluss auf die Entwicklung des "Francais québécois".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Französisch, Quebec, Sprachkontakte, Anglizismen, Kolonialgeschichte, Sprachentwicklung, "Francais québécois", Sprachpolitik, Morphologie, Syntax, Semantik, Wortschatz.
Welche Informationen zur demografischen Situation Quebecs werden gegeben?
Die Arbeit liefert grundlegende demografische Daten zu Quebec, einschließlich Bevölkerungszahl und aktueller Sprachverteilung. Es wird hervorgehoben, dass ca. 80% der Bevölkerung Französisch als Muttersprache sprechen und ca. 9% Englisch. Die Konzentration der englischsprachigen Bevölkerung in Montreal wird ebenfalls erwähnt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung des Französischen in Quebec vor dem Hintergrund seiner Kolonialgeschichte und der anhaltenden Sprachkonflikte zu analysieren und die Auswirkungen des Englischen auf das Quebecois zu untersuchen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2006, Sprachkontakte des Französischen in Quebec, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140726