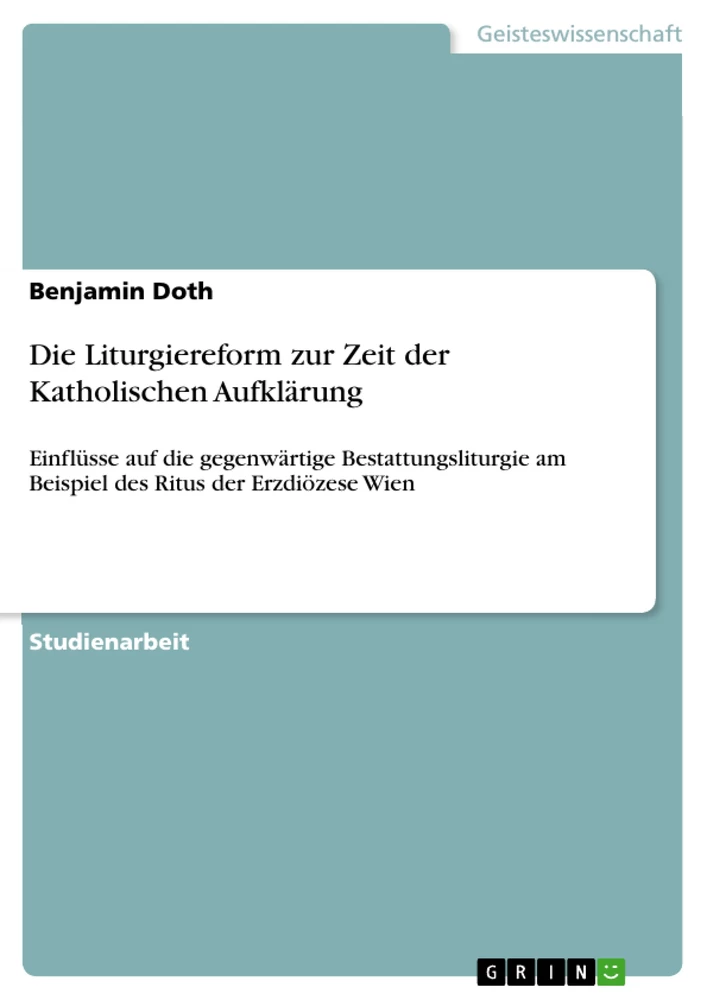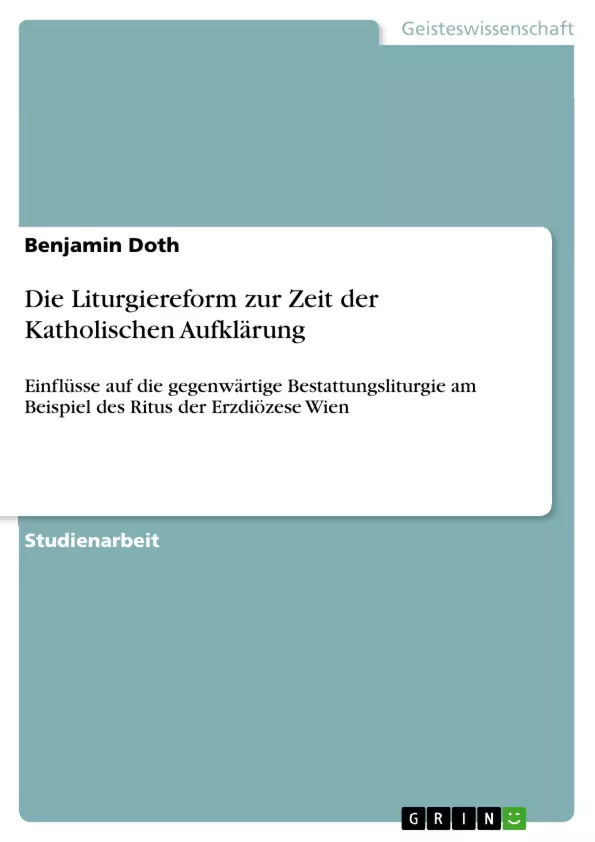„Tote begraben ist ein Werk der leiblichen Barmherzigkeit. Wir ehren die Getauften als Tempel des Heiligen Giestes (KKK 2300). Deshalb hat die Kirche seit alters eine reichhaltige Begräbnisliturgie entfaltet. Dabei ist immer auf regionale Bräuche und Gegebenheiten Rücksicht genommen worden. Man kann sagen, die Begräbnisriten sind gelungene Beispiele der Inkulturation“ (Christoph Kard. Schönborn)I
Das obige Zitat von Christoph Kardinal Schönborn befasst sich mit dem Entstehungsprozess der Begräbnisliturgie. „Dabei ist immer auf regionale Bräuche und Gegebenheiten Rücksicht genommen worden“, schreibt er. Wie kann man sich diesen Entstehungsprozess vorstellen und wo bzw. wann hat er begonnen?
Die folgende Arbeit will sich mit diesen Entstehungsprozessen auseinandersetzen. In wie weit kann gesagt werden, das auf „regionale Bräuche und Gegebenheiten“ Rücksicht genommen wurde?
Diese Arbeit setzt sich mit den Prozessen einer Zeit auseinander, die heute als Aufklärung bekannt ist.
Nicht etwa irgend einer Aufklärung, sondern der Katholischen Aufklärung. Dieser Begriff nun ist nicht so bekannt, wie sein Namensverwandter. Das Präfix „Katholisch“ im Zusammenhang mit dem Passus Aufklärung ist umstritten und längst nicht so weit erforscht wie die Epoche der Aufklärung als Ganzes.
In der Katholischen Aufklärung fanden jedoch liturgische Reformprozesse statt, die eine Nachwirkung bis in das 20. Jahrhundert vermuten lassen.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, diese liturgischen Reformprozesse in ihrem historischen Kontext zu analysieren und am Beispiel der Begräbnisliturgie zu zeigen, inwiefern und ob diese Reformen Einzug in die liturgischen Regula der Katholischen Kirche gefunden haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Begräbnisreform im historischen Kontext
- 1. Aufklärung
- 1.2 Die Katholische Aufklärung
- 1.2.1 Liturgische Reformen in der Katholischen Aufklärung
- II. Analytischer Teil: Die Begräbnisreform als Ausdruck liturgischer Reformen
- 2. Staatliche Vorgaben
- 2.1 Die Etablierung der Deutschen Sprache innerhalb der Begräbnisliturgie
- 2.2 Auswahl des Ritus, Begründung
- 2.3 Der Begriff „Feier“
- 2.4 Das Formular nach Wessenberg
- 2.5 Der Ritus der Erzdiözese Wien - Ein Beispiel für die Aufnahme reformerischer Ideen
- III. Die Aufnahme reformerischer Ideen durch das zweite vatikanische Konzil
- IV. Schlussbemerkung, Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den liturgischen Reformprozesse der Katholischen Aufklärung und analysiert deren Auswirkungen auf die gegenwärtige Bestattungsliturgie, insbesondere am Beispiel des Ritus der Erzdiözese Wien. Die Arbeit zielt darauf ab, die historischen Hintergründe der Reformbemühungen aufzuzeigen und die Frage zu klären, inwieweit und ob diese Reformen in die liturgischen Regeln der Katholischen Kirche Einzug gehalten haben.
- Die Begräbnisreform im Kontext der Katholischen Aufklärung
- Die Etablierung der Deutschen Sprache in der Begräbnisliturgie
- Die Aufnahme reformerischer Ideen durch das zweite vatikanische Konzil
- Der Ritus der Erzdiözese Wien als Beispiel für die Umsetzung liturgischer Reformen
- Der Einfluss der Katholischen Aufklärung auf die gegenwärtige Bestattungsliturgie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem Entstehungsprozess der Begräbnisliturgie und stellt die Frage, wie die „regionalen Bräuche und Gegebenheiten“ in die Liturgie integriert wurden.
Kapitel I befasst sich mit der Begräbnisreform im historischen Kontext und stellt die Aufklärung sowie die Katholische Aufklärung vor. Es wird erläutert, wie die Aufklärer die „Selbstständigkeit des Menschen“ in den Mittelpunkt ihres Denkens stellten und gegen Dogmen und Traditionen argumentierten. Darüber hinaus wird dargestellt, wie die Katholische Aufklärung mit der Frage nach der Vereinbarkeit von überliefertem Glauben und christlichem Leben auseinandersetzte. Die Kapitel umfassen die verschiedenen liturgischen Reformen, die in der Katholischen Aufklärung vorgenommen wurden.
Kapitel II analysiert die Begräbnisreform als Ausdruck liturgischer Reformen. Es werden die staatlichen Vorgaben, die zur Reform führten, beleuchtet, darunter die Etablierung der Deutschen Sprache in der Begräbnisliturgie, die Auswahl des Ritus, die Bedeutung des Begriffs „Feier“ und die Formulierung eines neuen Ritus nach Wessenberg. Des Weiteren wird der Ritus der Erzdiözese Wien als Beispiel für die Aufnahme reformerischer Ideen dargestellt.
Schlüsselwörter
Katholische Aufklärung, Liturgiereform, Begräbnisliturgie, Bestattungsliturgie, Ritus, Deutsche Sprache, Wessenberg, Erzdiözese Wien, Zweites Vatikanisches Konzil.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Katholische Aufklärung?
Eine Epoche, in der versucht wurde, den überlieferten Glauben mit den vernunftbetonten Idealen der Aufklärung zu versöhnen, was zu weitreichenden Reformen führte.
Wie veränderte sich die Begräbnisliturgie in dieser Zeit?
Reformen zielten darauf ab, regionale Bräuche zu integrieren und die Volkssprache (Deutsch) anstelle von Latein in der Liturgie zu etablieren.
Wer war Wessenberg im Kontext der Liturgiereform?
Ignaz Heinrich von Wessenberg war ein bedeutender Reformer, der neue liturgische Formulare entwarf, die das Verständnis der Gläubigen fördern sollten.
Welchen Einfluss hatte die Aufklärung auf das zweite vatikanische Konzil?
Viele Ideen der Katholischen Aufklärung, wie die Nutzung der Muttersprache im Gottesdienst, wurden erst im 20. Jahrhundert durch das Konzil offiziell übernommen.
Was bedeutet "Inkulturation" bei Begräbnisriten?
Es beschreibt den Prozess, bei dem die kirchliche Liturgie an die kulturellen und regionalen Gegebenheiten einer Gemeinschaft angepasst wird.
- Quote paper
- Benjamin Doth (Author), 2007, Die Liturgiereform zur Zeit der Katholischen Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140754