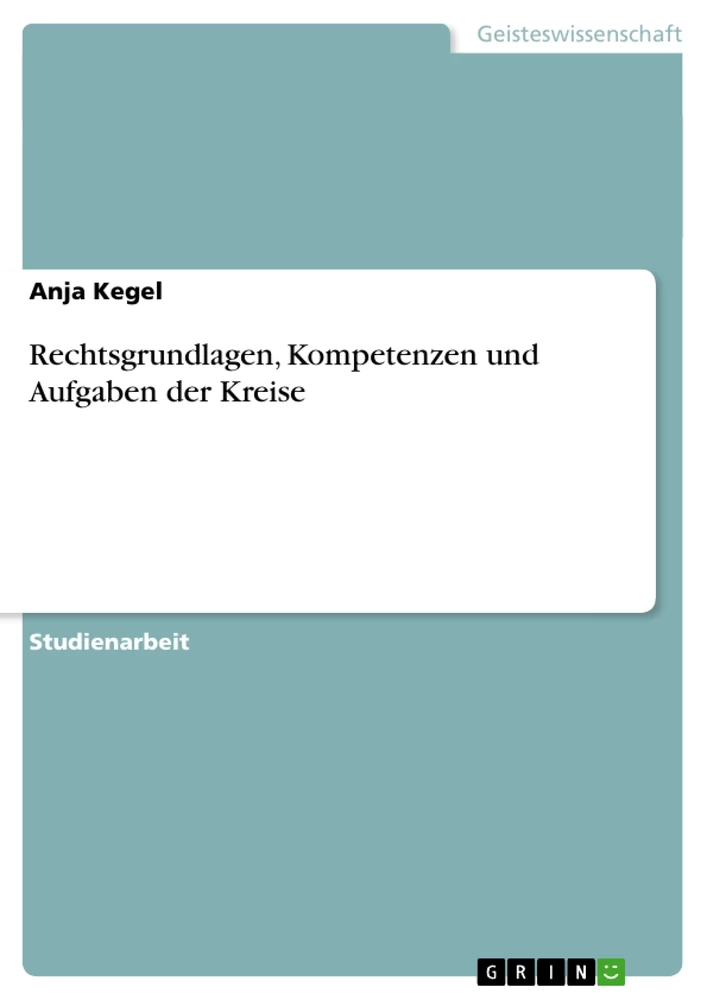Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, entschieden sich die Urheber des Grundgesetzes für den Aufbau eines demokratischen und sozialen Bundesstaates (vgl. Die Aufgaben der Kreise 2002-2008: Fundament des demokratischen Staatswesens). „Unter Föderalismus versteht man ein politisches Grundprinzip, demzufolge sich Einzelstaaten unter Wahrung ihrer Staatlichkeit zu einem Bund zusammenschließen“ (Bogumil/Jann 2005: 57). Die Länder haben neben dem Bund eigene Hoheitsrechte und Zuständigkeiten, mit dem Ziel die Aufgaben zwischen Bund und Länder so aufzuteilen, dass sie auf der Ebene gelöst werden, auf der es am besten möglich ist (vgl. Bogumil/Jann 2005: 57f.). „Beim Landesvollzug von Landesgesetzen führen die Landesbehörden, zu denen auch die Kommunen zählen, die Gesetze selbstständig und ohne Mitsprache des Bundes aus“ (Bogumil/Jann 2005: 62). Ein Landkreis oder auch Kreis wird nach deutschem Kommunalrecht als ein Gemeindeverband und eine Gebietskörperschaft definiert (vgl. Landkreis 2002-2008: Landkreis). Der Kreis ist ein gesetzesabhängiger Selbstverwaltungsträger, denn sein Aufgabenbestand ist abhängig von den Kompetenzzuweisungen durch den jeweiligen Landesgesetzgeber (vgl. Büchner/Klein/Scheske 2006: 10).
Kreise sind alleine der Exekutive zuzuordnen, d.h. die Kommunalvertretung der Kreise – auch wenn sie aus Wahlen hervorgeht – ist somit Organ einer Selbstverwaltungskörperschaft und kein Parlament (vgl. Vogelsang/Lübking/Jahn 1997: 51).
Kreise können daher ihre Handlungsermächtigungen und Einnahmequellen nicht aus eigenem Recht schaffen, sondern benötigen dazu eine gesetzliche Ermächtigung (vgl. Vogelsang/Lübking/Jahn 1997: 52).
Laut Grundgesetz haben Städte, Kreise und Gemeinden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung das Recht, ihre Aufgaben eigenverantwortlich und eigenständig zu erfüllen und die jeweilige Verwaltung plant und handelt auf diese Weise bürgernah (vgl. Aufgaben der Kreise 2002-2008: Eigenverantwortlich und eigenständig).
Viele Gemeinden führen zwar eine Menge Aufgaben selbst aus, aber die Verwaltungsarbeit ist immer umfassender, großräumiger, schwieriger und finanziell aufwendiger geworden (vgl. Aufgaben der Kreise 2002-2008: Unterstützung der kleinen Gemeinden). Meist übersteigt sie das Leistungsvermögen kleiner Gemeinden (vgl. Aufgaben der Kreise 2002-2008: Unterstützung der kleinen Gemeinden).
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Einleitung
- 1.1. Definition und Erläuterung
- 1.2. Historischer Rückblick
- 1.3. Organe des Kreises
- 2.1. Rechtsgrundlagen
- 3.1. Aufgaben (allgemein)
- 3.2. Verwaltungszuständigkeiten
- 3.2.1. Organisations- und Personalverwaltung
- 3.2.2. Finanzverwaltung
- 3.3. weitere Zuständigkeiten
- 3.3.1. Die Kreisstatistik
- 3.3.2. Öffentlichkeitsarbeit
- 3.4. Beispiele für die Aufgabenbereiche der Landkreise
- 3.4.1. Sicherheits- und Ordnungsverwaltung
- 3.4.2. Sozialhilfe
- 4.1. Weisung und Kontrolle
- 5.1. Interessenvertretung aller Landkreise
- 6.1. Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger
- 7.1. Öffentliche und private Organisationen
- 8.1. Wissenswertes
- 9.1. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Rechtsgrundlagen, Kompetenzen und Aufgaben der Kreise in Deutschland. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Rolle der Kreise als Gebietskörperschaften im föderalen System. Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Kreise, ihre Organe und die wichtigsten Aufgabenbereiche, die sie im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wahrnehmen.
- Rechtliche Grundlagen und Kompetenzen der Kreise
- Historische Entwicklung und Bedeutung der Kreise
- Organe und Aufgabenbereiche der Kreisverwaltung
- Bedeutung der Kreise im föderalen System
- Zusammenarbeit und Interaktion zwischen Kreisen und Gemeinden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kreise als Gebietskörperschaften ein und definiert den Begriff des Kreises im deutschen Kommunalrecht. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der Kreise und stellt die wichtigsten Organe des Kreises vor.
Das Kapitel über die Rechtsgrundlagen der Kreise analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufgaben und Kompetenzen der Kreise. Es beleuchtet die Bedeutung des Grundgesetzes und der Landesgesetze für die kommunale Selbstverwaltung und die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.
Das Kapitel über die Aufgaben der Kreise beschreibt die vielfältigen Aufgabenbereiche, die Kreise im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wahrnehmen. Es behandelt die Verwaltungszuständigkeiten der Kreise, wie z.B. die Organisations- und Personalverwaltung, die Finanzverwaltung und die Kreisstatistik. Außerdem werden Beispiele für die Aufgabenbereiche der Landkreise, wie z.B. die Sicherheits- und Ordnungsverwaltung und die Sozialhilfe, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Rechtsgrundlagen, Kompetenzen und Aufgaben der Kreise, die kommunale Selbstverwaltung, die Gebietskörperschaften, die Organe des Kreises, die Verwaltungszuständigkeiten, die Finanzverwaltung, die Kreisstatistik, die Sicherheits- und Ordnungsverwaltung, die Sozialhilfe und die historische Entwicklung der Kreise.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Landkreis im deutschen Recht?
Ein Landkreis (oder Kreis) ist ein Gemeindeverband und eine Gebietskörperschaft, die Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung übernimmt, die über das Leistungsvermögen kleinerer Gemeinden hinausgehen.
Welche Rechtsgrundlagen haben Kreise?
Ihre Stellung ist im Grundgesetz (Art. 28) verankert. Die konkreten Befugnisse und Aufgaben werden jedoch durch die jeweiligen Landesgesetze (Kreisordnungen) der Bundesländer festgelegt.
Welche Aufgaben übernimmt ein Kreis typischerweise?
Zu den Aufgaben gehören die Sozialhilfe, die Abfallentsorgung, der Rettungsdienst, das Gesundheitswesen, die Kfz-Zulassung sowie der Bau und Unterhalt von Kreisstraßen.
Was sind die Organe eines Kreises?
Die Hauptorgane sind der Kreistag (die gewählte Vertretung der Bürger) und der Landrat, der sowohl Leiter der Kreisverwaltung als auch Repräsentant des Kreises ist.
Haben Kreise ein eigenes Parlament?
Nein, der Kreistag ist kein Parlament im legislativen Sinne, sondern ein Organ einer Selbstverwaltungskörperschaft, das der Exekutive zuzuordnen ist.
- Quote paper
- B.A. Politik und Verwaltung, Soziologie Anja Kegel (Author), 2009, Rechtsgrundlagen, Kompetenzen und Aufgaben der Kreise , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140808