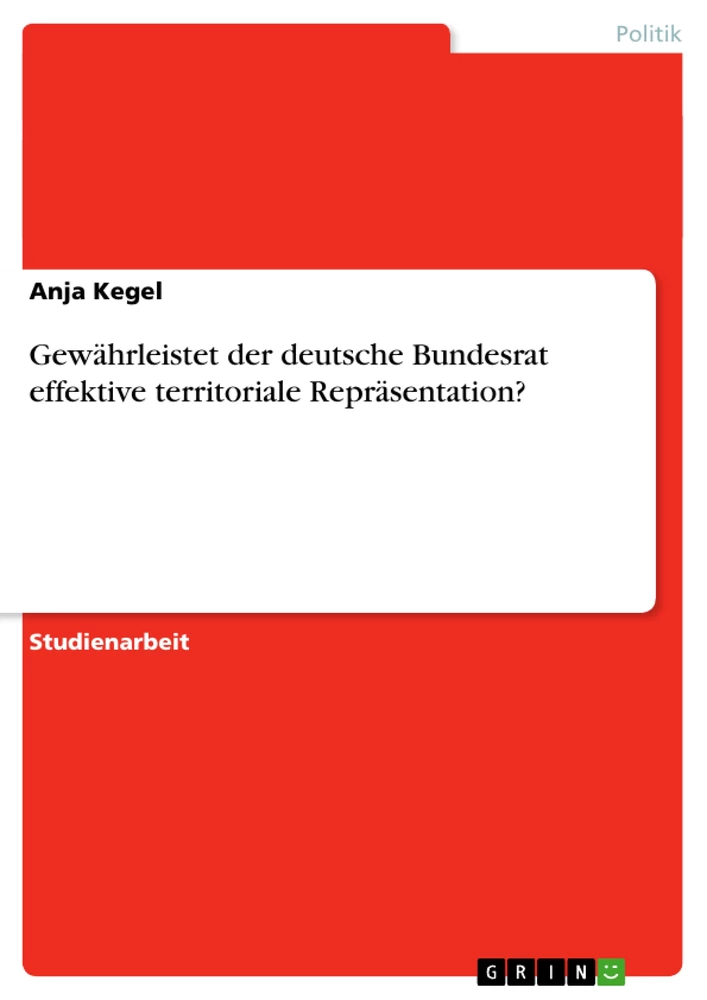Schon Montesquieu war von der Einrichtung einer zweiten Institution überzeugt, die wie er formulierte, für eine funktionierende Gewaltenteilung, folgende Aufgabe hat: „the legislative body being composed of two parts, one checks the other“(Montesquieu, in Tsebelis 1997: 1).
Heutzutage sind ungefähr in ein Drittel aller Staaten der Welt bikamerale Strukturen nachweisbar. Bikameralismus bedeutet eine zweigliedrige Parlamentsstruktur, in denen die Zweite Kammer andere Interessen als die Erste Kammer vertritt. Von Oberhaus zu Oberhaus variiert die Art der Interessenvertretung – ethnische, sprachliche, politische Minderheiten usw. können in Zweiten Kammern repräsentiert werden.
In meiner Hausarbeit habe ich mich mit der territorialen Repräsentation am Beispiel des Deutschen Bundesrates beschäftigt. Ich habe versucht, zu erklären ob man im Bundesrat tatsächlich von effektiver territorialer Interessenvertretung ausgehen kann. Dafür habe ich im Abschnitt 3.1. mit einer allgemeinen Erklärung des Begriffs Bikameralismus begonnen, d.h. ich bin auf die folgenden Aspekte genauer eingegangen: was ist Bikameralismus, seit wann gibt es Zweite Kammern und warum.
Anschließend habe ich mich auf die territoriale Repräsentation konzentriert. Im Abschnitt 3.2.1 habe ich daher zuerst territoriale Repräsentation im Allgemeinen vorgestellt. Bevor ich dann die Kriterien der territorialen Repräsentation am Beispiel des Deutschen Bundesrates erläutere, habe ich diese Merkmale im vorangegangenen Abschnitt vorgestellt.
Dem Abschnitt 3.3 habe ich dem Föderalismus gewidmet, der eine entscheidende Rolle für den Bundesrat spielt – besser gesagt ohne Föderalismus wäre kein Bundesrat nötig. Hierfür bin ich explizit auf die historische Entwicklung des Deutschen Bundesrates, seine Funktionen, speziell im Gesetzgebungsprozess und seine Besonderheiten bei der Zusammensetzung, der Sitzverteilung und der Rolle des Vermittlungsausschusses eingegangen.
Abschließend habe ich dann im Fazit versucht, die Ausgangsfrage, ob der Bundesrat effektive territoriale Repräsentation tatsächlich gewährleistet, zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zweite Kammern – was wird unter dem Begriff Bikameralismus verstanden, warum gibt es Zweite Kammern und seit wann?
- Territoriale Repräsentation
- Was ist theoretisch unter territorialer Repräsentation zu verstehen und wofür wird sie benötigt?
- Ursachen, Maßnahmen und die Wirkung von territorialer Repräsentation im Allgemeinen
- Ursachen, Maßnahmen und die Wirkung von territorialer Repräsentation im Deutschen Bundesrat
- Föderalismus
- Entstehung des bundesdeutschen Föderalismus: die historische Entwicklung des Deutschen Bundesrates und seine heutige Stellung
- Funktionen des Bundesrates, besonders in der Gesetzgebung
- Besonderheiten bei der Zusammensetzung des Deutschen Bundesrates, der Sitzverteilung und die Rolle des Vermittlungsausschusses
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Frage, ob der Deutsche Bundesrat eine effektive territoriale Repräsentation gewährleistet. Sie analysiert die Funktionsweise des Bundesrates im Kontext des deutschen Föderalismus und beleuchtet die Rolle der Zweiten Kammer in der Gesetzgebung. Die Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der territorialen Repräsentation und untersucht, inwieweit der Bundesrat diese Prinzipien in der Praxis umsetzt.
- Bikameralismus und die Rolle der Zweiten Kammer
- Territoriale Repräsentation als Konzept und ihre Bedeutung
- Der Deutsche Bundesrat als Institution der territorialen Interessenvertretung
- Der Einfluss des Föderalismus auf die Funktionsweise des Bundesrates
- Die Effektivität der territorialen Repräsentation durch den Bundesrat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der territorialen Repräsentation im Deutschen Bundesrat ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Sie erläutert den Begriff des Bikameralismus und die verschiedenen Funktionen von Zweiten Kammern in parlamentarischen Systemen.
Das Kapitel „Zweite Kammern“ beleuchtet die historische Entwicklung des Bikameralismus und die verschiedenen Gründe für die Einrichtung von Zweiten Kammern. Es werden verschiedene Modelle von Zweitkammern vorgestellt und ihre Funktionen im Vergleich zu den Ersten Kammern analysiert.
Das Kapitel „Territoriale Repräsentation“ definiert den Begriff der territorialen Repräsentation und untersucht die theoretischen Grundlagen und die Bedeutung dieses Konzepts. Es werden verschiedene Ansätze zur Messung der Effektivität territorialer Repräsentation vorgestellt.
Das Kapitel „Föderalismus“ beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des deutschen Föderalismus und die Rolle des Bundesrates in diesem System. Es werden die Funktionen des Bundesrates in der Gesetzgebung und die Besonderheiten seiner Zusammensetzung und Sitzverteilung erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Deutschen Bundesrat, die territoriale Repräsentation, den Bikameralismus, den Föderalismus, die Gesetzgebung und die Interessenvertretung der Bundesländer. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise des Bundesrates im Kontext des deutschen Föderalismus und untersucht, inwieweit er eine effektive territoriale Repräsentation gewährleistet.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Bikameralismus?
Bikameralismus bezeichnet ein parlamentarisches System mit zwei Kammern, wobei die zweite Kammer oft spezifische Interessen (z. B. Regionen oder Minderheiten) vertritt.
Welche Aufgabe hat der Bundesrat im deutschen Föderalismus?
Der Bundesrat dient der territorialen Repräsentation der Bundesländer und wirkt maßgeblich an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit.
Wie werden die Sitze im Bundesrat verteilt?
Die Sitzverteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl der Länder, wobei ein degressiv proportionales System sicherstellt, dass auch kleinere Länder angemessen vertreten sind.
Was ist die Rolle des Vermittlungsausschusses?
Der Vermittlungsausschuss sucht nach Kompromissen, wenn Bundestag und Bundesrat bei zustimmungspflichtigen Gesetzen keine Einigung erzielen.
Gewährleistet der Bundesrat eine effektive territoriale Repräsentation?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und beleuchtet, inwieweit parteipolitische Interessen die eigentlich territoriale Interessenvertretung überlagern können.
- Citation du texte
- B.A. Politik und Verwaltung, Soziologie Anja Kegel (Auteur), 2008, Gewährleistet der deutsche Bundesrat effektive territoriale Repräsentation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140809