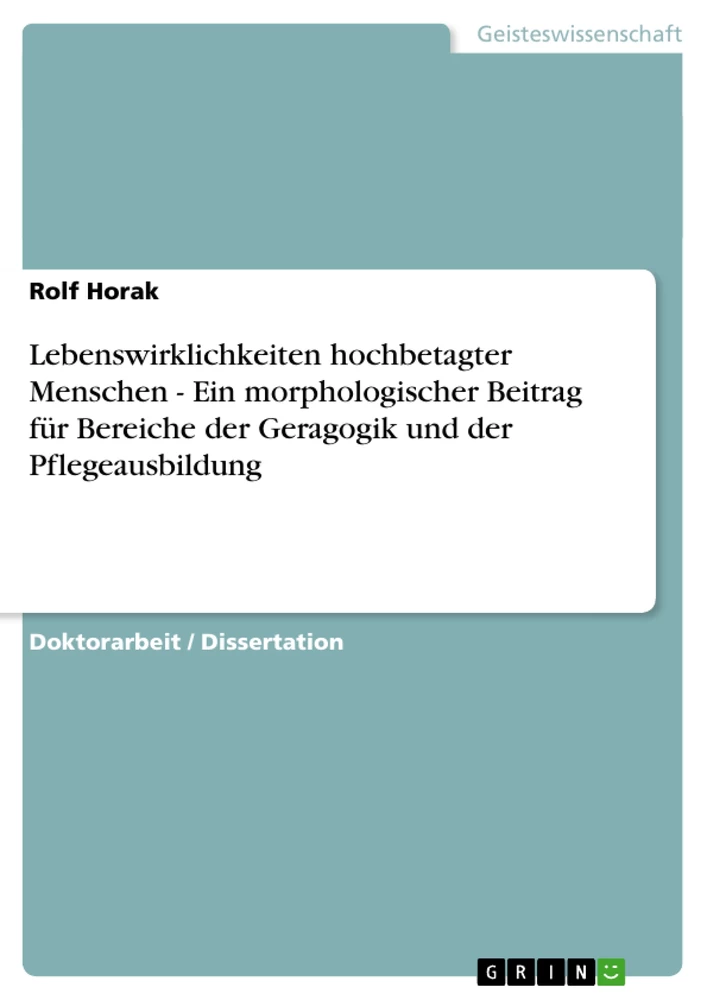Seit einigen Jahren scheinen alte Menschen zunehmend ins Blickfeld von Politik und Öffentlichkeit zu geraten. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß in diesem Zusammenhang vor allem die zukünftige Bevölkerungsentwicklung mit großer Sorge betrachtet wird. Der Rückgang der Geburtenrate und die Zunahme der älteren Menschen drehen die Bevölkerungspyramide (vgl. Abb. 1) auf den Kopf,1 eine „dramatische demo-graphische Entwicklung”2 bahnt sich an, immer weni-ger Menschen, die im Arbeitsprozeß stehen, versorgen immer mehr alte Menschen. Die Sicherung der Renten ist ein regelmäßig wiederkehrendes Problem des Bundeshaushal-tes sowie ein immer aktuelles Wahlkampfthema. Auch die langanhaltende und intensive Debatte um die sog. Pflegeversicherung zeigte, daß die erwartete ,Überalterung‘ der Bundesrepublik jetzt schon ihre Schatten vorauswirft und es wird befürchtet, daß durch die Alten „die Generationensolidarität vor eine Bewährungsprobe”3 gestellt wird. Gleichzeitig bilden die alten Menschen jedoch auch einen nicht zu unterschätzenden Wirtschaftsfaktor: etwa 20% „der Verfügungseinkommen der Privathaushalte werden durch Privathaushalte gestellt, die diese über die Altersversorgung beziehen”.4 Nicht nur die bekannten ,Kaffeefahrten für Senioren‘ haben Hochkonjunktur,
immer mehr Angebote der Freizeitindustrie richten sich speziell an alte Menschen,
da hier ein großes Potential an finanziellen Mitteln einerseits und Freizeit andererseits
gesehen wird.5
!! Abbildung ist nur in der PDF-Version enthalten !!
Abb. 1: Veränderungen der Bevölkerungspyramide
Quelle: Statistisches Bundesamt
Betrachtet man allein dieses politische und ökonomische Interesse, so nimmt es auch nicht Wunder, daß die alten Menschen immer häufiger im Mittelpunkt multidisziplinärer Forschung stehen. Waren es zunächst vor allem Mediziner, die sich mit den (pathologischen) Altersveränderungen auseinandersetzten6, sind es heute auch Soziologen, Pädagogen, Psychologen, Pharmakologen, Biochemiker und zunehmend auch Gentechniker, die sich des Themas ,Alter‘ annehmen. Die Gerontologie als eigenständige Disziplin begann sich in Deutschland Ende der sechziger Jahre von der Geriatrie – als medizinischer Krankheitslehre des Alters – abzulösen und versuchte, die bisher gefundenen Daten und Fakten zu ordnen und sie in ein allgemeines Modell des Alterns einzubinden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Altersideal
- Forschungsinteresse, Intervention und Altersideal
- Erziehungswissenschaft und Gerontologie
- ,Erziehung' und ,Bildung in der Geragogik
- Geragogische Praxis: ausgewählte Beispiele
- Biographiearbeit mit alten Menschen
- Geragogik und Pflegeausbildung
- Implikationen für die Fragestellung
- Theorie und Methode der Untersuchung
- Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten
- Lebenswirklichkeit als Wirkungseinheit: die morphologische Sichtweise
- Gestaltbildung und -umbildung: Auffassungsweisen und Analyse
- Die Wirkungseinheit als Bezugs- und Erklärungssystem
- Darstellung des morphologischen Vorgehens: von den ,Phänomenen‘ zu den ,Erklärungen‘
- Charakteristik des Untersuchungsmaterials
- Lebenswirklichkeiten hochbetagter Menschen als Entwicklungsnotwendigkeit
- Lebenswirklichkeiten alter Menschen: Vorannahmen
- Erste Bilanz der Interviews: das Leben als Schnittmuster
- Absetzbewegungen
- Geschichtlichkeit
- Erlebte Vorteile des Alters
- Einschränkungen und Verluste
- Zukunftsperspektiven
- Sterben und Tod
- Zusammenfassung: Identität und Entwicklung
- Psychologisierung der Fragestellung
- Das Spannungsfeld der Wirkungseinheit: Sein ist Werden
- Die Gestaltfaktoren
- „Form(en) bewahren“
- ,,Unveränderlichkeit“
- „Bewältigen“
- „Bewertungen“
- „Fügungen“
- „Aufbrüche❝
- Das Konstruktionsproblem: Leben in der Schwebe
- Typische Lebenswirklichkeiten im hohen Alter: Geschichten um Geschichte
- Die Typisierungen
- Die Biographen
- Die Penaten
- Die Erstarrten
- Die Opfer
- Die Kranken
- Die aktiven Kranken
- Die resignierten Kranken
- Die jungen' Alten
- Vergleich der Typisierungen: Schweben als Kunst
- Exkurs: die Demenz als Schwebezustand
- Lebenswirklichkeiten und geragogische Konzeptionen
- Biographiearbeit in der Schwebe
- Geragogische Arbeit mit dementen Menschen
- Zergliedernde vs. verstehende Sichtweise: Konsequenzen für die Pflegeausbildung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation von Rolf Horak befasst sich mit den Lebenswirklichkeiten hochbetagter Menschen und liefert einen morphologischen Beitrag für Bereiche der Geragogik und der Pflegeausbildung. Die Arbeit analysiert die Lebenswirklichkeiten alter Menschen unter der Perspektive der morphologischen Methode und trägt zur theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit dem Altersprozess bei.
- Die Analyse der Lebenswirklichkeiten hochbetagter Menschen
- Die Bedeutung der morphologischen Methode für die Geragogik und Pflegeausbildung
- Die Entwicklung von geragogischen Konzepten für die Arbeit mit alten Menschen
- Die Berücksichtigung von individuellen Lebensgeschichten und -erfahrungen im Alter
- Die Herausforderungen und Chancen des Alterns in einer modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Lebenswirklichkeiten hochbetagter Menschen ein und beleuchtet die aktuelle gesellschaftliche Bedeutung des Alterns. Sie stellt das Forschungsinteresse, die Intervention und das Altersideal in den Mittelpunkt und setzt die Arbeit in den Kontext der Erziehungswissenschaft und Gerontologie. Im Fokus stehen die Bedeutung von ,Erziehung' und ,Bildung' in der Geragogik sowie ausgewählte Beispiele aus der geragogischen Praxis, insbesondere die Biographiearbeit mit alten Menschen und die Geragogik in der Pflegeausbildung.
Im zweiten Kapitel werden Theorie und Methode der Untersuchung erläutert. Es werden Lebenswelten und Lebenswirklichkeiten von hochbetagten Menschen betrachtet und die morphologische Sichtweise als Analysemethode vorgestellt. Dieses Kapitel beleuchtet die Gestaltbildung und -umbildung, die Wirkungseinheit als Bezugs- und Erklärungssystem und die Methodik des morphologischen Vorgehens, das von ,Phänomenen‘ zu ,Erklärungen‘ führt. Schließlich wird die Charakteristik des Untersuchungsmaterials näher betrachtet.
Kapitel 3 befasst sich mit den Lebenswirklichkeiten hochbetagter Menschen als Entwicklungsnotwendigkeit. Es werden Vorannahmen zu den Lebenswirklichkeiten alter Menschen vorgestellt und eine erste Bilanz der Interviews gezogen. Die Analyse des Lebens als Schnittmuster, mit Schwerpunkten auf Absetzbewegungen, Geschichtlichkeit, erlebten Vorteilen des Alters, Einschränkungen und Verlusten, Zukunftsperspektiven und Sterben und Tod, steht im Fokus dieses Kapitels. Die Zusammenfassung dieses Kapitels beleuchtet die Aspekte von Identität und Entwicklung im hohen Alter, und die Psychologisierung der Fragestellung wird erörtert.
Kapitel 4 widmet sich dem Spannungsfeld der Wirkungseinheit ,Sein ist Werden‘ und analysiert die Gestaltfaktoren wie ,Form(en) bewahren‘, ,,Unveränderlichkeit“, ,Bewältigen‘, ,Bewertungen‘, ,Fügungen‘ und ,Aufbrüche‘. Weiterhin wird das Konstruktionsproblem ,Leben in der Schwebe‘ beleuchtet.
Kapitel 5 stellt typische Lebenswirklichkeiten im hohen Alter anhand von Geschichten um Geschichte vor. Es werden verschiedene Typisierungen von hochbetagten Menschen, wie die Biographen, die Penaten, die Erstarrten, die Opfer, die Kranken (einschließlich der aktiven und resignierten Kranken) und die ,jungen' Alten, vorgestellt. Das Kapitel analysiert die Typisierungen im Vergleich und verdeutlicht das Schweben als Kunst. Ein Exkurs beschäftigt sich mit der Demenz als Schwebezustand.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Lebenswirklichkeiten, hochbetagte Menschen, Geragogik, Pflegeausbildung, morphologische Methode, Wirkungseinheit, Gestaltbildung, Lebenswelten, Identität, Entwicklung, Altersprozess, Typisierung, Demenz, Schwebezustand, Biographiearbeit und geragogische Konzeptionen. Die Arbeit betont die Relevanz der morphologischen Sichtweise und die Einbeziehung von individuellen Lebensgeschichten in der Arbeit mit alten Menschen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der morphologische Ansatz in der Gerontologie?
Dieser Ansatz betrachtet Lebenswirklichkeiten als „Wirkungseinheiten“ und analysiert die Gestaltbildung und -umbildung im Altersprozess jenseits rein medizinischer Daten.
Welche Typisierungen von hochbetagten Menschen gibt es?
Die Arbeit unterscheidet Typen wie die Biographen, die Penaten (Hausbezogene), die Erstarrten, die Opfer, die Kranken und die „jungen Alten“.
Was versteht man unter „Leben in der Schwebe“?
Es beschreibt den Zustand im hohen Alter, in dem Identität zwischen Bewahrung der Form und notwendigen Aufbrüchen oder Verlusten ständig neu austariert werden muss.
Welche Bedeutung hat die Biographiearbeit in der Pflege?
Sie ermöglicht es, den alten Menschen als Individuum mit einer Geschichte wahrzunehmen, was besonders in der Arbeit mit dementen Menschen die Betreuungsqualität erhöht.
Wie wirkt sich die Demographie auf die Geragogik aus?
Die zunehmende Zahl älterer Menschen erfordert neue pädagogische Konzepte (Geragogik), die Bildung und Teilhabe bis ins hohe Alter fördern.
- Quote paper
- Rolf Horak (Author), 2002, Lebenswirklichkeiten hochbetagter Menschen - Ein morphologischer Beitrag für Bereiche der Geragogik und der Pflegeausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14083