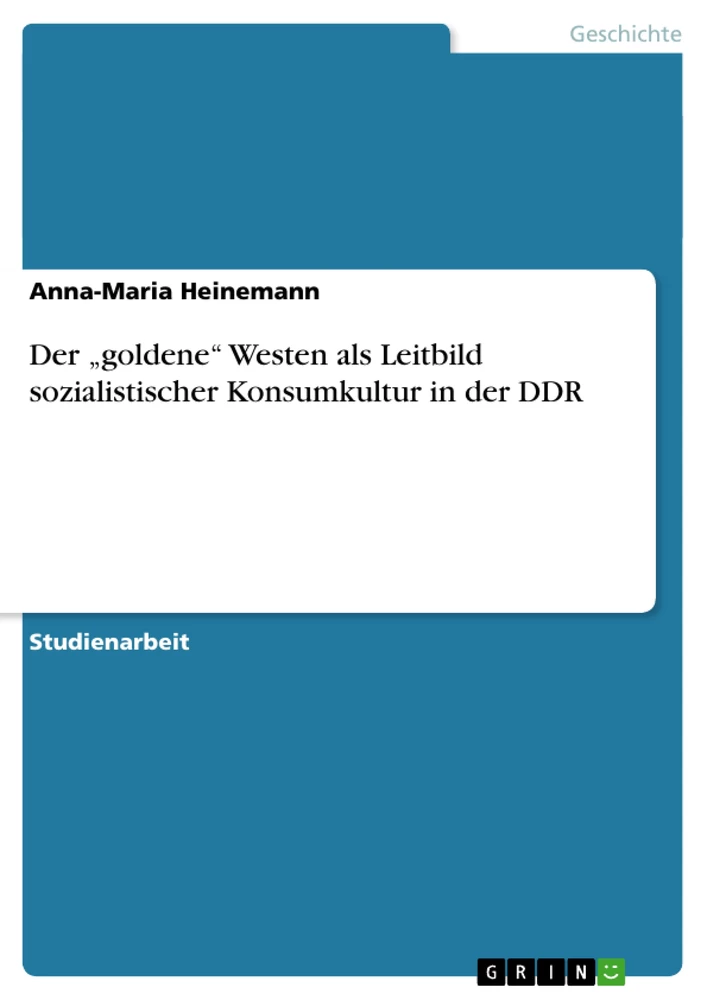Der "goldene Westen" ist als Metapher für die fantastische Vorstellung vieler ostdeutscher Bürger von der BRD zu gebrauchen – unendliche Möglichkeiten des Konsumierens, beträchtliche Chancen zu Wohlstand zu kommen, ungehinderter Bewegungsfreiraum und viel individuelle Entscheidungsfreiheit.
Wie diese Vorstellung entstehen konnte und was für Auswirkungen sie hatte, soll in der vorliegenden Arbeit erörtert werden. Dabei geht es weniger um die politische Dimension des Ost-West-Vergleichs – während die Westorientierung der realsozialistischen Politik und ihrer Vertreter oft eher sublim verraten wurde und erkennbar war, trat sie im Alltag der DDR-Bürger offensichtlich zutage. Alltag, der gerade am Gebrauchsgegenstand gut ablesbar ist; deshalb leistet ein Blick auf die Konsumgewohnheiten einen wichtigen Beitrag zur Schreibung der Alltagsgeschichte, an der widerum politische und gesellschaftliche Gegebenheiten und Prozesse verdeutlicht werden können. So sagt z.B. die Erlebniswelt der Plattenbauten auch etwas über das sozialistische Urbanisierungs-System aus; modernisierte Haushaltsgeräte hingegen verraten Einzelheiten des Genderdiskurses.
Die sechziger Jahre als gewählten Zeitraum bieten sich zur intensiveren Betrachtung deshalb an, weil die Nachkriegszeit als Phase der unmittelbaren Bedarfsdeckung vorbei war und nun auch gehobene Bedürfnisse empfunden und geäußert werden konnten. Außerdem spielte der Kalte Krieg als wichtiger politischer Faktor in den DDR-Alltag mit hinein: allein der Mauerbau 1961 bedeutete Stabilisierung des Landes einerseits und den Zwang, sich mit der Situation abzufinden bzw. sich darin einzurichten, andererseits. Dass der Wettstreit des kommunistischen gegen das kapitalistische System nicht nur im Bereich der Aufrüstung und Raumfahrt, sondern
auch im Haushalt geführt wurde, unterstreicht die Bedeutung konsumkultureller Eigenheiten im Alltag der DDR.
Die Gründe dafür, dass man sich bei diesem Vergleich häufig als Verlierer einstufte, sei es aufgrund offensichtlicher Misswirtschaft oder den damit einhergehenden Qualitäts- und Quantitätsmängeln bei Waren, werden angeschnitten, jedoch aus Platzmangel nicht näher analysiert. Die ungünstige Lage als gegeben hinnehmend geraten eher die Auswirkungen ins Blickfeld: Wie gingen die Konsumenten damit um, was für eine Beziehung entwickelten Sie zu dem reicheren, bevorteilten westdeutschen Staat, wie war eine Meinungsbildung über die Grenze überhaupt möglich und geartet? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Ausgangspunkt: Idee und Wirklichkeit sozialistischer Konsumkultur
- 2. Fremdwahrnehmungen: Der Blick nach Westdeutschland
- 3. Reaktionen der Regierung
- 4. Reaktionen der Bevölkerung
- 5. Fremdwahrnehmungen: Der Blick nach Ostdeutschland
- 6. Konsumerfahrungen nach der Wende
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung und Auswirkungen des Bildes vom „goldenen Westen“ in der DDR. Im Fokus stehen dabei die Konsumgewohnheiten der DDR-Bevölkerung in den 1960er Jahren und die Bedeutung des Westens als Leitbild für die sozialistische Konsumkultur.
- Die Entwicklung der Vorstellung vom „goldenen Westen“ in der DDR
- Der Einfluss des Westens auf die Konsumkultur in der DDR
- Die Reaktionen der DDR-Regierung auf die Westorientierung der Bevölkerung
- Die Rolle des Kalten Krieges und des Mauerbaus im Kontext der Konsumkultur
- Die Auswirkungen des „goldenen Westens“ auf das Alltagsleben in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des „goldenen Westens“ als Leitbild für die sozialistische Konsumkultur in der DDR. Sie stellt den Zeitraum der 1960er Jahre als Schwerpunkt der Untersuchung dar und beleuchtet die Rolle des Kalten Krieges im Kontext der Konsumkultur.
- 1. Ausgangspunkt: Idee und Wirklichkeit sozialistischer Konsumkultur: Dieses Kapitel beleuchtet die sozialistische Ideologie der Konsumkultur und die Unterschiede zum kapitalistischen Westen. Es analysiert die Herausforderungen der Konsumgüterindustrie in der DDR und die Bemühungen der Regierung, die Bedürfnisse der Verbraucher zu lenken.
- 2. Fremdwahrnehmungen: Der Blick nach Westdeutschland: Dieses Kapitel befasst sich mit der Wahrnehmung des Westens in der DDR. Es untersucht, wie die DDR-Bevölkerung den westdeutschen Lebensstil, die Konsumgüter und die wirtschaftlichen Möglichkeiten wahrnahm.
- 3. Reaktionen der Regierung: Dieses Kapitel analysiert die Reaktionen der DDR-Regierung auf die Westorientierung der Bevölkerung. Es beleuchtet die Maßnahmen, die die Regierung ergriff, um die Konsumkultur zu kontrollieren und die Ideologie des Sozialismus zu stärken.
- 4. Reaktionen der Bevölkerung: Dieses Kapitel untersucht die Reaktionen der DDR-Bevölkerung auf die Politik der Regierung. Es analysiert die Anpassungsstrategien der Menschen im Umgang mit dem Mangel an Konsumgütern und die Entwicklung von alternativen Konsumformen.
- 5. Fremdwahrnehmungen: Der Blick nach Ostdeutschland: Dieses Kapitel befasst sich mit der Wahrnehmung der DDR aus westdeutscher Perspektive. Es untersucht, wie der westdeutsche Lebensstil und die Konsumkultur in der DDR wahrgenommen wurden.
- 6. Konsumerfahrungen nach der Wende: Dieses Kapitel analysiert die Konsumerfahrungen der DDR-Bevölkerung nach der Wende. Es untersucht die Auswirkungen der Vereinigung auf den Konsum und die Anpassung an den westdeutschen Lebensstil.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen sozialistische Konsumkultur, „goldener Westen“, Westorientierung, DDR-Alltag, Konsumgewohnheiten, Mangelgesellschaft, Kalter Krieg, Mauerbau, Konsumgüterindustrie, Politik der DDR, Lebensqualität, Bedürfnisse der Verbraucher, Westdeutsche Assimilierung, Konsumerfahrungen nach der Wende.
- Quote paper
- Anna-Maria Heinemann (Author), 2008, Der „goldene“ Westen als Leitbild sozialistischer Konsumkultur in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140864