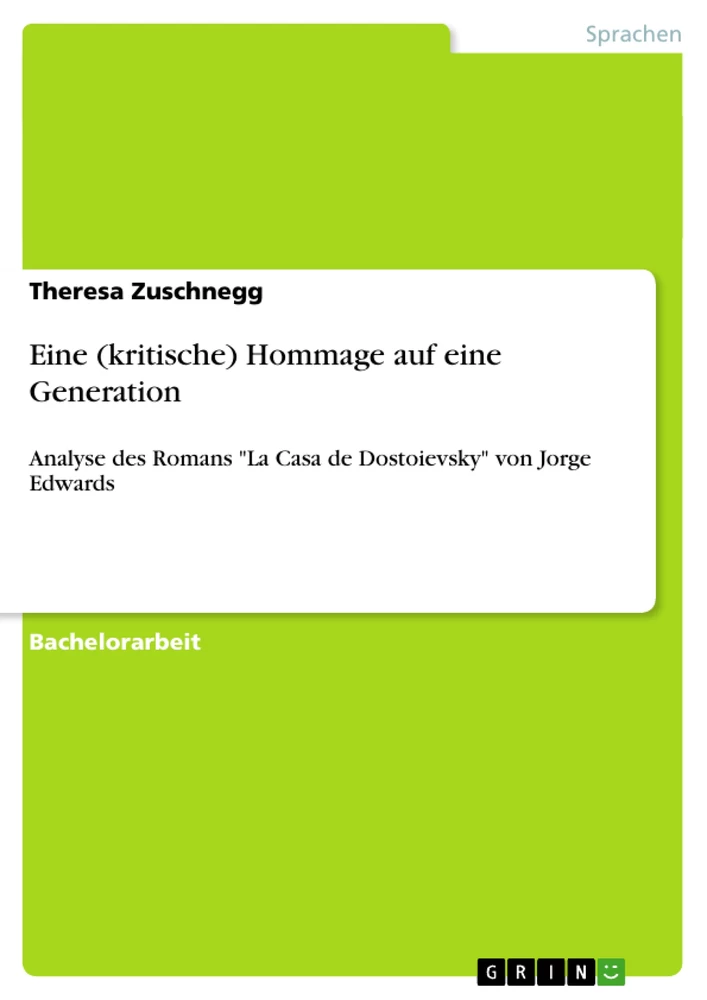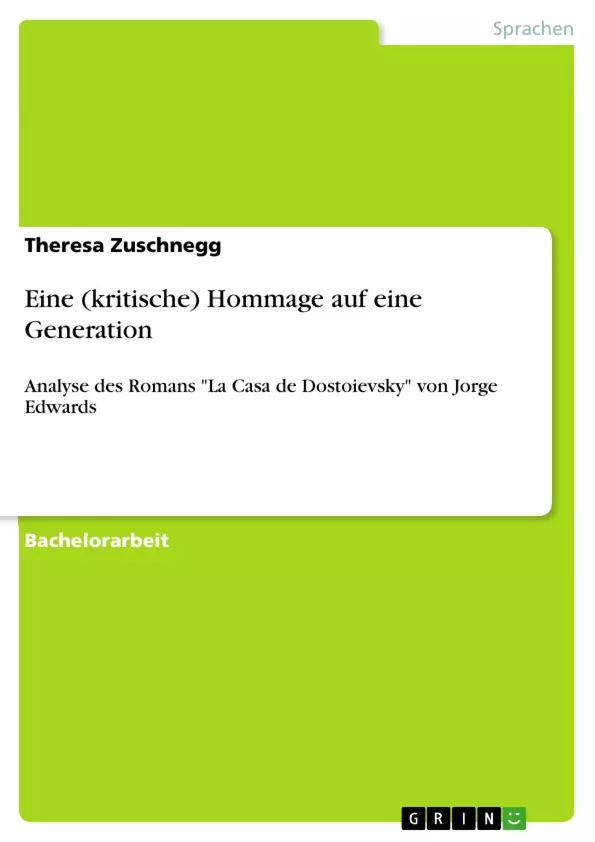„La poesía es capaz de todo“ (CdD 281), nach diesem Motto ist der Roman La casa de Dostoievsky (2008) von Jorge Edwards zu lesen. Es handelt sich um eine Liebeserklärung an einen Zeitgeist, an ein Lebensgefühl, die im gegenwärtigen Santiago de Chile in Vergessenheit geraten zu sein scheinen. Mit diesem Roman lässt Edwards die chilenischen Künstler der Nacht, des Weines und der Künstlerhäuser wieder auferstehen und setzt ihnen ein Denkmal. Dass dieses von Ironie überzogen ist, macht die Würdigung dieser Poeten nicht weniger glaubhaft.
Gegenstand dieser Arbeit soll nun sein das Augenzwinkern, mit dem der Autor an diese Epoche herangeht, herauszufiltern und dessen Gestaltungsmittel darzulegen. Dazu gehören die Analyse der Erzählstrategie Edwards, die sich als eine äußerst komplexe entpuppt, sowie der Versuch einer Einordnung in Genres. Weiters soll erörtert werden, inwiefern Edwards persönliche Erfahrungen und Freundschaft mit vielen Künstlern aus dieser Zeit für den Roman relevant sind und wie das Spiel zwischen Faktum und Fiktion funktioniert. So wird ein besonderes Augenmerk auf die Hybridität im Roman – in der Erzählperspektive, in der Gattungszuordnung, im Protagonisten etc. – gelegt.
Ferner wird die für Edwards typische Erzählweise der historia como conjetura einen großen Platz einnehmen. Mit welchen sprachlichen Mitteln das Mutmaßende erreicht wird und wie sich dies in den Figuren und in der Handlungschronologie widerspiegelt, soll thematisiert werden.
Außerdem wird kurz auf die Strömung des Existentialismus eingegangen, da diese für die Figuren im Roman als äußerst prägend hervorgeht. Gegen diese soll der Begriff des Habitus von Bourdieu gesetzt werden, um den Protagonisten in seinem unentwegten Freiheitsbestreben, das im Grunde eine Selbsteinschränkung ist, zu entlarven. So werden auch Analogien des Protagonisten mit seinem Idealbild des französischen Poeten – Jean-Arthur Rimbaud – hergestellt.
Ziel dieser Arbeit soll sein, die parodistischen Elemente im Roman zu erkennen und darzulegen sowie die Komplexität des Erzählens mittels erzähltheoretischer Ansätze zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jorge Edwards
- Generación del 50
- Der Namenlose als Repräsentant einer Generation
- Genre
- Autofiktion
- Autofiktion -,,El Poeta soy yo“-
- Biofiktion
- Enrique Lihn
- Heberto Padilla
- Bürgerlicher Roman und Untergruppen
- Nueva novela histórica
- Autofiktion
- Analyse der Erzählstrategie
- Erzählperspektive
- Metafiktionale Elemente und Illusionsbrüche
- Unzuverlässiges Erzählen und das Entstehen von Ironie
- ,,La historia como conjetura“ – Der fingierte Chronist und Zeitzeuge
- Die Redewiedergabe als Strategie der „,historia como conjetura“
- Die Darstellung von Raum und Zeit
- Themen und Motive
- La huída, la evasión und Jean-Arthur Rimbaud
- Die Rolle des Existentialismus im Roman
- Der Habitus des existentialistischen Künstlers als Mittel der Ironie
- Chico und Eduardito
- El Poeta
- La Casa de Dostoievsky
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Jorge Edwards’ Roman „La casa de Dostoievsky“ und untersucht, wie der Autor die Epoche der chilenischen Künstlergeneration der 1950er Jahre in einem ironischen Licht darstellt. Die Arbeit beleuchtet die komplexe Erzählstrategie des Romans und analysiert die Hybridität in Gattungszuordnung, Erzählperspektive und Protagonisten. Weiterhin wird der für Edwards charakteristische Erzählstil „historia como conjetura“ untersucht, der Mutmaßungen durch sprachliche Mittel vermittelt. Der Einfluss des Existentialismus auf die Figuren des Romans wird erörtert, wobei der Begriff des Habitus von Bourdieu zur Entlarvung des Protagonisten und seiner Selbstinszenierung genutzt wird. Die Arbeit zielt darauf ab, die parodistischen Elemente im Roman zu identifizieren und die Komplexität der Erzählung mit Hilfe erzähltheoretischer Ansätze zu erklären.
- Analyse der Erzählstrategie von Jorge Edwards
- Untersuchung der Hybridität in Gattungszuordnung, Erzählperspektive und Protagonisten
- Erörterung des Erzählstils „historia como conjetura“
- Einfluss des Existentialismus auf die Figuren des Romans
- Analyse der parodistischen Elemente im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Romans „La casa de Dostoievsky“ ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: die Untersuchung der Ironie und des Spiels zwischen Faktum und Fiktion im Roman. Kapitel 2 gibt eine kurze biografische Darstellung von Jorge Edwards, die für das Verstehen der Autofiktion im Roman als essenziell erachtet wird. Kapitel 3 beleuchtet die chilenische „Generación del 50“, zu der Edwards zählt, und beschreibt deren Lebensgefühl und künstlerischen Ansatz.
Kapitel 4 widmet sich der Analyse der Erzählstrategie des Romans, wobei die Erzählperspektive, metafiktionale Elemente, unzuverlässiges Erzählen und die „historia como conjetura“ im Fokus stehen. Kapitel 5 erörtert die Bedeutung des Existentialismus für die Figuren des Romans und stellt den Begriff des Habitus von Bourdieu als Gegenkonzept dar.
Kapitel 6 konzentriert sich auf die Rolle von Raum und Zeit in der Erzählung und untersucht die Darstellung des „Casa de Dostoievsky“ als Ort des künstlerischen Lebens und der Begegnung mit Jean-Arthur Rimbaud. Kapitel 7 schließlich analysiert verschiedene Themen und Motive des Romans, wie etwa die Flucht, die Rolle des Existentialismus und den Habitus des existentialistischen Künstlers.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Romans „La casa de Dostoievsky“ sind: Autofiktion, Biofiktion, „historia como conjetura“, Existentialismus, Habitus, Ironie, Parodismus, chilenische Künstlergeneration der 1950er Jahre, Santiago de Chile.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Roman 'La casa de Dostoievsky'?
Der Roman von Jorge Edwards ist eine Hommage an die chilenische Künstlergeneration der 1950er Jahre und thematisiert deren Lebensgefühl zwischen Poesie, Existentialismus und Bohème.
Was bedeutet 'historia como conjetura' bei Jorge Edwards?
Es beschreibt einen Erzählstil, bei dem Geschichte als Mutmaßung dargestellt wird. Der Erzähler tritt als fingierter Zeitzeuge auf, der Fakten mit Vermutungen und Fiktion mischt.
Welche Rolle spielt die Ironie in diesem Roman?
Jorge Edwards nutzt Ironie, um die Selbstinszenierung der Künstler und ihren unentwegten Freiheitsdrang, der oft in Selbsteinschränkung endet, parodistisch zu hinterfragen.
Ist der Roman eine Biografie oder Fiktion?
Der Roman ist eine Mischung (Hybridität) aus Autofiktion und Biofiktion, in der reale Persönlichkeiten wie Enrique Lihn oder Heberto Padilla als literarische Figuren auftreten.
Wie wird der Begriff 'Habitus' von Bourdieu in der Analyse genutzt?
Der Habitus dient dazu, das typische Verhalten und die soziale Erscheinung der existentialistischen Künstler zu entlarven und deren Handeln als Teil eines bestimmten sozialen Feldes zu erklären.
- Arbeit zitieren
- Theresa Zuschnegg (Autor:in), 2009, Eine (kritische) Hommage auf eine Generation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/140912