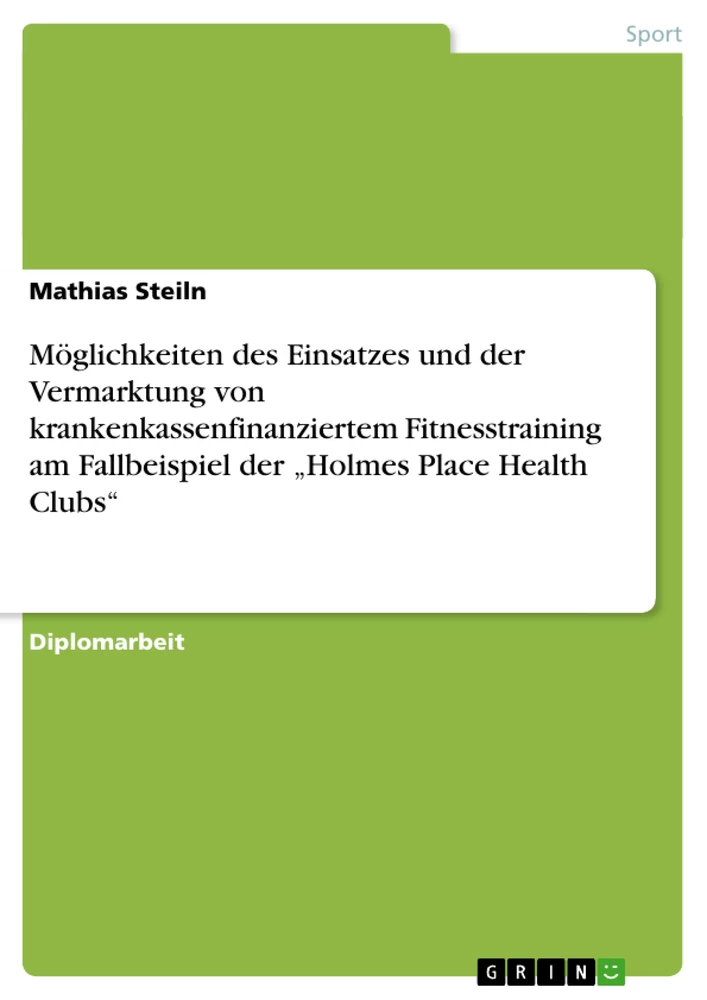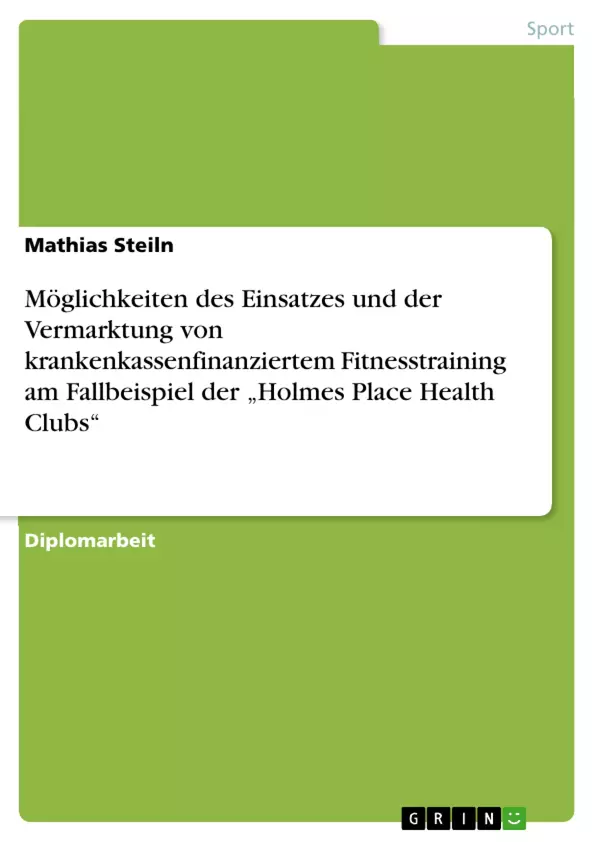Seit dem Jahr 2000 haben Krankenkassen nach § 20 Abs. 1 und 2 SGB V die Möglichkeit und die Pflicht, Präventivmaßnahmen wie Rückenfitnesskurse bei externen Anbietern, zum Beispiel Fitness Clubs, Vereinen oder sonstigen Institutionen zu subventionieren.
Fitness Ketten wie Holmes Place Health Clubs, Kieser Training, die Fitness Company oder INJOY Clubs bieten immer mehr Gesundheitskurse an, die von Krankenkassen bezuschusst werden.
Darin wird eine Möglichkeit gesehen, das Angebot zu erweitern. Hierbei ist ein Trend zu erkennen, der sich in den nächsten Jahren noch ausweiten könnte. Allerdings gibt es immer noch viele Kurse wie Rückenfitness, Walking oder Aquajogging, die nicht von den Krankenkassen gefördert werden.
Die oftmals undurchsichtige und aufwendige Einführung der Kurse stellt ein Problem für Fitness Clubs dar. Das könnte der Hauptgrund sein, auf ein solches Angebot zu verzichten. Viele Studios sind durch den hohen organisatorischen Aufwand nicht in der Lage, mit den Krankenkassen in Verbindung zu treten und
selbst solche Kurse anzubieten.
Während manche Fitness Clubs, beispielsweise das Just Fit in Köln, ein scheinbar gut ausgearbeitetes Konzept zur Umsetzung von Kooperationen mit Krankenkassen aufweisen, haben andere Clubs noch Potentiale bei der Konzeptionisierung. Das Kursangebot des Holmes Place Health Clubs in Köln bietet Tai Chi und Rückenfitnesskurse an, die von den Krankenkassen
gefördert werden. Diese Programme werden häufig von Physiotherapeuten durchgeführt, die mit diesem Konzept an das Studio herangetreten sind. Ein eigenes Konzept zur Umsetzung von Präventivmaßnahmen existiert nicht.
Auf Grund dieser Probleme gilt es, das Thema genauer zu untersuchen und klare Richtlinien für Fitness-Clubs herauszuarbeiten.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, Möglichkeiten des Einsatzes und der Vermarktung von krankenkassensubventionierten Fitnesskursen aufzudecken und am Beispiel Holmes Place Health Clubs darzustellen. Ferner soll erforscht werden, welche Formen der Kooperation zwischen Krankenkassen und Fitness-Clubs existieren. Die Relevanz ergibt sich daraus, dass vielen Fitness-Studios ein Konzept fehlt, um die Umsetzung krankenkassenfinanzierter
Präventionsmaßnahmen durchzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 Methodischer Ansatz
- 1.3 Struktur und Aufbau der Arbeit
- 2 Betrachtung des Themas aus Sicht der Krankenkassen
- 2.1 Die Struktur der gesetzlichen Krankenkasse
- 2.1.1 Abgrenzung zur privaten Krankenversicherung (PKV)
- 2.2 Aktuelle Probleme der gesetzlichen Krankenkassen
- 2.2.1 Exkurs: Demographische Entwicklung
- 2.2.2 Lösungsvorschläge zur Sanierung des Gesundheitssystems
- 2.3 Definition und Abgrenzung der relevanten Begriffe
- 2.3.1 Prävention
- 2.3.2 § 20 Abs. 1 und 2 SGB V vom 21. Juni 2000
- 2.4 Förderungsmaßnahmen von Krankenkassen
- 3 Betrachtung des Themas aus Sicht von Fitness-Clubs
- 3.1 Kooperationsmaßnahmen zwischen Fitness-Clubs und Krankenkassen
- 4 Untersuchungs- und Methodendesign
- 4.1 Untersuchungsinstrument
- 4.2 Untersuchungsinhalte
- 4.3 Auswahl der Interviewpartner
- 4.4 Untersuchungszeitraum
- 4.5 Datenbearbeitung und Auswertung
- 5 Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse
- 5.1 Erfahrungen mit dem Thema Präventionsmaßnahmen bzw. krankenkassensubventionierter Kurse
- 5.1.1 Ergebnisdiskussion
- 5.2 Aktuelles Angebot / Umsetzung von Präventivmaßnahmen insbesondere krankenkassensubventionierter Kurse
- 5.2.1 Ergebnisdiskussion
- 5.3 Chancen, Risiken und Probleme bei der Umsetzung krankenkassensubventionierter Kurse
- 5.3.1 Ergebnisdiskussion
- 5.4 Marketingbereich
- 5.4.1 Ergebnisdiskussion
- 5.5 Zukunft und Entwicklung
- 5.5.1 Ergebnisdiskussion
- 6 Marketingkonzept zur Umsetzung krankenkassenfinanzierter Maßnahmen bei Holmes Place Köln, Mediapark
- 6.1 Grundlagen der Marketingkonzeption
- 6.2 Die fünf Phasen der Marketing-Mangement-Methode
- 6.2.1 Analysephase
- 6.2.2 Prognosephase
- 6.2.3 Strategisches Marketing
- 6.2.4 Operatives Marketing
- 6.2.5 Realisation und Kontrolle
- 7 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
- 8 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten des Einsatzes und der Vermarktung von krankenkassenfinanziertem Fitnesstraining anhand des Fallbeispiels Holmes Place Health Clubs. Ziel ist es, die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fitness-Clubs und Krankenkassen zu analysieren und ein umsetzbares Marketingkonzept zu entwickeln.
- Kooperationsmodelle zwischen Fitnessstudios und Krankenkassen
- Marketingstrategien für krankenkassenfinanzierte Fitnessprogramme
- Analyse der aktuellen Situation im Gesundheitswesen und die Rolle der Prävention
- Wirtschaftliche Aspekte und Herausforderungen der Kooperation
- Entwicklung eines konkreten Marketingkonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, den methodischen Ansatz und den Aufbau der Arbeit. Sie führt in die Thematik der krankenkassenfinanzierten Fitnessangebote ein und begründet die Relevanz des gewählten Fallbeispiels, die Holmes Place Health Clubs.
2 Betrachtung des Themas aus Sicht der Krankenkassen: Dieses Kapitel beleuchtet die Strukturen der gesetzlichen Krankenkassen, deren aktuelle Probleme, insbesondere im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Es definiert zentrale Begriffe wie Prävention und erläutert die rechtlichen Grundlagen der Förderung von Präventionsmaßnahmen durch Krankenkassen gemäß § 20 SGB V. Die Ausführungen umfassen die Abgrenzung zur privaten Krankenversicherung und die Darstellung von Lösungsansätzen zur Sanierung des Gesundheitssystems unter Einbezug von Präventionsmaßnahmen.
3 Betrachtung des Themas aus Sicht von Fitness-Clubs: Das Kapitel analysiert die Perspektiven von Fitness-Clubs auf Kooperationen mit Krankenkassen. Es werden konkrete Kooperationsmodelle und deren Umsetzung in der Praxis betrachtet. Der Fokus liegt auf den Vorteilen und Herausforderungen, die sich aus solchen Partnerschaften für die Fitness-Clubs ergeben.
4 Untersuchungs- und Methodendesign: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Arbeit. Es erläutert das gewählte Untersuchungsinstrument, die Auswahl der Interviewpartner, die Untersuchungsinhalte, den Untersuchungszeitraum und die Vorgehensweise bei der Datenbearbeitung und -auswertung. Die methodische Vorgehensweise wird transparent dargestellt und begründet.
5 Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung. Es werden die Erfahrungen mit Präventionsmaßnahmen und krankenkassensubventionierten Kursen, das aktuelle Angebot an solchen Kursen, sowie die Chancen, Risiken und Probleme bei deren Umsetzung analysiert und diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Marketingbereich und der zukünftigen Entwicklung.
6 Marketingkonzept zur Umsetzung krankenkassenfinanzierter Maßnahmen bei Holmes Place Köln, Mediapark: Dieses Kapitel entwickelt ein konkretes Marketingkonzept für die Umsetzung krankenkassenfinanzierter Maßnahmen bei Holmes Place. Es basiert auf den Ergebnissen der vorherigen Kapitel und beinhaltet die Grundlagen der Marketingkonzeption sowie die fünf Phasen der Marketing-Management-Methode (Analysephase, Prognosephase, strategisches Marketing, operatives Marketing, Realisation und Kontrolle).
Schlüsselwörter
Gesetzliche Krankenkassen, Prävention, Fitnesstraining, Gesundheitsförderung, Kooperation, Marketing, Holmes Place, Marketingkonzept, § 20 SGB V, demografischer Wandel, Gesundheitswesen, Kostenmanagement.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fitness-Clubs und Krankenkassen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten des Einsatzes und der Vermarktung von krankenkassenfinanziertem Fitnesstraining am Beispiel des Holmes Place Health Clubs. Ziel ist die Analyse von Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fitness-Clubs und Krankenkassen und die Entwicklung eines umsetzbaren Marketingkonzepts.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte, darunter Kooperationsmodelle zwischen Fitnessstudios und Krankenkassen, Marketingstrategien für krankenkassenfinanzierte Fitnessprogramme, die aktuelle Situation im Gesundheitswesen und die Rolle der Prävention, wirtschaftliche Aspekte und Herausforderungen der Kooperation sowie die Entwicklung eines konkreten Marketingkonzepts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung mit Zielsetzung und methodischem Ansatz, Betrachtung des Themas aus Sicht der Krankenkassen (inkl. Struktur, aktueller Probleme, demografischer Entwicklung und rechtlicher Grundlagen), Betrachtung aus Sicht von Fitness-Clubs, Untersuchungs- und Methodendesign, Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse, ein Marketingkonzept für Holmes Place Köln, Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der Untersuchung, einschließlich des Untersuchungsinstruments, der Auswahl der Interviewpartner, der Untersuchungsinhalte, des Untersuchungszeitraums und der Datenbearbeitung und -auswertung. Die methodische Vorgehensweise wird transparent dargestellt und begründet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Kapitel "Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es analysiert Erfahrungen mit Präventionsmaßnahmen und krankenkassensubventionierten Kursen, das aktuelle Angebot, Chancen, Risiken und Probleme bei der Umsetzung und den Marketingbereich. Die Ergebnisse fließen in das entwickelte Marketingkonzept ein.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Die Arbeit liefert ein konkretes Marketingkonzept für die Umsetzung krankenkassenfinanzierter Maßnahmen bei Holmes Place Köln, Mediapark. Dieses basiert auf den Ergebnissen der Untersuchung und beinhaltet die fünf Phasen der Marketing-Management-Methode (Analyse, Prognose, strategisches Marketing, operatives Marketing, Realisation und Kontrolle).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesetzliche Krankenkassen, Prävention, Fitnesstraining, Gesundheitsförderung, Kooperation, Marketing, Holmes Place, Marketingkonzept, § 20 SGB V, demografischer Wandel, Gesundheitswesen, Kostenmanagement.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fitness-Clubs und Krankenkassen, dem Marketing von Gesundheitsleistungen und der Präventionsarbeit im Gesundheitswesen beschäftigen. Insbesondere für Krankenkassen, Fitnessstudios und Marketingfachleute im Gesundheitsbereich bietet die Arbeit wertvolle Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen.
- Arbeit zitieren
- Dipl. - Sportwissenschaftler Mathias Steiln (Autor:in), 2006, Möglichkeiten des Einsatzes und der Vermarktung von krankenkassenfinanziertem Fitnesstraining am Fallbeispiel der „Holmes Place Health Clubs“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141027