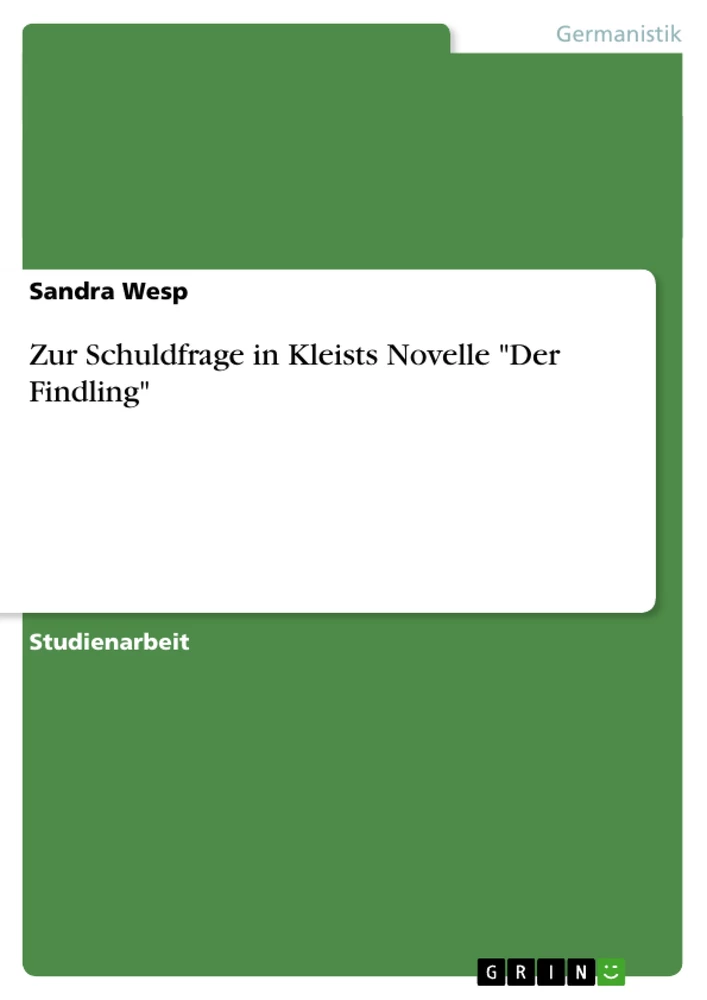Wenn man die Novelle „Der Findling“ von Heinrich von Kleist zum ersten Mal liest, erschrickt man über die Bösartigkeit des jungen Nicolo. Anstatt sich seinen Ziehfamilie und ganz besonders seinem Stiefvater gegenüber liebevoll zu zeigen, verursacht der „Findling“ einen Tod nach dem anderen, bis schließlich fast die gesamte Familie Piachi ausgestorben ist - bis auf den alten Piachi. Es scheint nachvollziehbar, daß der Mann, der dem jungen Nicolo einst das Leben rettete und dabei sein eigen Fleisch und Blut opferte, nun zum Sohnesmörder wird und sich obendrein verbittert der Kirche verweigert. Das ist zumindest die Meinung, die der Erzähler vertritt, der eine bürgerlich-sittliche Perspektive vertritt.
Bei genauerer Betrachtung zeigt sich dem kritischen Leser jedoch bald, daß eine derartige Beurteilung nicht ganz angemessen ist. Zu sehr gerät die gesamte Novelle zunehmend in ein moralisches Zwielicht und damit auch sämtliche Figuren und Aussagen, einschließlich der auktorialen Wertung.
Ist Nicolo wirklich so bösartig? Und wie verhält es sich mit Piachi?
Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschte in der Literaturforschung die Meinung, daß es sich bei diesem (1811 verfasstem) Stück um ein noch nicht ausgereiftes Erstlingswerk handelt. Begründet wurde dies vor allem mit der uneinheitlichen Erzählperspektive, dem ungeschickten Übertreibungsstil oder auch der nur fragmentarischen Psychologisierung. Zudem wurde die Sicht des Erzählers recht unkritisch übernommen, so daß die Handlung der Novelle oft als Bewährungsprobe der guten Charaktere vor der Verkörperung des absolut Bösen interpretiert wurde. Nicht berücksichtigt wurde dabei, daß die Erzählperspektive mit der Perspektive des Autors nicht identisch sein muß.
Erst in den siebziger Jahren wurde die eigentliche Struktur des „Findling“ wahrgenommen, nicht zuletzt aufgrund der Erkenntnis über die „Uneigentlichkeit des Kleistschen Erzählers“ sowie über die wahre Entstehungszeit der Novelle (nämlich im Todesjahr Kleists).
Wenn Nicolo böse ist, wie böse ist dann Piachi? Schließlich wird auch er zum Mörder, zum Mörder eines „Findlings“, welcher nicht als Ersatz fungierte, wie Piachi es erwartet hatte...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Person Kleist
- Biographisches
- Zum Selbst- und Weltbild Kleists: ein Ausschnitt
- Die gestörte Familie im „Findling“
- Gestörte Kommunikation
- Ersatzwesen
- Der Umgang der Protagonisten mit Sexualität
- Kleists Methodik
- Schlüsselsymbolik
- Logographie
- ,,Experimentalphysik" des Erzählens
- Eine Dreiecksgeschichte
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Schuldfrage in Kleists Novelle „Der Findling“. Im Fokus steht dabei die Frage, ob Nicolo tatsächlich so böse ist, wie er im ersten Moment erscheint, und wie sich die Schuldfrage auf Piachi und den Kirchenstaat bezieht. Die Arbeit geht davon aus, dass Kleists „Findling“ nicht primär die Schuldfrage im Vordergrund stellt, sondern eher ein Spiegelbild des Autors eigenen Lebenserfahrungen ist.
- Die Rolle der Schuldfrage in Kleists Novelle „Der Findling“
- Die Interpretation der Figur Nicolo und seine Rolle im Kontext der Novelle
- Die Darstellung der Familie Piachi und ihre Beziehungen
- Kleists Schreibstil und seine narrative Methodik
- Die Verknüpfung von Rettung und Untergang in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Novelle „Der Findling“ vor und zeigt auf, wie die Figur Nicolo zunächst als böse wahrgenommen wird. Sie analysiert die Schuldfrage und führt die unterschiedlichen Interpretationen der Novelle in der Forschung ein.
- Zur Person Kleists: Dieses Kapitel beleuchtet die Biographie von Heinrich von Kleist und seine Kindheit geprägt von Verlusterfahrungen und Existenzängsten. Es zeigt die Einflüsse der Zeit und die Bedeutung von Goethe, Schiller und Rousseau für Kleists Schaffen.
- Die gestörte Familie im „Findling“: Dieses Kapitel analysiert die gestörten Kommunikationsstrukturen innerhalb der Familie Piachi, die Rolle des Ersatzwesens und den Umgang mit Sexualität.
- Kleists Methodik: Dieses Kapitel befasst sich mit Kleists narrative Methodik, wie z.B. Schlüsselsymbolik, Logographie und der „Experimentalphysik“ des Erzählens.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Novelle, „Der Findling“, Schuldfrage, Familie, Ersatzwesen, Kommunikation, Sexualität, Schreibstil, narrative Methodik, Schlüsselsymbolik, Logographie, „Experimentalphysik“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kleists Novelle „Der Findling“?
Die Novelle thematisiert die Zerstörung der Familie Piachi durch den Findling Nicolo und wirft tiefgreifende Fragen nach Schuld und Moral auf.
Ist Nicolo in der Novelle absolut böse?
Während er oft so interpretiert wird, untersucht die Arbeit, ob diese Sichtweise angesichts der gestörten Familienverhältnisse und Piachis eigenem Verhalten angemessen ist.
Welche Rolle spielt Piachi bei der Eskalation?
Piachi wird selbst zum Mörder und verweigert sich am Ende verbittert der Kirche, was ihn ebenfalls in ein moralisches Zwielicht rückt.
Was versteht man unter der „Uneigentlichkeit des Kleistschen Erzählers“?
Es bedeutet, dass die bürgerlich-sittliche Perspektive des Erzählers nicht unbedingt mit der Wertung des Autors Kleist identisch sein muss.
Welche Symbole nutzt Kleist in der Novelle?
Die Arbeit analysiert Schlüsselsymbolik und die sogenannte „Experimentalphysik“ des Erzählens als Teil von Kleists Methodik.
- Arbeit zitieren
- Sandra Wesp (Autor:in), 2001, Zur Schuldfrage in Kleists Novelle "Der Findling", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14120