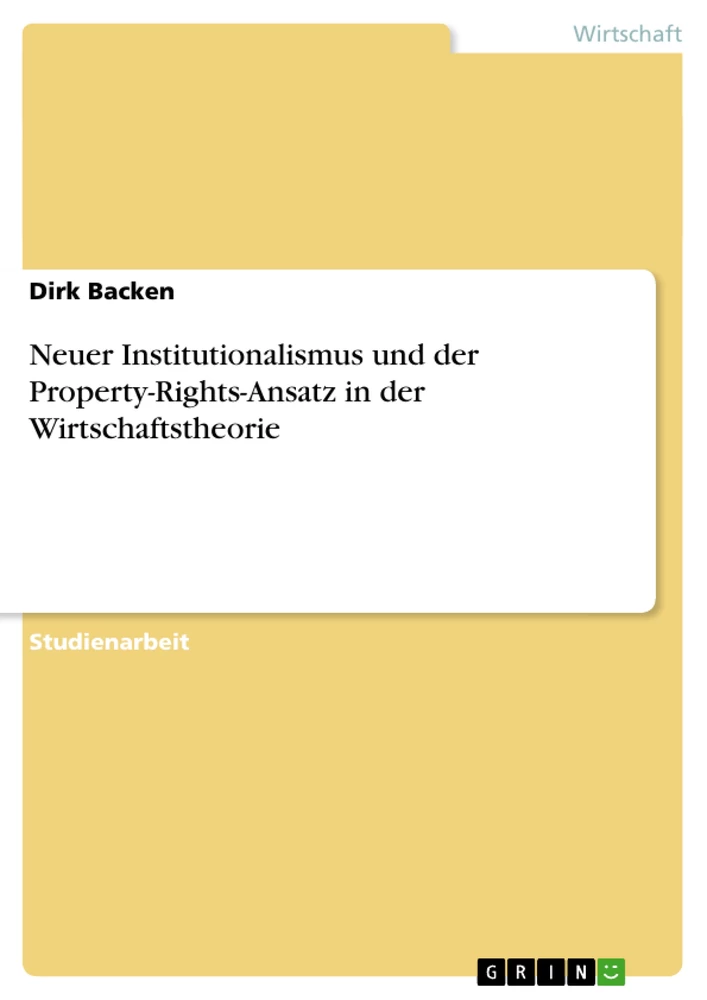Diese Arbeit hat zur Aufgabe, das Thema Property Rights zu umreißen und die Beziehung der Wirtschaftswissenschaft mit diesem zu den Rechtswissenschaften tendierenden Thema herzustellen.
Hauptgegenstand meiner hier vorliegenden Arbeit ist der Property-Rights-Ansatz.
Jeder von uns hat täglich und ständig etwas mit diesen so genannten „Property Rights“ zu tun, denn gerade in einer Marktwirtschaft, wie die unsere, spielen die Rechte an einem materiellen oder immateriellen Gut eine sehr große Rolle.
Kauft man sich auf dem Weg zur Uni eine Zeitung, hat man soeben das Recht der Nutzung erworben, aber ein Recht zur Vervielfältigung für gewerbliche Zwecke hat man nicht bekommen.
Somit ist es wichtig zu wissen, welche Rechte man an einem Gut besitzt und welche nicht, wenn man eine Weiterverwertung beabsichtigt.
Mit dem Begriff an sich, den Grundannahmen, der Verteilung, den verschiedenen Ausgestaltungen von Property Rights und dessen Missbrauch, beschäftige ich mich im 3. Kapitel dieses Proseminars.
Diese Rechte müssen allerdings erst einmal auf die Wirtschaftsubjekte einer Volkswirtschaft verteilt werden, nicht immer ist es so einfach wie bei einem Zeitungskauf. Man stelle sich einmal die Produktion von einem Musikstück vor, an dem mehrere Menschen und eventuell auch Firmen beteiligt sind.
So muss im Vorfeld bereits geklärt werden, wer welchen Anteil vom Gewinn – fest oder variabel erhält, wer das Recht an der Vermarktung hat und wie lang das gelten soll.
Dies wird alles durch Verträge festgelegt und von so genannten Institutionen überwacht.
Mitte der sechziger Jahre entwickelte Ronald H. Coase die neoklassische Theorie zum „Neuen Institutionalismus“ weiter. Coase stellt die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen ökonomischen Handelns und den gesetzten Rechtsnormen, sowie den institutionellen Vorraussetzungen dar.
Auf den „Neuen Institutionalismus“ werde ich im Folgenden Kapitel kurz eingehen, um die Einordnung der Property Rights Theorie als Teilgebiet des „Neuen Institutionalismus“ zu ermöglichen.
Im dritten Kapitel möchte ich die Anwendung der Property-Rights-Theorie kurz berühren. Eine ausführlichere Darstellung dieses Gebietes würde den Rahmen dieser Arbeit deutlich sprengen. Die Property-Rights-Theorie spielt nicht nur bei öffentlichen Gütern und externen Effekten eine große Rolle, sondern auch in der Unternehmenstheorie.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. NEUER INSTITUTIONALISMUS
- 2.1 ZUM INSTITUTIONSBEGRIFF IN DER ÖKONOMIE.
- 2.2 ENTSTEHUNG VON INSTITUTIONEN.....
- 2.3 ENTSTEHUNG DES NEUEN INSTITUTIONALISMUS
- 2.4 FORSCHUNGSZWEIGE DES NEUEN INSTITUTIONALISMUS.
- 3. DIE PROPERTY-RIGHTS-THEORIE...........
- 3.1 PROPERTY RIGHTS
- 3.2 ANNAHMEN DER PROPERTY-RIGHTS-THEORIE.
- 3.2.1 Individuelle Nutzenfunktion
- 3.2.2 Begrenzte Rationalität.
- 3.2.3 Opportunismus.
- 3.2.4 Schutz von Verfügungsrechten.
- 3.2.5 Existenz von Transaktionskosten.
- 3.3 MERKMALE VON VERFÜGUNGSRECHTEN
- 3.3.1 Arten der Nutzungsmöglichkeit....
- 3.3.2 Verteilung und weitere Ausgestaltung von Property Rights.
- 3.3.3 Exklusive Verfügungsrechte...
- 3.3.4 Verfügungsrechte und Haftung.
- 3.3.5 Verfügungsmacht....
- 3.4 TRANSAKTIONSKOSTEN UND TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE.
- 3.4.1 Wichtige Zusammenhänge in Verbindung mit Transaktionskosten..\n
- 4. ANWENDUNGSBEREICHE DER PROPERTY-RIGHTS-THEORIE .......
- 4.1 PROPERTY RIGHTS UND ÖFFENTLICHE GÜTER..........\n
- 5. SCHLUSSBETRACHTUNG............
- Die Entstehung und Bedeutung von Property Rights.
- Die Grundannahmen und Merkmale der Property-Rights-Theorie.
- Die Rolle von Institutionen und Transaktionskosten in Bezug auf Property Rights.
- Anwendungsbeispiele der Property-Rights-Theorie, insbesondere im Bereich öffentlicher Güter.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Property Rights und dessen Beziehung zu den Rechtswissenschaften, insbesondere im Kontext der Wirtschaftstheorie. Sie stellt den Property-Rights-Ansatz vor und untersucht die Rolle von Verfügungsrechten in einer Marktwirtschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Thematik der Arbeit vor und führt den Leser in die Welt der Property Rights ein. Es illustriert die Relevanz des Themas anhand von alltäglichen Beispielen. Das zweite Kapitel widmet sich dem Neuen Institutionalismus, der die theoretische Grundlage für die Property-Rights-Theorie bildet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich ausführlich mit dem Property-Rights-Ansatz selbst. Es erläutert die Grundannahmen der Theorie und geht detailliert auf die verschiedenen Merkmale von Verfügungsrechten ein. Des Weiteren werden die Themen Transaktionskosten und die Bedeutung von Institutionen in Bezug auf Property Rights behandelt. Das vierte Kapitel beleuchtet einige Anwendungsbereiche der Property-Rights-Theorie, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Analyse von öffentlichen Gütern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Property Rights, Neuer Institutionalismus, Transaktionskosten, Institutionen, Verfügungsrechte, öffentliche Güter und die Neoklassik. Darüber hinaus spielen auch Konzepte wie Opportunismus, begrenzte Rationalität und individuelle Nutzenfunktionen eine wichtige Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Property Rights“?
Property Rights sind Verfügungsrechte an materiellen oder immateriellen Gütern, die festlegen, wie ein Gut genutzt, verändert oder übertragen werden darf.
Welche Rolle spielen Institutionen in der Property-Rights-Theorie?
Institutionen setzen den rechtlichen Rahmen, definieren Verträge und überwachen die Einhaltung der Verteilung von Rechten zwischen Wirtschaftssubjekten.
Was sind Transaktionskosten?
Transaktionskosten sind Kosten, die durch die Übertragung von Verfügungsrechten entstehen, wie z. B. Informations-, Verhandlungs- und Überwachungskosten.
Was sind die Grundannahmen der Property-Rights-Theorie?
Dazu gehören die individuelle Nutzenmaximierung, begrenzte Rationalität der Akteure, das Potenzial für Opportunismus und die Existenz von Transaktionskosten.
Warum sind exklusive Verfügungsrechte in einer Marktwirtschaft wichtig?
Exklusive Rechte stellen sicher, dass der Inhaber den Nutzen aus einem Gut ziehen kann, was Anreize für Investitionen schafft und Fehlallokationen (z. B. bei öffentlichen Gütern) vermeidet.
- Quote paper
- Dirk Backen (Author), 2003, Neuer Institutionalismus und der Property-Rights-Ansatz in der Wirtschaftstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14133