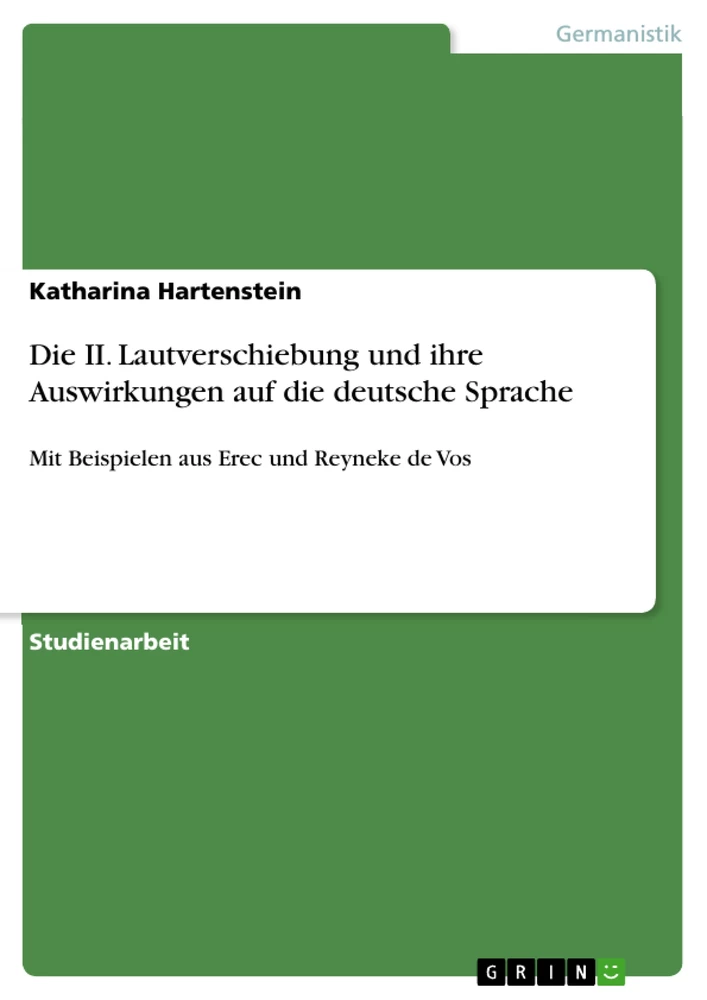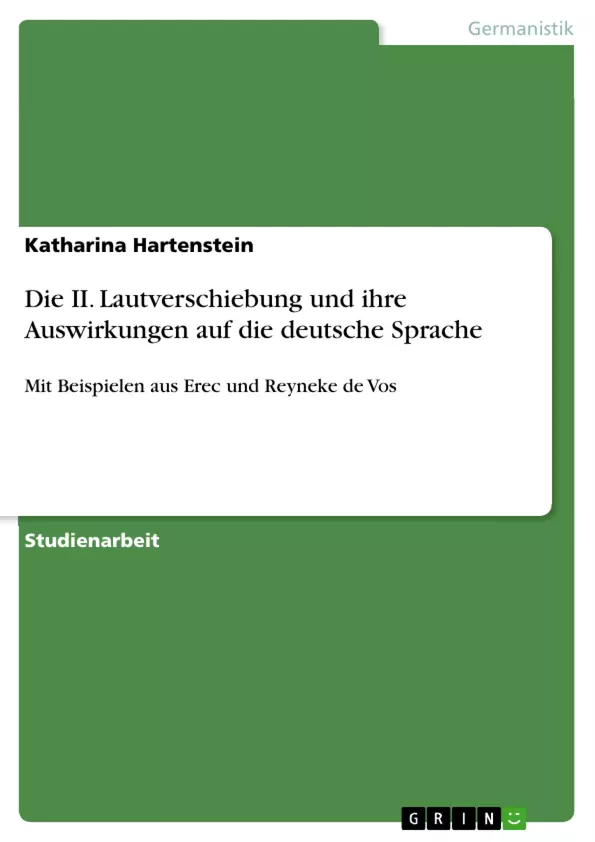Die deutsche Sprache, wie sie heute gesprochen wird, ist das Produkt einer Jahrhunderte andauernden Entwicklung. Sie hat sich in der Völkerwanderungszeit als Teil der germanischen Sprachgruppe entwickelt.
Die Sprachgeschichte unterscheidet zwischen Althochdeutsch (ca. 750-1050), Mittelhochdeutsch (1050-1350), Frühmittelhochdeutsch (1050-1170), ‚klassisches Mittelhochdeutsch’ (1250-1350), Frühneuhochdeutsch (1350-1650) und Neuhochdeutsch (seit 1650).
Diese Arbeit befasst sich mit der II. Lautverschiebung, deren lautliche Veränderungen in der deutschen Sprache das Hochdeutsche vom Niederdeutschen unterscheidet. Dabei geht es nicht nur um eine faktische Darstellung der II. Lautverschiebung sondern auch um eine Analyse der lautlichen Veränderung der deutschen Sprache anhand anschaulicher Textbeispiele aus dem Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen.
Bezüglich der II. Lautverschiebung gibt eine große Anzahl unterschiedlicher Ansätze und Meinungen. Dies betrifft vor allem die Gründe für die Lautverschiebung und die genau Datierung. Aus diesem Grund habe ich versucht, einen Querschnitt aus diesen verschiedenen Ansätzen, Meinungen und Theorien wiederzugeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die II. Lautverschiebung – Eine Einführung
- Begriffsdefinition
- Zeitliche Einordnung
- Theorien der II. Lautverschiebung
- Die Psychologischen Erklärungen
- Die Physiologischen Erklärungen
- Die ethnologischen Erklärungen
- Anwendungsbeispiel
- Das Gesetz der Lautverschiebung
- Veränderung durch die II. Lautverschiebung: Direkter Vergleich Althochdeutsch und Altniederdeutsch
- Hartmann von Aue: Erec (Ausschnitt), um 1180/90
- Reynke de Vos (Ausschnitt), um 1498
- Der Vergleich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zweite Lautverschiebung im Deutschen, ihre lautlichen Veränderungen und ihren Einfluss auf die Entwicklung des Hochdeutschen im Vergleich zum Niederdeutschen. Ziel ist es, die II. Lautverschiebung nicht nur deskriptiv darzustellen, sondern auch anhand von Textbeispielen aus dem Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen zu analysieren.
- Definition und zeitliche Einordnung der II. Lautverschiebung
- Vorstellung verschiedener Theorien zur Entstehung und Verbreitung der II. Lautverschiebung
- Analyse der lautlichen Veränderungen durch die II. Lautverschiebung
- Vergleich von althochdeutschen und altniederdeutschen Textbeispielen
- Zusammenfassende Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik der Zweiten Lautverschiebung ein und beschreibt die historische Entwicklung der deutschen Sprache. Sie betont die Bedeutung der Lautverschiebung als Unterscheidungsmerkmal zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch und kündigt die methodische Vorgehensweise an: eine Einführung in den Begriff, die Darstellung verschiedener Theorien und schließlich eine Analyse anhand von Textbeispielen aus dem Mittelhochdeutschen und Mittelniederdeutschen. Die Arbeit räumt ein, dass es bezüglich der II. Lautverschiebung unterschiedliche Ansätze und Meinungen gibt, und verspricht einen informativen Einblick in die Veränderungen, die die deutsche Sprache durch die II. Lautverschiebung erfahren hat.
Die II. Lautverschiebung – Eine Einführung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Lautverschiebung im Allgemeinen und der II. Lautverschiebung (Hochdeutsche Lautverschiebung) im Speziellen. Es wird erklärt, dass die II. Lautverschiebung die hochdeutschen Mundarten von anderen germanischen Dialekten unterscheidet, indem sie die germanischen Tenues (p, t, k) in verschiedene Laute verschiebt. Das Kapitel beleuchtet unterschiedliche Sichtweisen auf die II. Lautverschiebung und deren Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Sprache, unter Einbezug von Ansichten namhafter Linguisten wie Adolf Bach und Jakob Grimm. Die zeitliche Einordnung der II. Lautverschiebung wird als schwierig dargestellt und verschiedene Theorien zu ihrer Datierung werden vorgestellt, von der Datierung ins 1. Jahrhundert v. Chr. bis ins 8. Jahrhundert n. Chr.
Theorien der II. Lautverschiebung: Der Abschnitt präsentiert verschiedene Theorien zur Erklärung der II. Lautverschiebung. Er unterscheidet zwischen psychologischen, physiologischen und ethnologischen Erklärungsansätzen. Jeder Ansatz wird kurz skizziert, wobei die Komplexität und Vielfalt der Erklärungsversuche hervorgehoben wird. Der Abschnitt betont die Herausforderungen, die die Klärung der Ursachen für die II. Lautverschiebung für die Sprachwissenschaft darstellt.
Anwendungsbeispiel: Das Kapitel konzentriert sich auf die konkreten Veränderungen, die durch die II. Lautverschiebung hervorgerufen wurden. Es beinhaltet eine detaillierte Darstellung der einzelnen lautlichen Veränderungen und bietet einen direkten Vergleich zwischen althochdeutschen und altniederdeutschen Textbeispielen aus "Erec" von Hartmann von Aue und "Reynke de Vos". Dieser Vergleich soll die Auswirkungen der II. Lautverschiebung auf die Entwicklung der deutschen Sprache veranschaulichen. Die Analyse der Textbeispiele soll die theoretischen Ausführungen des vorherigen Kapitels veranschaulichen und durch praktische Beispiele untermauern.
Schlüsselwörter
Zweite Lautverschiebung, Hochdeutsche Lautverschiebung, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch, Lautwandel, Konsonantenverschiebung, Sprachgeschichte, Hartmann von Aue, Erec, Reynke de Vos, Sprachvergleich, Germanistik.
Häufig gestellte Fragen zu: Zweite Lautverschiebung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Zweite Lautverschiebung im Deutschen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen, und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der lautlichen Veränderungen, ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung des Hochdeutschen im Vergleich zum Niederdeutschen, und der Darstellung verschiedener Theorien zur Erklärung dieses linguistischen Phänomens. Anhand von Textbeispielen aus dem Mittelhochdeutschen (Hartmann von Aue: Erec) und Mittelniederdeutschen (Reynke de Vos) wird die Lautverschiebung veranschaulicht.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Zweite Lautverschiebung deskriptiv darzustellen und anhand von Textbeispielen zu analysieren. Die Themenschwerpunkte umfassen die Definition und zeitliche Einordnung der Lautverschiebung, die Vorstellung verschiedener Theorien zu ihrer Entstehung, die Analyse der lautlichen Veränderungen, einen Vergleich althochdeutscher und altniederdeutscher Texte und eine zusammenfassende Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse.
Welche Theorien zur Zweiten Lautverschiebung werden behandelt?
Das Dokument präsentiert verschiedene Theorien, die die Zweite Lautverschiebung zu erklären versuchen. Es unterscheidet dabei zwischen psychologischen, physiologischen und ethnologischen Erklärungsansätzen. Die Komplexität und Vielfalt der Erklärungsversuche wird hervorgehoben, und es wird betont, dass die Klärung der Ursachen für die Lautverschiebung eine Herausforderung für die Sprachwissenschaft darstellt.
Welche Textbeispiele werden verwendet und wie werden sie verglichen?
Das Dokument verwendet Textauszüge aus "Erec" von Hartmann von Aue (Mittelhochdeutsch) und "Reynke de Vos" (Mittelniederdeutsch). Der Vergleich dieser Texte soll die Auswirkungen der Zweiten Lautverschiebung auf die Entwicklung des Hochdeutschen im Vergleich zum Niederdeutschen veranschaulichen und die theoretischen Ausführungen des Dokuments praktisch untermauern.
Wie wird die Zweite Lautverschiebung definiert und zeitlich eingeordnet?
Die Zweite Lautverschiebung (auch Hochdeutsche Lautverschiebung) wird als ein lautlicher Wandel definiert, der die hochdeutschen Mundarten von anderen germanischen Dialekten unterscheidet, indem er die germanischen Tenues (p, t, k) in verschiedene Laute verschiebt. Die zeitliche Einordnung wird als schwierig dargestellt, und es werden verschiedene Theorien von der Datierung ins 1. Jahrhundert v. Chr. bis ins 8. Jahrhundert n. Chr. vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis der Zweiten Lautverschiebung?
Die Schlüsselwörter umfassen: Zweite Lautverschiebung, Hochdeutsche Lautverschiebung, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch, Lautwandel, Konsonantenverschiebung, Sprachgeschichte, Hartmann von Aue, Erec, Reynke de Vos, Sprachvergleich, Germanistik.
Gibt es unterschiedliche Ansichten zur Zweiten Lautverschiebung?
Ja, das Dokument räumt ein, dass es bezüglich der Zweiten Lautverschiebung unterschiedliche Ansätze und Meinungen gibt. Es präsentiert verschiedene Theorien und unterschiedliche Datierungsversuche, um die Komplexität des Themas zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Katharina Hartenstein (Author), 2005, Die II. Lautverschiebung und ihre Auswirkungen auf die deutsche Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141406