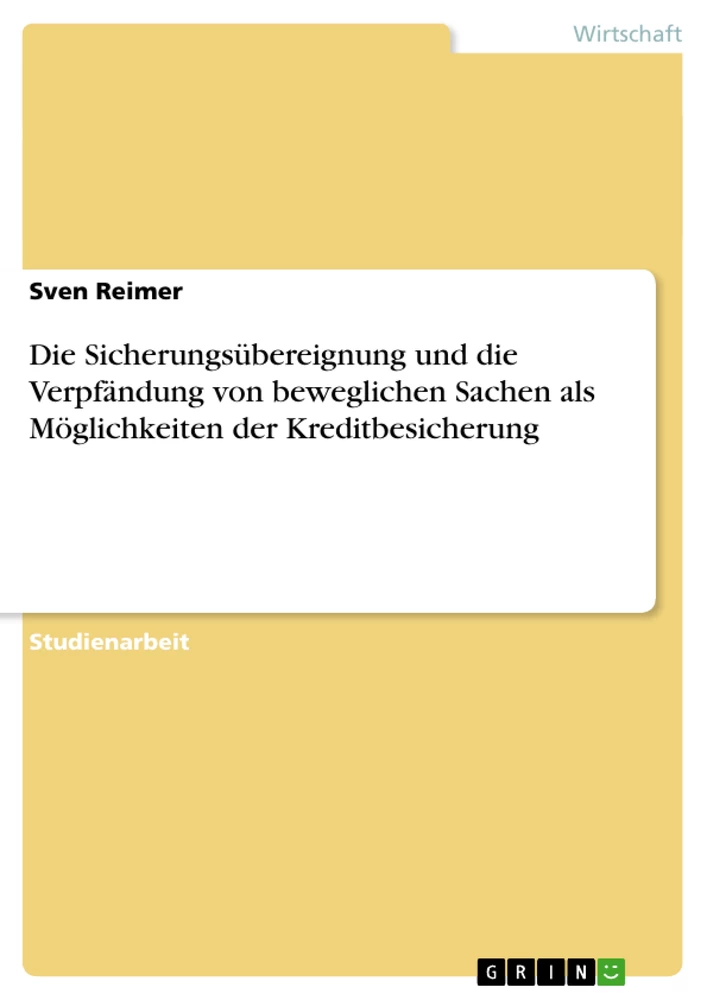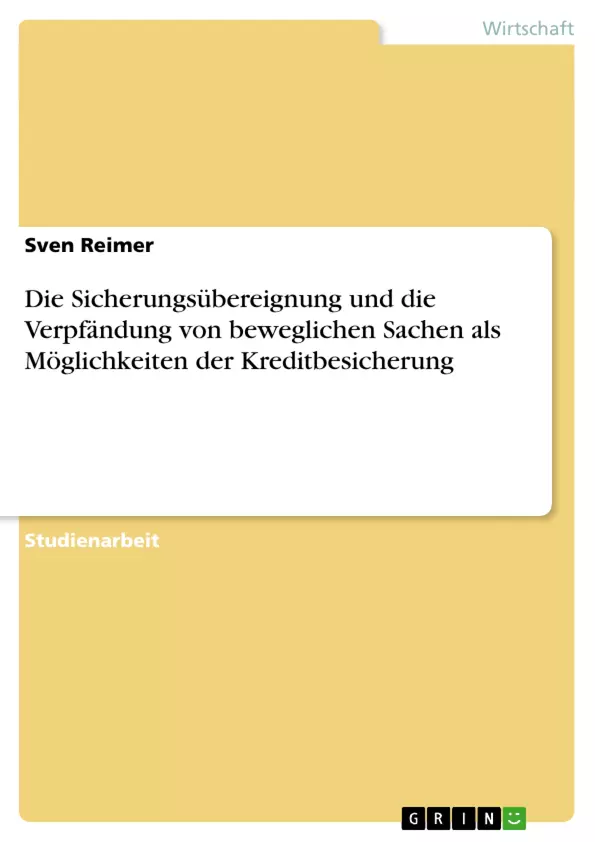Jeden Tag entsteht zwischen den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern in
Deutschland in einer speziellen Art und Weise Kreditbedarf. Die
Wirtschaftsteilnehmer werden gemeinhin in drei Kategorien unterteilt. Dies
sind die privaten Haushalte, die Unternehmen, sowie die öffentlichen
Haushalte1. Die einzelnen Mitglieder dieser Gruppen stehen in
wechselseitigen Beziehungen zueinander und ermöglichen somit das
System der Arbeitsteilung und generell das des Wirtschaftens.
Sollten jedoch bei einem Teilnehmer die zur Verfügung stehenden
Eigenmittel nicht ausreichen, um eine geplante Investition jeglicher Art zu
tätigen, so besteht durch das Mitwirken der Kreditinstitute am
Wirtschaftskreislauf die Möglichkeit, einen Kredit aufzunehmen. Dabei
verzichtet das Kreditinstitut, der Kreditgeber, für einen bestimmten
Zeitraum auf die Nutzung des Geldes, des Kreditbetrages. Es erhält dafür
als Gegenleistung Zinsen, die somit das Entgelt für die Bereitstellung des
Kapitals darstellen.
Da ein Kreditinstitut aus Gründen der Gefahr des Kreditbetrugs und des
Nichtzurückführens des Kreditbetrages jedoch keinen Kredit ohne
vorherige Prüfung vergibt, werden im Regelfall vor der Entscheidung über
die Vergabe zwei Voraussetzungen geprüft.
Dies ist zum einen die Prüfung der Kreditfähigkeit, als Fähigkeit des
rechtswirksamen Schließens von Kreditverträgen, und der
Kreditwürdigkeit, welche zusammengesetzt wird aus den jeweiligen
wirtschaftlichen Verhältnissen und der persönlichen Bonität 2.
Zum Anderen ist dies die Kreditsicherung. Diese erfolgt aus dem Grund,
dass das Kreditinstitut mit der Gefahr rechnen muss, dass der
Kreditnehmer seine Verpflichtung zur Rückzahlung bei Fälligkeit des
Kredits nicht erfüllt oder nicht erfüllen kann. Um bei Eintritt eines solchen
Falles nicht die gesamte Kreditsumme abschreiben zu müssen, werden
für die kreditgebende Bank dem Kreditbetrag entsprechende Sicherheiten
bestellt. 3 [...]
1 Vgl. Grill/Perczynski, 2001, Seite 338
2 Vgl. Grill/Perczynski, 2001, Seite 341
3 Vgl. Ohlmeyer/Gördel, 1990, Seite 283
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Pfandrecht an beweglichen Sachen
- Das Wesen des Pfandrechts an beweglichen Sachen
- Die Bestellung eines Pfandrechts
- Die Beendigung eines Pfandrechts
- Erlöschen eines Pfandrechts
- Verwertung der verpfändeten Sache
- Die Sicherungsübereignung
- Das Wesen der Sicherungsübereignung
- Die Verwertung von sicherungsübereigneten Sachen
- Vergleich der Sicherungsübereignung und des Pfandrechts an beweglichen Sachen aus Sicht des Kreditinstituts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sicherungsübereignung und der Verpfändung von beweglichen Sachen als Möglichkeiten der Kreditbesicherung. Ziel ist es, die beiden Verfahren zu erläutern und im Hinblick auf ihre Bedeutung für Kreditinstitute zu vergleichen.
- Das Wesen des Pfandrechts und der Sicherungsübereignung
- Die Bestellung und Beendigung von Pfandrechten
- Die Verwertung verpfändeter und sicherungsübereigneter Sachen
- Der Vergleich beider Verfahren aus der Perspektive des Kreditinstituts
- Die Bedeutung von Kreditsicherheiten im Wirtschaftskreislauf
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung beschreibt den alltäglichen Kreditbedarf in der deutschen Wirtschaft und unterteilt die Wirtschaftsteilnehmer in private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Haushalte. Sie hebt die Rolle von Kreditinstituten bei der Bereitstellung von Kapital hervor und erläutert die Notwendigkeit von Kreditsicherheiten zur Absicherung des Kreditinstituts gegen Kreditbetrug und Ausfallrisiken. Die Prüfung der Kreditfähigkeit und -würdigkeit sowie die Kreditsicherung werden als entscheidende Faktoren vor der Kreditvergabe genannt. Die Notwendigkeit von Sicherheiten, wie der Sicherungsübereignung und der Verpfändung, wird als Schutzmaßnahme für Kreditinstitute gegenüber dem Risiko des Kreditverlusts dargestellt.
Das Pfandrecht an beweglichen Sachen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Pfandrecht an beweglichen Sachen. Es analysiert das Wesen des Pfandrechts, die Verfahren zu seiner Bestellung und seine Beendigung, einschließlich des Erlöschens und der Verwertung der verpfändeten Sache. Es beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktischen Aspekte der Umsetzung eines Pfandrechts. Die Ausführungen dienen als Grundlage für den späteren Vergleich mit der Sicherungsübereignung.
Die Sicherungsübereignung: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Sicherungsübereignung als eine weitere Möglichkeit der Kreditbesicherung. Es wird das Wesen der Sicherungsübereignung erklärt und die Verwertung von sicherungsübereigneten Sachen im Detail untersucht. Die rechtlichen Aspekte und die praktischen Implikationen dieser Methode werden beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis für die Funktionsweise und Anwendung zu schaffen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zur Verpfändung.
Vergleich der Sicherungsübereignung und des Pfandrechts an beweglichen Sachen aus Sicht des Kreditinstituts: Dieses Kapitel vergleicht die Sicherungsübereignung und das Pfandrecht aus der Perspektive des Kreditinstituts. Es analysiert die Vor- und Nachteile beider Verfahren, bewertet die Effizienz und den Aufwand der jeweiligen Verfahren und berücksichtigt die praktische Anwendung im Kreditgeschäft. Der Vergleich dient der Entscheidungsfindung für Kreditinstitute bei der Auswahl der geeigneten Sicherungsmethode.
Schlüsselwörter
Kreditbesicherung, Sicherungsübereignung, Pfandrecht, bewegliche Sachen, Kreditinstitut, Kreditrisiko, Verwertung, Rechtsvergleich, Wirtschaftskreislauf, Kreditfähigkeit, Kreditwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Sicherungsübereignung und Pfandrecht an beweglichen Sachen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Sicherungsübereignung und das Pfandrecht an beweglichen Sachen als Methoden der Kreditbesicherung. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Verfahren aus der Sicht eines Kreditinstituts.
Welche Themen werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind das Wesen des Pfandrechts und der Sicherungsübereignung, die Bestellung und Beendigung von Pfandrechten, die Verwertung verpfändeter und sicherungsübereigneter Sachen, ein detaillierter Vergleich beider Verfahren aus Kreditinstituts-Sicht und die Bedeutung von Kreditsicherheiten im Wirtschaftskreislauf. Das Dokument erläutert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktischen Aspekte beider Verfahren.
Wer ist die Zielgruppe dieses Dokuments?
Das Dokument richtet sich an Personen, die sich mit den Themen Kreditbesicherung, Sicherungsübereignung und Pfandrecht auseinandersetzen, insbesondere Kreditinstitute und Studierende im Bereich Wirtschaftsrecht oder Finanzwesen. Es dient als Informationsquelle und Hilfestellung zum Verständnis der beiden Verfahren und deren Anwendung.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Sicherungsübereignung und Pfandrecht?
Der detaillierte Vergleich der Sicherungsübereignung und des Pfandrechts aus der Sicht des Kreditinstituts wird in einem eigenen Kapitel behandelt. Die Unterschiede liegen vor allem in den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Verfahren der Bestellung und Beendigung sowie den jeweiligen Vor- und Nachteilen für das Kreditinstitut hinsichtlich Effizienz, Aufwand und praktischer Anwendung im Kreditgeschäft. Das Dokument analysiert diese Unterschiede und hilft bei der Entscheidungsfindung für die Auswahl der geeigneten Sicherungsmethode.
Wie wird das Pfandrecht an beweglichen Sachen behandelt?
Das Kapitel zum Pfandrecht an beweglichen Sachen beschreibt detailliert dessen Wesen, die Bestellung und Beendigung (inkl. Erlöschen und Verwertung der verpfändeten Sache). Es beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktischen Aspekte der Umsetzung. Dies dient als Grundlage für den Vergleich mit der Sicherungsübereignung.
Wie wird die Sicherungsübereignung behandelt?
Das Kapitel zur Sicherungsübereignung erläutert detailliert deren Wesen und die Verwertung sicherungsübereigneter Sachen. Es beleuchtet die rechtlichen Aspekte und die praktischen Implikationen, mit Fokus auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zum Pfandrecht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kreditbesicherung, Sicherungsübereignung, Pfandrecht, bewegliche Sachen, Kreditinstitut, Kreditrisiko, Verwertung, Rechtsvergleich, Wirtschaftskreislauf, Kreditfähigkeit, Kreditwürdigkeit.
Welche Rolle spielen Kreditsicherheiten im Wirtschaftskreislauf?
Die Bedeutung von Kreditsicherheiten wie Sicherungsübereignung und Pfandrecht wird im Kontext des alltäglichen Kreditbedarfs in der deutschen Wirtschaft (private Haushalte, Unternehmen, öffentliche Haushalte) und der Rolle der Kreditinstitute bei der Kapitalbereitstellung hervorgehoben. Sie dienen dem Schutz der Kreditinstitute vor Kreditbetrug und Ausfallrisiken.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in eine Einführung, ein Kapitel zum Pfandrecht an beweglichen Sachen, ein Kapitel zur Sicherungsübereignung und ein Kapitel zum Vergleich beider Verfahren gegliedert. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
- Arbeit zitieren
- Sven Reimer (Autor:in), 2003, Die Sicherungsübereignung und die Verpfändung von beweglichen Sachen als Möglichkeiten der Kreditbesicherung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/14142