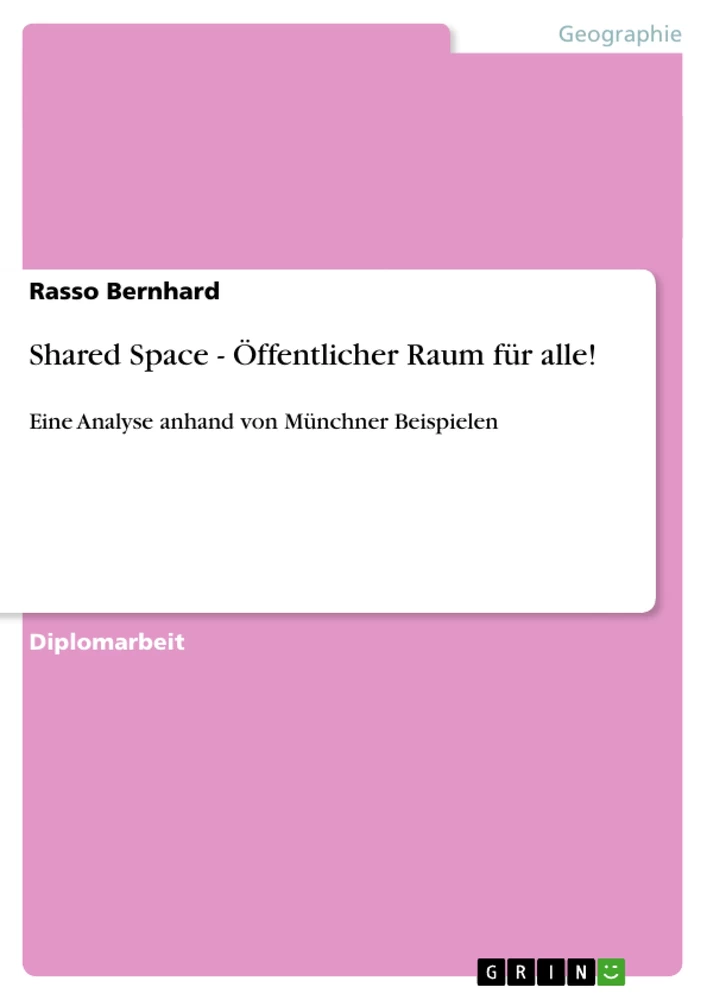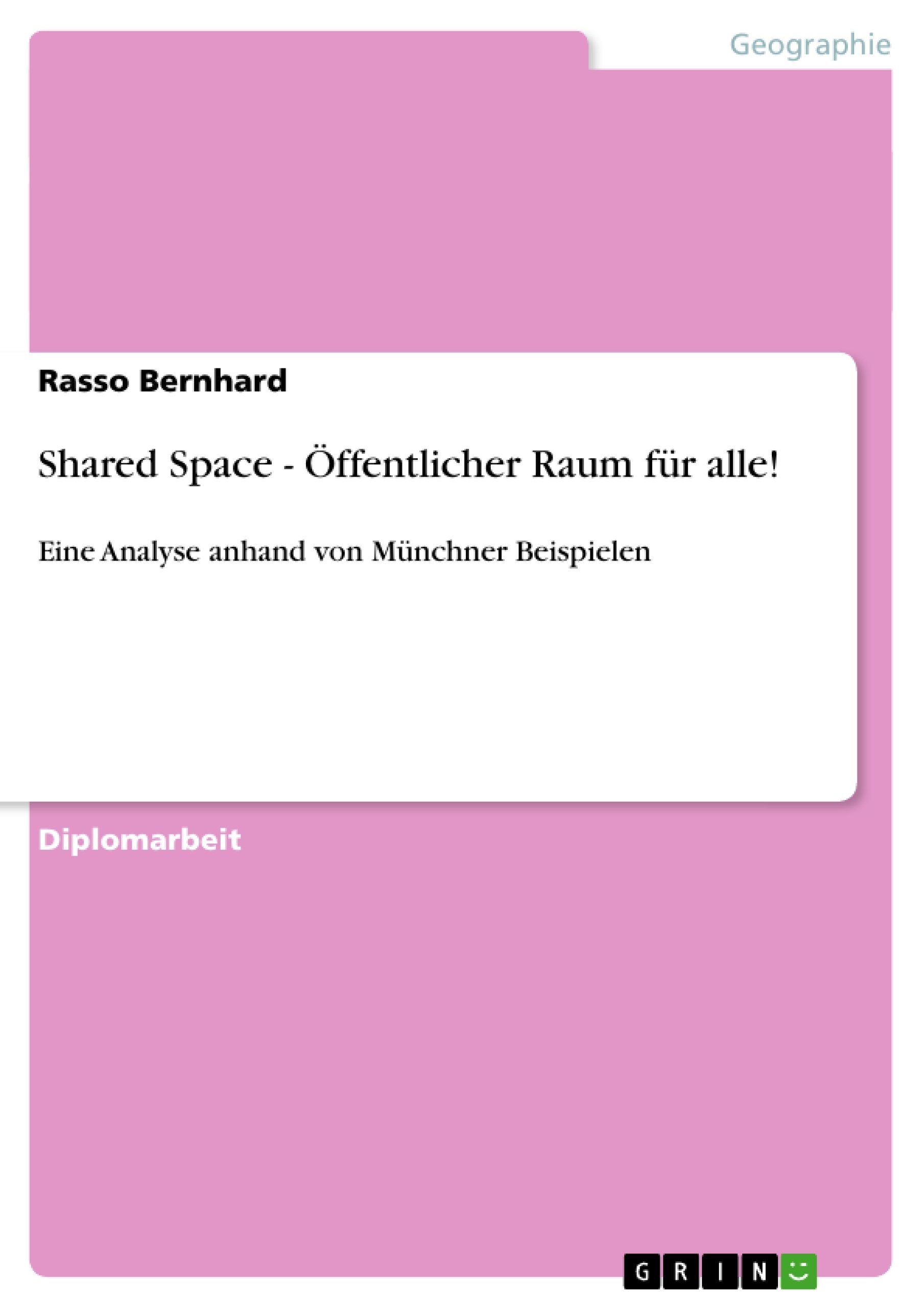In meiner Diplomarbeit wird ein Verkehrskonzept bzw. eine städtische Gestaltungsphilosophie namens Shared Space erklärt und anhand von drei ausgewählten Orten in München untersucht.
Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert.
Der theoretische Teil befasst sich mit dem Konzept von Shared Space. Dabei wird nicht nur die Philosophie des Konzeptes erörtert, sondern auch wie und wo Shared Space in der Praxis funktionieren kann und wo das Konzept sinnvoll ist.
Leitidee des Konzeptes ist es, den in den letzten Jahrzehnten durch die Raum- bzw. Stadtplanung dem Verkehr weitestgehend überlassenen öffentlichen Raum für die Menschen zurückzugewinnen.
In dem empirischen Teil ist es übergeordnetes Ziel – mittels einer Fragebogenuntersuchung –anhand von ausgewählten Orten in München zu untersuchen, ob das Konzept aus Sicht der dortigen Verkehrsteilnehmer und der sich dort aufhaltenden Personen funktionieren kann.
Die Arbeit wird eingeleitet mit einem Kapitel über die Auswirkungen der Verkehrs- bzw. Stadtplanung der letzten Jahrzehnte.
Daraufhin werden die Forschungsfragen aufgestellt. Herausgefunden soll beispielsweise werden, ob die drei Untersuchungsorte, die sich durch Regellosigkeit in der Verkehrsführung auszeichnen, von den Verkehrsteilnehmern als sicher oder unsicher angesehen werden und ob die motorisierten Verkehrsteilnehmer die Verkehrssicherheit höher oder niedriger einschätzen als die nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer. Eine weitere zentrale Frage ist, ob eine Mischfläche als geeignet bzw. ungeeignet für die untersuchten Orte beurteilt wird und inwieweit dieses Mischungsprinzip von Seiten der motorisierten Verkehrsteilnehmer überhaupt erwünscht ist. Da Shared Space nicht nur ein Verkehrskonzept, sondern auch eine städtische Gestaltungsphilosophie ist, wird die Aufenthaltsqualität an den drei Orten untersucht. Dabei soll beispielsweise die Sicht der Fußgänger bzw. Radfahrer zeigen, ob sich der motorisierte Verkehr negativ auf die Aufenthaltsqualität auswirkt.
Im zweiten Kapitel werden daraufhin wichtige Fachtermini erklärt und definiert.
Im darauf folgenden Kapitel 3 zeigt dann ein historischer Rückblick, wie die städtebaulichen Leitbilder in der Verkehrsplanung ab 1950 aussahen.
Im ersten Abschnitt von Kapitel 4 wird anschließend das Konzept theoretisch aufgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Forschungsfrage
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Forschungsfrage
- 2 Begriffserklärungen und Begriffsdefinitionen
- 3 Historischer Rückblick - städtebauliche Leitbilder in der Verkehrsplanung
- 3.1 Die autogerechte Stadt (ab 1950)
- 3.2 Der stadtgerechte Verkehr (1971-1980)
- 3.3 Der menschengerechte Verkehr (ab 1980)
- 4 Shared Space: Öffentlicher Raum für alle!
- 4.1 Zur Theorie von Shared Space
- 4.1.1 Was bedeutet Shared Space und woher kommt das Konzept?
- 4.1.2 Menschenraum vs. Verkehrsraum
- 4.1.3 Langsames und schnelles Verkehrsnetz
- 4.1.4 Soziales Verkehrsverhalten
- 4.1.5 Sicherheit im Verkehr
- 4.1.6 Ansprüche an den öffentlichen (Straßen-)Raum
- 4.2 Shared Space in der Praxis
- 4.2.1 Wo ist Shared Space sinnvoll?
- 4.2.2 Wie wird Shared Space umgesetzt? - Gestaltungselemente
- 4.2.3 Wie wird Shared Space umgesetzt? - Der Planungsprozess
- 4.2.4 Schwierigkeiten für bestimmte Personengruppen
- 4.2.5 Ist Shared Space in Deutschland rechtlich möglich?
- 4.3 EU-Projekt – Interreg IIIB North Sea Programme
- 4.3.1 Das Projekt im Überblick
- 4.3.2 Das Beispiel Haren (Niederlande)
- 5 Shared Space in München (vergleichbare Verkehrsführung in München)
- 5.1 Die Standorte der Untersuchung und ihre Restriktionen
- 5.1.1 Gärtnerplatz (Kreisverkehr)
- 5.1.2 Pariser Platz (Kreisverkehr)
- 5.1.3 Westermühl-/Hans-Sachs-/Jahnstraße (Kreuzungsbereich)
- 5.2 Die Befragung
- 5.2.1 Methodisches Vorgehen
- 5.2.1.1 Art der Befragung
- 5.2.1.2 Auswahlverfahren
- 5.2.1.3 Pretests
- 5.2.2 Datenerhebung
- 5.2.3 Datenanalyse und Datenauswertung
- 6 Ergebnisse der Untersuchung
- 6.1 Erste allgemeine Ergebnisse
- 6.2 Fußgänger/Radfahrer und Pkw-/motorisierter Verkehr – Einschätzungen der Befragten
- 6.2.1 Fußgänger/Radfahrer
- 6.2.2 Pkw-/motorisierter Verkehr
- 6.2.3 Fußgänger/Radfahrer und Pkw-/motorisierter Verkehr
- 6.2.4 Demographische und andere Unterschiede bei der Verkehrssicherheit
- 6.3 Vergleich der drei Untersuchungsorte
- 6.3.1 Verkehrssicherheit an den drei Untersuchungsorten
- 6.3.2 Räumliche Funktionen an den drei Untersuchungsorten
- 6.3.3 Die Mischfläche an den drei Untersuchungsorten
- 6.3.4 Zufriedenheit mit der Aufenthaltsqualität an den drei Untersuchungsorten
- 7 Fazit der Untersuchung und Ausblick
- 7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 7.2 Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept des Shared Space im Kontext der Verkehrsplanung und -gestaltung. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, wie Shared Space die Gestaltung des öffentlichen Raums und die Interaktion zwischen Fußgängern, Radfahrern und motorisiertem Verkehr beeinflussen kann. Die Arbeit analysiert die Theorie des Shared Space, betrachtet dessen Umsetzung in der Praxis und untersucht schließlich die Anwendung des Konzepts in München anhand dreier Fallbeispiele.
- Entwicklung und Konzeption des Shared Space Konzepts
- Bewertung der Verkehrssicherheit im Kontext von Shared Space
- Analyse des Einflusses von Shared Space auf den öffentlichen Raum
- Untersuchung der Akzeptanz des Shared Space Konzepts durch verschiedene Nutzergruppen
- Bewertung des Potenzials von Shared Space zur Gestaltung einer lebenswerten Stadt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 stellt die Forschungsfrage und die Motivation für die Arbeit vor. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der Stadtentwicklung und der Verkehrsplanung aufgezeigt.
- Kapitel 2 definiert die wichtigsten Begriffe und Konzepte, die für die Untersuchung relevant sind, wie z.B. Shared Space, autogerechte Stadt und menschengerechter Verkehr.
- Kapitel 3 beleuchtet die historischen Entwicklungen in der Verkehrsplanung und die Entstehung unterschiedlicher städtebaulicher Leitbilder. Es wird die Bedeutung der Verkehrswende im Kontext des Shared Space Konzepts beleuchtet.
- Kapitel 4 befasst sich mit der Theorie des Shared Space Konzepts. Es werden die Ziele, die Prinzipien und die Funktionsweise von Shared Space erläutert. Die potenziellen Vorteile und Herausforderungen des Konzepts werden diskutiert.
- Kapitel 5 stellt die Fallbeispiele aus München vor und beschreibt die Standorte der Untersuchung sowie die Methodik der Datengewinnung.
- Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die Daten aus den Fallbeispielen. Es werden die verschiedenen Nutzergruppen und deren Wahrnehmungen sowie die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum und die Verkehrssicherheit untersucht.
Schlüsselwörter
Shared Space, Verkehrsplanung, Stadtgestaltung, öffentlicher Raum, Verkehrssicherheit, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Verkehr, Aufenthaltsqualität, Lebensqualität, Stadtentwicklung, Verkehrswende, München, Fallbeispiele.
- Citation du texte
- Diplomand Rasso Bernhard (Auteur), 2009, Shared Space - Öffentlicher Raum für alle!, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141493