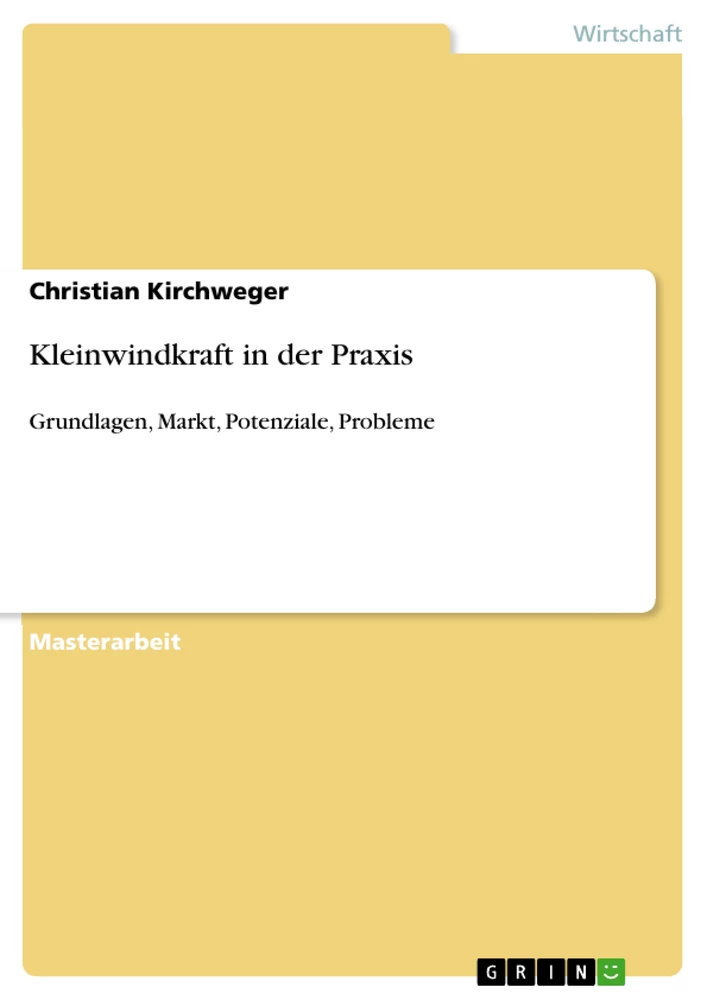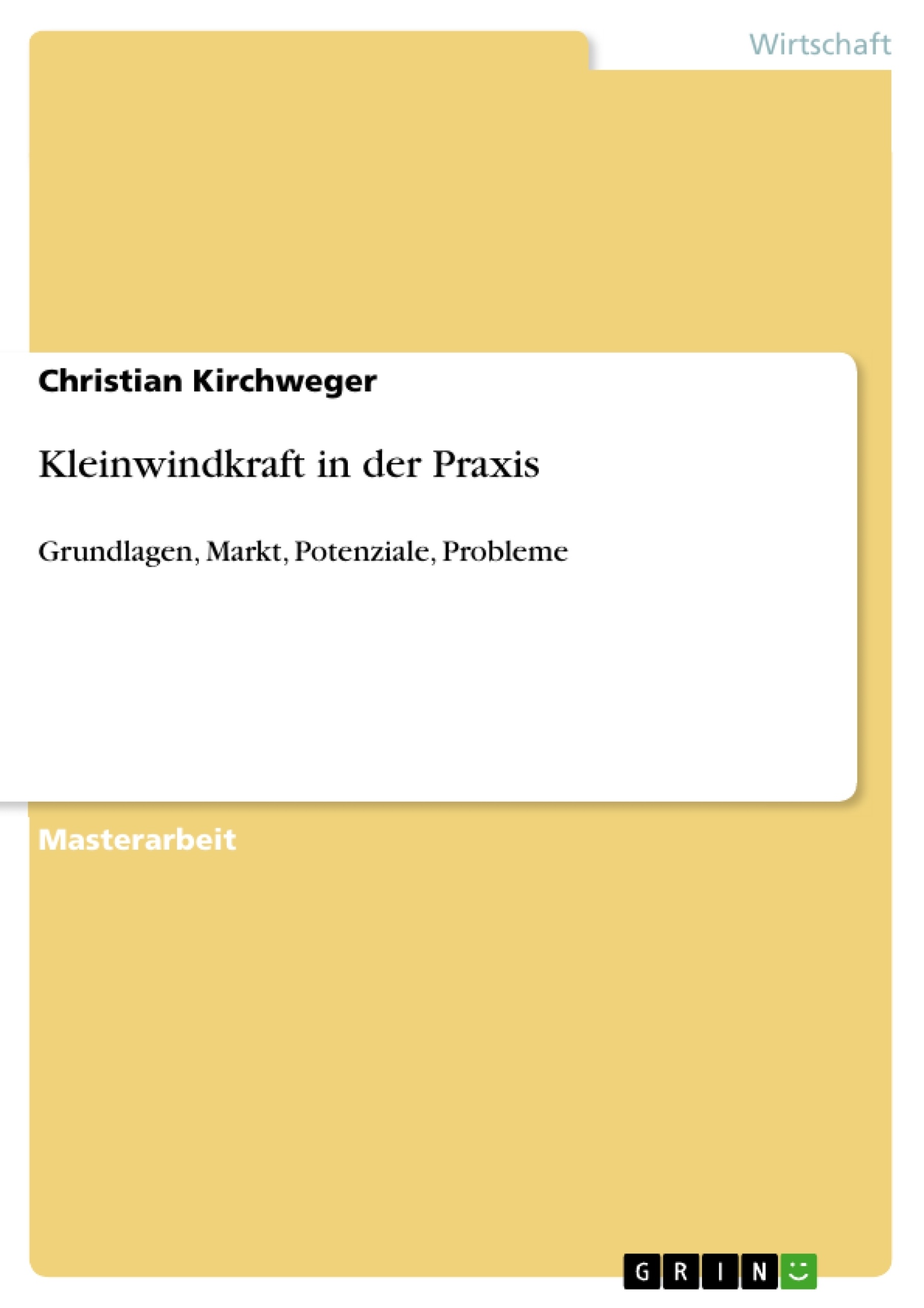Großwindkraft hat in den vergangenen 20 Jahren eine beeindruckende Entwicklung vollzogen und leistet in vielen Ländern bereits einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung: In Dänemark wurde 2008 rund ein Fünftel des Strombedarfs aus Windkraft gedeckt, in Deutschland lag der Wert bei knapp 8 %. Langsam gedeiht nun auch ein bunter Markt für Kleinwindkraft im Schatten der großen Mühlen. Seit Jänner 2009 gibt es in Deutschland einen eigenen Bundesverband für Kleinwindkraftanlagen und im März dieses Jahres hat Europas erstes Symposium für diesen Teil der Ökostrombranche stattgefunden.
Obwohl sich mittlerweile eine Vielzahl von Unternehmen mit dem Thema beschäftigen und dabei auf beachtliches Kundeninteresse stoßen, fehlt es der Branche häufig noch an definierten Mindeststandards, angepassten rechtlichen Rahmenbedingungen und der gesonderten Berücksichtigung im Rahmen der Ökostromförderung. Während die Großwindkraft eine hochprofessionelle Industrie darstellt, stecken viele Kleinwindkraftkonzepte noch in den Kinderschuhen und bringen eine Reihe von Problemen mit sich. Dabei ist noch nicht einmal klar definiert, wo die Grenzen zwischen Mikro-, Klein- und Großwindkraft zu ziehen sind.
Die vorliegende Arbeit versucht praxisnah eine solche Abgrenzung zu finden und das Segment Kleinwindkraft zu definieren. Weiters sind meteorologische und technische Grundlagen, die für den Einsatz von Kleinwindkraftanlagen relevant sein können, Thema dieses Papiers. Ebenso wird ein kurzer Marktüberblick geliefert. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich einem einjährigen Praxistest, mit dem der Betrieb von Kleinwindkraftanlagen auf typischen Standorten in Ober- und Niederösterreich untersucht wurde. Aus den Ergebnissen sollen Stärken, Schwächen und Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden.
Die Arbeit soll zeigen, was Kleinwindkraft auf „Leichtwind-Standorten“ zu leisten in der Lage ist. Ziel ist es, das Verständnis für diese Technik zu schärfen und Potenziale sowie Grenzen aufzuzeigen. Für Interessenten und potenzielle Kunden soll die vorliegende Arbeit eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodik
- 3. Geschichte der Windkraft
- 3.1 Die Ursprünge der Nutzung der Windenergie
- 3.1.1 Windmühlen
- 3.1.2 Westernräder
- 3.1.3 Strom aus Wind – die ersten Kleinwindkraftanlagen
- 3.2 Moderne Windkraft – Neustart in den 1970ern
- 3.1 Die Ursprünge der Nutzung der Windenergie
- 4. Aktuelle Zahlen aus der Windkraft
- 4.1 Windkraft International
- 4.2 Windkraft in Österreich
- 5. Meteorologische und physikalische Grundlagen
- 5.1 Ursprung der Windenergie – globale Zirkulation
- 5.2 Einteilung der Windressourcen und Windschichten
- 5.2.1 Eckmann-Schicht
- 5.2.2 Prandtl-Schicht
- 5.2.3 Bodennahe, turbulente Schicht
- 5.2.4 Spezielle, lokale Winde
- 5.2.5 Diskussion zu Windressourcen und Windschichten
- 5.3 Einflussgrößen auf die Wind-Energie
- 5.3.1 Luftdichte
- 5.3.2 Windgeschwindigkeit
- 5.3.3 Rotorfläche
- 5.4 Wichtige Begriffe bei der Windenergie-Nutzung
- 5.4.1 Rauhigkeitslängen und Rauhigkeitsklassen
- 5.4.2 Windscherung
- 5.4.3 Das Betz’sche Gesetz
- 5.4.4 Standort-Effekte
- 5.4.5 Weibull-Verteilung
- 5.4.6 Windrose und Rauhigkeitsrose
- 5.4.7 Die Leistungskurve einer Windkraftanlage
- 5.4.8 Schnelllaufzahl
- 5.4.9 Der Leistungsbeiwert bzw. Wirkungsgrad
- 5.4.10 Der Auslastungsfaktor
- 5.5 Stetigkeit des Windes
- 5.5.1 Tagesgang
- 5.5.2 Jahreszeitliche Unterschiede
- 5.5.3 Langfristige Schwankungen des Windpotenzials
- 6. Technische Grundlagen von Windkraftanlagen
- 6.1 Einteilung nach verschiedenen Bauformen
- 6.1.1 Widerstandsläufer und Auftriebsläufer
- 6.1.2 Langsamläufer und Schnellläufer
- 6.1.3 Vertikal- und Horizontalläufer
- 6.1.4 Luv- oder Lee-Läufer
- 6.2 Eigenschaften verschiedener Rotorbauformen
- 6.3 Baumaterialen für Rotorblätter
- 6.4 Windnachführung des Rotors
- 6.4.1 Windfahnen
- 6.4.2 Leeseitige Ausrichtung
- 6.4.3 Seitenräder
- 6.4.4 Aktive Azimut-Regelung
- 6.5 Leistungsregelung von Windkraftanlagen
- 6.5.1 Blattwinkelregelung (Pitch-Regelung)
- 6.5.2 Stall-Regelung (Strömungsabriss)
- 6.5.3 Aktive Stall-Regelung
- 6.5.4 Azimut-Regelung (Rotor aus dem Wind drehen)
- 6.6 Weitere wichtige Komponenten einer Windkraftanlage
- 6.6.1 Generator
- 6.6.2 Getriebe
- 6.6.3 Turm und Fundament
- 6.6.4 Steuereinheit und Frequenzumrichter
- 6.7 Betriebssicherheit von Windkraftsystemen
- 6.1 Einteilung nach verschiedenen Bauformen
- 7. Kleinwindkraft
- 7.1 Abgrenzung von Mikro-, Klein- und Großwindkraft
- 7.1.1 Mikrowindkraftanlagen (MWA)
- 7.1.2 Kleinwindkraftanlagen (KWA)
- 7.1.3 Großwindkraftanlagen (GWA)
- 7.2 Definition von MWA, KWA und GWA
- 7.3 Kosten und Wirtschaftlichkeit von KWA
- 7.4 Potenzial von KWA
- 7.5 Rechtlicher Rahmen bei der Errichtung von KWA
- 7.5.1 Gesetzeslage zur Kleinwindkraft in NÖ
- 7.5.2 Gesetzeslage zur Kleinwindkraft in OÖ
- 7.6 Diskussion zu Kleinwindkraftanlagen
- 7.6.1 Spezial-Segment „Urban Wind Turbines“
- 7.6.2 Kleinwindkraft im historischen Kontext
- 7.6.3 Kleinwindkraft und Photovoltaik
- 7.1 Abgrenzung von Mikro-, Klein- und Großwindkraft
- 8. Spielen mit dem Wind: Eine Marktanalyse
- 9. Kleinwindkraftanlagen von Austrowind
- 9.1 Firmenchronologie
- 9.2 Technische Beschreibung der Austrowind-Produkte
- 9.2.1 Generator
- 9.2.2 Rotor
- 9.2.3 Wechselrichter und Steuereinheit
- 9.2.4 Kippmasten
- 9.2.5 Fundament
- 9.2.6 Betriebsdaten
- 9.3 Anlagekosten und Wirtschaftlichkeit
- 10. Austrowind im einjährigen Praxistest
- 10.1 Standortbeurteilung bei Kleinwindkraftanlagen
- 10.1.1 Professionelle Wind-Potenzialanalyse
- 10.1.2 Wind-Potenzialanalyse in der Kleinwind-Praxis
- 10.2 Standortbeurteilung des Standortes in Altenberg
- 10.3 Ertragsprognose für den Standort Altenberg
- 10.3.1 Ermittlung der Weibull-Verteilung
- 10.3.2 Ermittlung des theoretischen Jahresertrages
- 10.3.3 Kontrolle der Ertragsprognose
- 10.3.4 Alternative Ertragsprognose mit der Aventa AV-7
- 10.4 Tatsächlich erbrachte Erträge im ersten Jahr
- 10.5 Erkenntnisse aus dem einjährigen Praxistest
- 10.5.1 Zur Windmessung
- 10.5.2 Zum Standort in Altenberg
- 10.5.3 Zur Technik der Anlage
- 10.5.4 Zur Dimensionierung
- 10.5.5 Zur Wirtschaftlichkeit
- 10.1 Standortbeurteilung bei Kleinwindkraftanlagen
- 11. Schlussfolgerungen für den Standort St. Valentin
- 12. Resümee zur Kleinwindkraft im Allgemeinen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht praxisnah das Potential von Kleinwindkraftanlagen (KWA) an typischen Standorten in Ober- und Niederösterreich. Die Arbeit zielt darauf ab, das Verständnis für die Technologie zu verbessern, Potenziale aufzuzeigen und Grenzen zu definieren. Ein einjähriger Praxistest mit einer KWA liefert dazu wichtige Erkenntnisse.
- Definition und Abgrenzung von Mikro-, Klein- und Großwindkraftanlagen
- Marktanalyse und Wirtschaftlichkeit von KWA
- Standortanalyse und -bewertung für KWA
- Technische Grundlagen und Herausforderungen von KWA
- Rechtliche Rahmenbedingungen für die Errichtung von KWA
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit entstand aus dem Interesse des Autors an Kleinwindkraftanlagen, nachdem ein unseriöses Geschäftsmodell gescheitert war. Die zunehmende Nachfrage nach Kleinwindkraftanlagen und die Berichte über unseriöse Anbieter motivierten zur Untersuchung der Einsatztauglichkeit dieser Anlagen in Österreich, unter besonderer Berücksichtigung der Firma Austrowind.
2. Methodik: Die Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Praxisteil. Der Theorieteil behandelt die Geschichte der Windkraft, meteorologische und technische Grundlagen sowie Marktüberblicke. Der Praxisteil umfasst einen einjährigen Praxistest einer Austrowind-Anlage in Altenberg und eine Standortanalyse in St. Valentin, unterstützt durch Vergleichsmessungen und Experteninterviews.
3. Geschichte der Windkraft: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Nutzung der Windenergie von den Anfängen bis zur modernen Windkraft, mit Fokus auf Windmühlen, Westernräder und die ersten Kleinwindkraftanlagen. Es zeigt die Entwicklung von Widerstandsläufern zu effizienten Auftriebsläufern und den Wandel der Technik im Laufe der Zeit.
4. Aktuelle Zahlen aus der Windkraft: Das Kapitel präsentiert einen Überblick über den globalen und österreichischen Windkraftmarkt, inklusive installierter Leistung, Zubauzahlen und die Rolle Österreichs in der internationalen Windkraftindustrie. Es werden auch die Herausforderungen, wie beispielsweise die Anpassung der Ökostromförderung, angesprochen.
5. Meteorologische und physikalische Grundlagen: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von Wind, die Einteilung von Windschichten (Eckmann, Prandtl, bodennahe Schicht) und den Einfluss von Faktoren wie Luftdichte und Windgeschwindigkeit auf die Energiegewinnung. Wichtige Begriffe wie Weibull-Verteilung, Windscherung und Betz’sches Gesetz werden erläutert.
6. Technische Grundlagen von Windkraftanlagen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Bauformen von Windkraftanlagen (Widerstandsläufer, Auftriebsläufer, Langsamläufer, Schnellläufer, Vertikal- und Horizontalläufer, Luv- und Lee-Läufer), Rotorbauformen, Materialien und die wichtigsten Komponenten (Generator, Getriebe, Turm, Fundament, Steuereinheit). Es werden unterschiedliche Leistungsregelungen (Blattwinkel, Stall-Regelung, Azimut-Regelung) und die Betriebssicherheit behandelt.
7. Kleinwindkraft: Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung und Definition von Mikro-, Klein- und Großwindkraftanlagen, analysiert die Kosten und Wirtschaftlichkeit von KWA, deren Potenzial und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich (NÖ und OÖ). Der „Urban Wind Turbine“-Markt und der Vergleich mit Photovoltaik werden ebenfalls beleuchtet.
8. Spielen mit dem Wind: Eine Marktanalyse: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über den Markt für Kleinwindkraftanlagen, zeigt die Vielfalt der Konzepte und veranschaulicht die Herausforderungen der Branche.
9. Kleinwindkraftanlagen von Austrowind: Das Kapitel beschreibt die Firma Austrowind, ihre Produkte und ihre Geschäftsentwicklung. Es beinhaltet eine Firmenchronologie und eine detaillierte technische Beschreibung der Austrowind-Anlagen.
10. Austrowind im einjährigen Praxistest: Dieser Abschnitt präsentiert einen einjährigen Praxistest einer Austrowind 20-kW-Anlage in Altenberg. Er beinhaltet eine Standortanalyse, Vergleichsmessungen mit verschiedenen Windmessgeräten (WS 888 und WindSonic), Ertragsprognosen und eine Analyse der tatsächlich erzielten Erträge. Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert und Verbesserungspotenziale aufgezeigt.
11. Schlussfolgerungen für den Standort St. Valentin: Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Praxistest in Altenberg, werden Schlussfolgerungen für einen potenziellen Standort in St. Valentin gezogen. Eine vergleichende Standortanalyse wird durchgeführt und verschiedene KWA-Modelle werden hinsichtlich ihrer Eignung bewertet.
Schlüsselwörter
Kleinwindkraft, Mikrowindkraft, Großwindkraft, Windenergie, Standortanalyse, Wirtschaftlichkeit, Ertragsprognose, Weibull-Verteilung, Technische Grundlagen, Rechtliche Rahmenbedingungen, Österreich, Austrowind, Praxistest, Windmessung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Praxisnahe Untersuchung des Potenzials von Kleinwindkraftanlagen
Was ist der Fokus dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht praxisnah das Potential von Kleinwindkraftanlagen (KWA) an typischen Standorten in Ober- und Niederösterreich. Sie zielt darauf ab, das Verständnis für die Technologie zu verbessern, Potenziale aufzuzeigen und Grenzen zu definieren. Ein einjähriger Praxistest mit einer KWA liefert dazu wichtige Erkenntnisse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Abgrenzung von Mikro-, Klein- und Großwindkraftanlagen, eine Marktanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von KWA, Standortanalyse und -bewertung, technische Grundlagen und Herausforderungen von KWA sowie die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung von KWA.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Praxisteil. Der Theorieteil behandelt die Geschichte der Windkraft, meteorologische und technische Grundlagen sowie Marktüberblicke. Der Praxisteil umfasst einen einjährigen Praxistest einer Austrowind-Anlage in Altenberg und eine Standortanalyse in St. Valentin, unterstützt durch Vergleichsmessungen und Experteninterviews.
Welche Aspekte der Windkraftgeschichte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Nutzung der Windenergie von den Anfängen bis zur modernen Windkraft, mit Fokus auf Windmühlen, Westernräder und die ersten Kleinwindkraftanlagen. Es wird die Entwicklung von Widerstandsläufern zu effizienten Auftriebsläufern und der Wandel der Technik im Laufe der Zeit gezeigt.
Welche aktuellen Zahlen zur Windkraft werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert einen Überblick über den globalen und österreichischen Windkraftmarkt, inklusive installierter Leistung, Zubauzahlen und die Rolle Österreichs in der internationalen Windkraftindustrie. Herausforderungen wie die Anpassung der Ökostromförderung werden ebenfalls angesprochen.
Welche meteorologischen und physikalischen Grundlagen werden erläutert?
Die Arbeit beschreibt die Entstehung von Wind, die Einteilung von Windschichten (Eckmann, Prandtl, bodennahe Schicht) und den Einfluss von Faktoren wie Luftdichte und Windgeschwindigkeit auf die Energiegewinnung. Wichtige Begriffe wie Weibull-Verteilung, Windscherung und Betz’sches Gesetz werden erläutert.
Welche technischen Grundlagen von Windkraftanlagen werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Bauformen von Windkraftanlagen (Widerstandsläufer, Auftriebsläufer, Langsamläufer, Schnellläufer, Vertikal- und Horizontalläufer, Luv- und Lee-Läufer), Rotorbauformen, Materialien und die wichtigsten Komponenten (Generator, Getriebe, Turm, Fundament, Steuereinheit). Unterschiedliche Leistungsregelungen (Blattwinkel, Stall-Regelung, Azimut-Regelung) und die Betriebssicherheit werden ebenfalls behandelt.
Wie werden Kleinwindkraftanlagen definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung und Definition von Mikro-, Klein- und Großwindkraftanlagen, analysiert die Kosten und Wirtschaftlichkeit von KWA, deren Potenzial und die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich (NÖ und OÖ). Der „Urban Wind Turbine“-Markt und der Vergleich mit Photovoltaik werden ebenfalls beleuchtet.
Was beinhaltet die Marktanalyse für Kleinwindkraftanlagen?
Die Marktanalyse gibt einen Überblick über den Markt für Kleinwindkraftanlagen, zeigt die Vielfalt der Konzepte und veranschaulicht die Herausforderungen der Branche.
Welche Informationen werden über die Firma Austrowind bereitgestellt?
Die Arbeit beschreibt die Firma Austrowind, ihre Produkte und ihre Geschäftsentwicklung. Sie beinhaltet eine Firmenchronologie und eine detaillierte technische Beschreibung der Austrowind-Anlagen.
Was beinhaltet der einjährige Praxistest mit einer Austrowind-Anlage?
Der Praxistest präsentiert einen einjährigen Test einer Austrowind 20-kW-Anlage in Altenberg. Er beinhaltet eine Standortanalyse, Vergleichsmessungen mit verschiedenen Windmessgeräten (WS 888 und WindSonic), Ertragsprognosen und eine Analyse der tatsächlich erzielten Erträge. Die Ergebnisse werden kritisch diskutiert und Verbesserungspotenziale aufgezeigt.
Welche Schlussfolgerungen werden für den Standort St. Valentin gezogen?
Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Praxistest in Altenberg, werden Schlussfolgerungen für einen potenziellen Standort in St. Valentin gezogen. Eine vergleichende Standortanalyse wird durchgeführt und verschiedene KWA-Modelle werden hinsichtlich ihrer Eignung bewertet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kleinwindkraft, Mikrowindkraft, Großwindkraft, Windenergie, Standortanalyse, Wirtschaftlichkeit, Ertragsprognose, Weibull-Verteilung, Technische Grundlagen, Rechtliche Rahmenbedingungen, Österreich, Austrowind, Praxistest, Windmessung.
- Quote paper
- Christian Kirchweger (Author), 2009, Kleinwindkraft in der Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141495