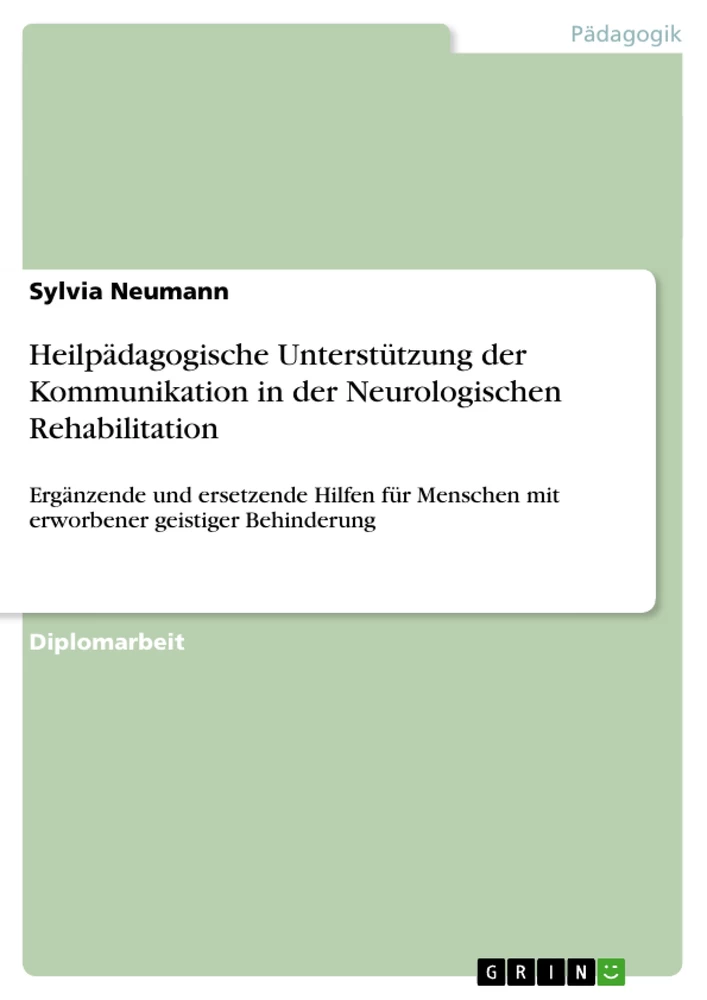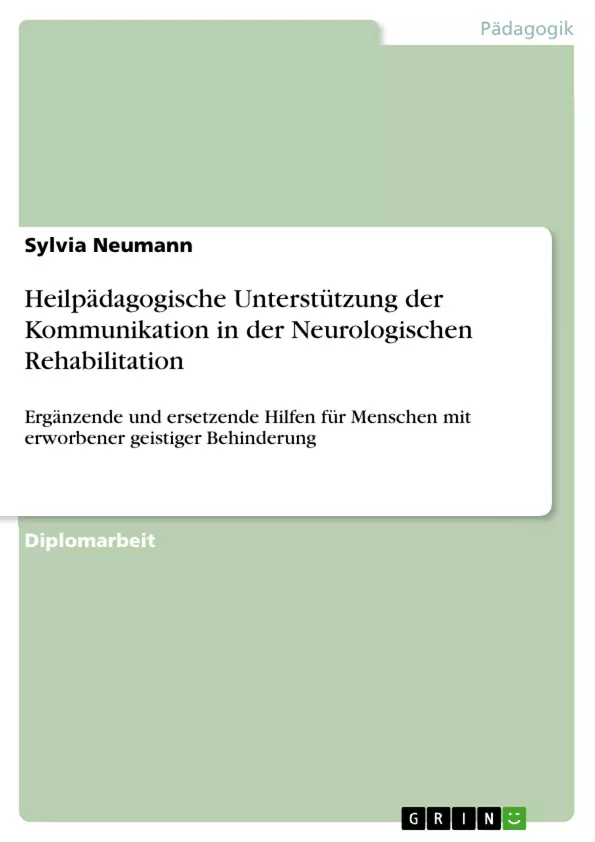Die Unterstützung der Kommunikation ist in der Neurologischen Rehabilitation vor allem ein Thema der Sprachtherapie. Hierzu finden sich vielfältige funktionstherapeutische Ansätze. Im Gegensatz dazu werden die unterstützenden und ergänzenden Methoden für den klinischen Bereich in der Literatur nur selten beachtet und für Menschen mit kognitiven Einschränkungen ergeben sich nahezu keine Hinweise. Mit dieser Arbeit soll deshalb geklärt werden, inwieweit unterstützende und ergänzende Kommunikationssysteme aus der Heilpädagogik auch auf Menschen mit ‚erworbenen geistigen Behinderungen’ in der Neurologischen Rehabilitation übertragen werden können.
Es zeigt sich, dass Kommunikationsförderung gerade bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen keinesfalls vernachlässigt werden darf. Für jeden, auch für Menschen mit erworbenen geistigen Behinderungen, kann durch die vielfältigen Methoden der AAC ein individuelles Kommunikationssystem entwickelt werden. Durch eine symptomorientierte Herangehensweise und Meinungen aus der Praxis wurde deutlich, dass dem Gesprächspartner hierbei eine herausragende Rolle zukommt. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Kooperation mit Angehörigen und eine kommunikationsfördernde Gestaltung der Umgebung sind weitere wichtige Aspekte. Sinnvoll könnte es ebenfalls sein, vor allem statische Zeichen und Symbole sowie Gebärden einzusetzen, welche einer langsameren Informationsverarbeitung bei geistiger Behinderung entgegenkommen. Die Ergebnisse können jedoch nie pauschal auf alle Menschen mit erworbenen geistigen Behinderungen angewandt werden, da die Störungsbilder sehr komplex und individuell sind. Sie können nur Anstöße geben für eine kommunikative Begegnung mit dem Anderen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemlage, Fragestellung und Aufbau der Arbeit
- Vorgehensweise und Methode
- Zur Bedeutung der Kommunikation
- Begriffsklärung und Theorien der Kommunikation
- Zur Bedeutung der Kommunikation für den Menschen
- Menschen mit erworbener geistiger Behinderung in der Neurologischen Rehabilitation
- Neurologische Rehabilitation
- Erworbene geistige Behinderung
- Erworbene geistige Behinderung in Abgrenzung zur angeborenen geistigen Behinderung
- Besondere Problemstellungen dieser Personengruppe
- Kognitive Defizite
- Gedächtnisstörungen
- Störungen der Aufmerksamkeit
- Wahrnehmungsstörungen
- Störungen der Exekutivfunktionen
- Weitere Störungen kognitiver Funktionen
- Denken
- Sprach- und Sprechstörungen
- Aphasien
- Dysarthrie/Dysarthrophonie
- Sprechapraxie
- Körperliche Beeinträchtigungen
- Psychische Beeinträchtigungen
- Zusammenfassende Betrachtung
- Heilpädagogische Unterstützung der Kommunikation
- Augmentative and Alternative Communication (AAC)
- Ziel und Zielgruppe
- Multimodales Kommunikationssystem
- Besonderheiten der Gesprächssituation
- Methoden der AAC
- Zeichen und Symbolsysteme
- Kommunikationsformen
- Körpereigene Kommunikationsformen
- Externe Kommunikationshilfen
- Techniken
- Kommunikationsstrategien
- Derzeitige Rolle der AAC in der neurologischen Rehabilitation
- AAC bei Menschen mit erworbenen geistigen Behinderungen
- Allgemeine Aspekte des AAC-Einsatzes bei Menschen mit erworbenen Beeinträchtigungen in der neurologischen Rehabilitation
- Umgang mit dem Betroffenen
- Hilfsmittel
- Weiteres Umfeld
- Schlussfolgerungen zum AAC-Einsatz bei Menschen mit erworbenen geistigen Behinderungen
- AAC bei Gedächtnisstörungen
- AAC bei Störungen der Aufmerksamkeit
- AAC bei Wahrnehmungsstörungen
- AAC bei Störungen der Exekutivfunktionen
- AAC bei weitere kognitive Störungsbildern
- Zusammenfassende Betrachtung
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der heilpädagogischen Unterstützung der Kommunikation bei Menschen mit erworbener geistiger Behinderung in der neurologischen Rehabilitation. Ziel der Arbeit ist es, die Herausforderungen der Kommunikation bei dieser Personengruppe aufzuzeigen und die Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation (AAC) im Rahmen der heilpädagogischen Arbeit zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den kognitiven Beeinträchtigungen, die durch einen Hirnschaden entstehen können, und den damit verbundenen Schwierigkeiten in der Kommunikation.
- Herausforderungen der Kommunikation bei Menschen mit erworbener geistiger Behinderung
- Die Rolle der Unterstützten Kommunikation (AAC) in der neurologischen Rehabilitation
- Kognitive Beeinträchtigungen nach Hirnschädigung und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation
- Methoden der AAC im Kontext der heilpädagogischen Unterstützung
- Der Einsatz von AAC bei verschiedenen kognitiven Störungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Kommunikation und ihrer Bedeutung für den Menschen. Anschließend werden die Besonderheiten der neurologischen Rehabilitation und der erworbenen geistigen Behinderung erläutert. Im Fokus steht dabei die Darstellung der kognitiven Beeinträchtigungen, die durch einen Hirnschaden entstehen können. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen auf die Kommunikation und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für Betroffene und deren Umfeld ergeben. Im weiteren Verlauf werden die Konzepte und Methoden der Augmentativen und Alternativen Kommunikation (AAC) vorgestellt, die eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Kommunikation bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen spielen. Die Arbeit zeigt verschiedene Ansätze und Techniken der AAC auf und betrachtet deren Anwendung in der neurologischen Rehabilitation. Abschließend wird der Einsatz von AAC bei Menschen mit erworbenen geistigen Behinderungen im Detail beleuchtet und die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Unterstützte Kommunikation (AAC), neurologische Rehabilitation, erworbene geistige Behinderung, kognitive Beeinträchtigungen, Kommunikationsschwierigkeiten, Aphasie, Dysarthrie, Sprechapraxie, Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsprobleme, Wahrnehmungsstörungen, Exekutivfunktionen, Heilpädagogik.
- Quote paper
- Sylvia Neumann (Author), 2007, Heilpädagogische Unterstützung der Kommunikation in der Neurologischen Rehabilitation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141523