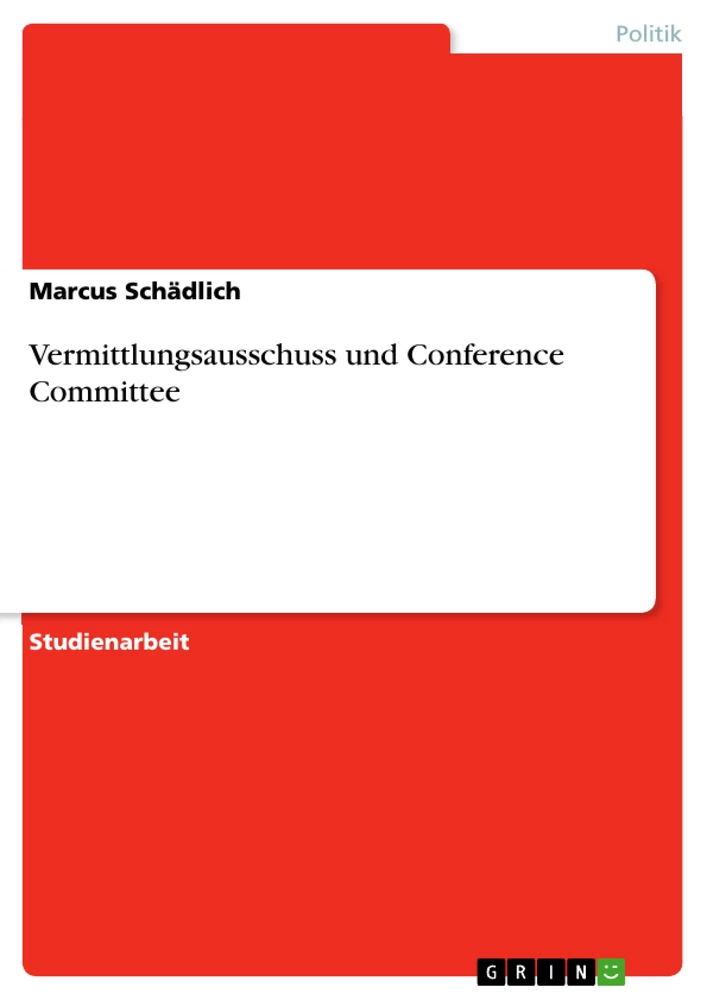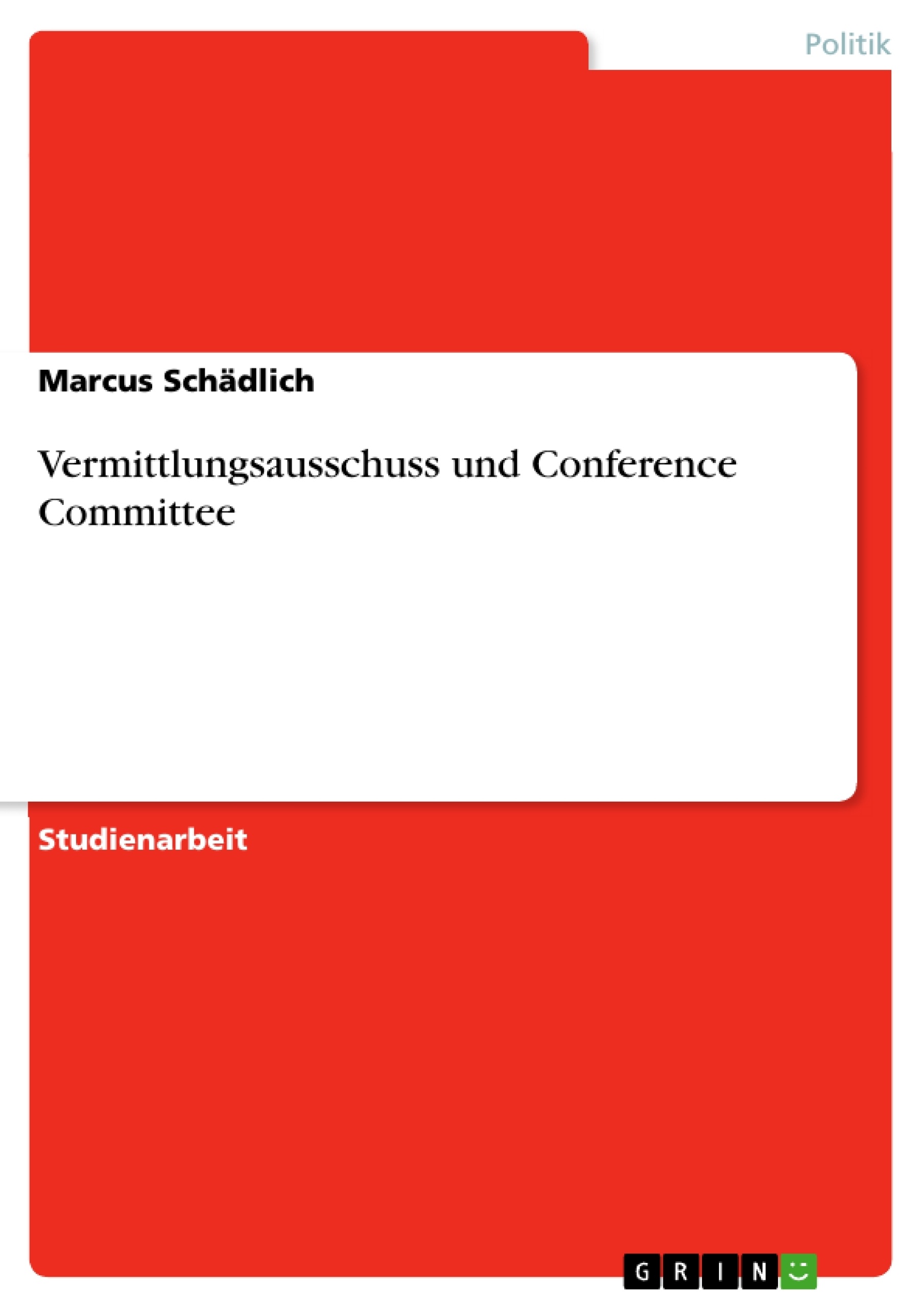Im November und Dezember des Jahres 2003 war die gesamte politische Szene der Bundesrepublik Deutschland in Aufruhr. Für die Regierung Schröder galt es im Vermittlungsausschuss einen Kompromiss über Teile der Hartz-Gesetzgebung und die damalige Steuerreform zusammen mit der CDU/CSU und der FDP zu finden. Knapp fünf Jahre zuvor – nach der Landtagswahl in Hessen im Januar 1999 – hatte die rot-grüne Regierung die Mehrheit im Bundesrat verloren und war seitdem auch auf die Zustimmung von CDU/CSU-regierten Bundesländern im Bundesrat angewiesen.
Auch in den Zeitungen ging es damals heiß her: Vom Umzug der Macht war in der ZEIT die Rede und DIE WELT betitelte den Vermittlungsausschuss als „große Kungelrunde“. Während die Presse dem Verfahren mehrheitlich skeptisch gegenüberstand und –steht, gibt es nicht wenige Politiker, die den Vermittlungsausschuss schätzen. So gestand Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Wolfgang Böhmer (CDU), dass ihm die „Politik nirgends so viel Freude [macht] wie im Vermittlungsausschuss.“ Dennoch ließ sich die Große Koalition in der aktuell verabschiedeten Föderalismusreform nicht nehmen, durch klarere Zuständigkeiten zwischen Bund und den Ländern ein Vermittlungsverfahren in Zukunft unwahrscheinlicher zu machen. Da auch dieses Reformwerk in der Öffentlichkeit auf kein positives Echo stieß, stellt sich die Frage, wie das Vermittlungsverfahren grundsätzlich geplant war. Wie ist das Vorgang im Vergleich dazu in den USA geregelt? Und hätten nicht eventuelle Vorteile übernommen werden können? Diese Fragen sollen in der folgenden Arbeit analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Forschungsstand
- Aufbau
- Historische Entwicklung
- Bundesrepublik Deutschland
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Vergleich
- Ausformung
- Fragen der Mitgliedschaft
- Fragen der Vertraulichkeit
- Rolle der Exekutive
- Vermittlungsverfahren
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich des deutschen Vermittlungsausschusses und des amerikanischen Conference Committee. Ziel ist es, die historische Entwicklung, die Ausformung und die Funktionsweise beider Institutionen zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung des Vermittlungsausschusses in Deutschland und des Conference Committee in den USA
- Vergleich der Ausformung und Funktionsweise beider Institutionen
- Analyse der Rolle der Exekutive im Vermittlungsverfahren
- Bewertung der Übertragbarkeit von Elementen des amerikanischen Systems auf das deutsche System
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar, beleuchtet den Forschungsstand und skizziert den Aufbau. Im Kapitel "Historische Entwicklung" wird die Entstehung des Vermittlungsausschusses in der Bundesrepublik Deutschland und des Conference Committee in den Vereinigten Staaten von Amerika beleuchtet. Dabei wird die Bedeutung des Chiemseer Entwurfs für die deutsche Ausformung des Vermittlungsausschusses hervorgehoben.
Das Kapitel "Vergleich" analysiert die Ausformung, die Mitgliedschaft, die Vertraulichkeit, die Rolle der Exekutive und das Vermittlungsverfahren beider Institutionen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt und die jeweiligen Stärken und Schwächen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Vermittlungsausschuss, das Conference Committee, die Bundesrepublik Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Gesetzgebung, die Föderalismusreform, die Exekutive, die Legislative, die Politikwissenschaft, die vergleichende Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der deutsche Vermittlungsausschuss?
Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium des Deutschen Bundestages und des Bundesrates, das dazu dient, bei Unstimmigkeiten in der Gesetzgebung einen Konsens zwischen den beiden Verfassungsorganen zu finden.
Wie unterscheidet sich der Vermittlungsausschuss vom US Conference Committee?
Die Arbeit vergleicht beide Institutionen hinsichtlich ihrer historischen Entwicklung, Mitgliedschaft, Vertraulichkeit und der Rolle der Exekutive im Gesetzgebungsprozess.
Welche Rolle spielte der Vermittlungsausschuss bei der Hartz-Gesetzgebung?
Ende 2003 war der Ausschuss entscheidend für die Findung eines Kompromisses zwischen der Regierung Schröder und der Opposition (CDU/CSU, FDP) bezüglich der Hartz-Reformen und der Steuerreform.
Was war der Chiemseer Entwurf?
Der Chiemseer Entwurf war ein bedeutendes historisches Dokument, das die Ausformung und Struktur des deutschen Vermittlungsausschusses maßgeblich beeinflusst hat.
Warum wurde das Vermittlungsverfahren durch die Föderalismusreform seltener?
Durch klarere Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern zielte die Reform darauf ab, die Notwendigkeit von Vermittlungsverfahren zu reduzieren und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.
Ist die Arbeit des Vermittlungsausschusses öffentlich?
Die Vertraulichkeit der Sitzungen ist ein zentraler Aspekt des Ausschusses, um politische Kompromisse abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Marcus Schädlich (Autor), 2009, Vermittlungsausschuss und Conference Committee, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141580