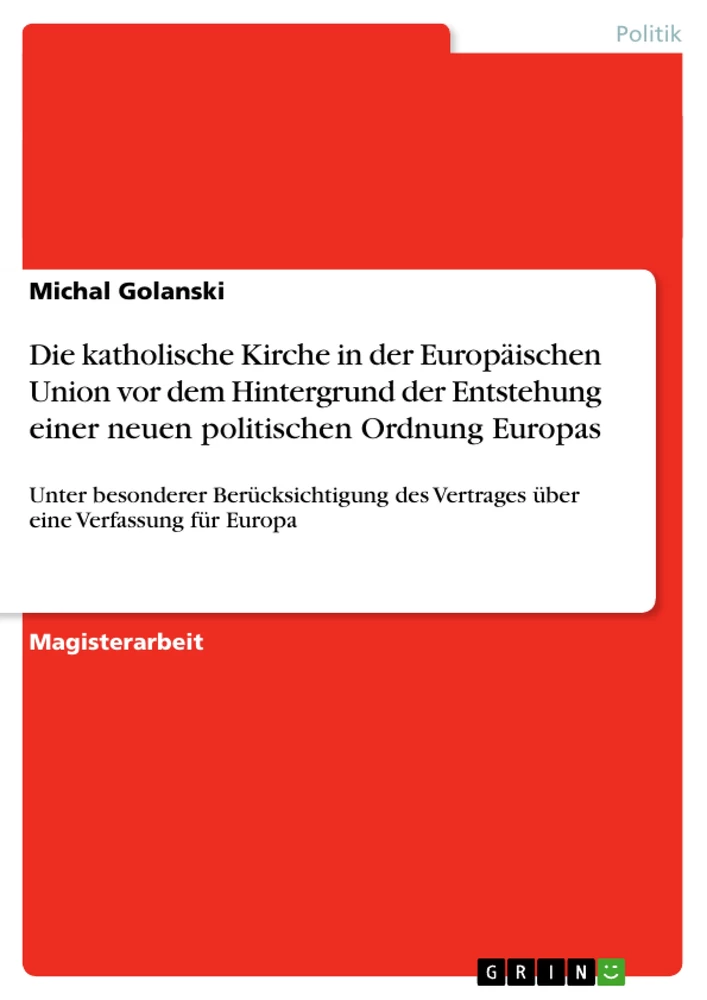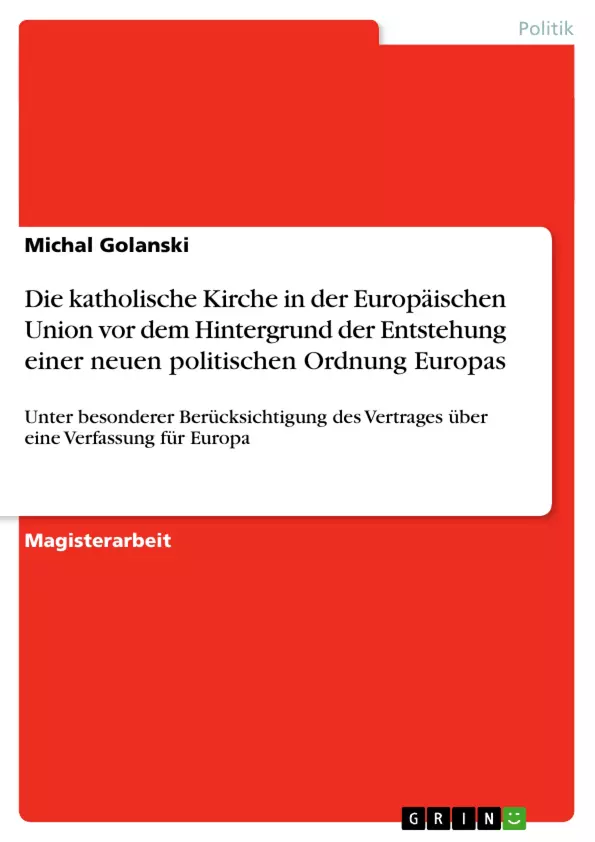Die Europäische Union wird politisch - insbesondere seitdem sich ihre Grundlagen in der Verfassung (der Vertrag über eine Verfassung für Europa und nach seinem Scheitern der Vertrag von Lissabon)verdichteten. Dies ebnet den Weg zu einer Konfrontation zwischen der Politik und der Religion, die wir seit der Antike kennen; allerdings findet sie heutzutage auf einer neuen, über die Staatsgrenzen hinausgehenden Ebene statt, nämlich im gemeinsamen politisch verfassten Europa. Kontroversen um die Konventsarbeiten haben dies mit aller Deutlichkeit gezeigt, zumal es beispielsweise heftig um den Gottesbezug in der EU-Verfassung gestritten wurde. Was heißt es für die christliche Religion und vor allem für den Katholizismus in Europa, welche Wege soll die europäische Politik einschlagen? Angesichts der gesellschaftlichen und kulturellen Wirklichkeit Europas von heute scheinen sowohl für die Politik als auch die Religion bewährte Lösungen, Handlungsmuster und modi vivendi nicht mehr standhaft zu sein. So wie zu den Zeiten des europäischen Konstitutionalismus des ausgehenden XVIII. und anfangenden XIX. Jahrhunderts ist auch heute, unter neuen Umständen, die Suche nach einer tragfähigen Ausgestaltung des Verhältnisses Politik-Religion angebracht. Es wird in dem Aufsatz versucht, entsprechende Entwicklungstendenzen am Beispiel der Debatte um die EU-Verfassung aufzuspüren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: Problemstellung und Überblick
- 2. Die europäische Integration und der Heilige Stuhl vor dem Hintergrund seiner Stellung als Akteur des internationalen Systems
- 3. Die europäische Integration und der Heilige Stuhl: Besonderheiten der gegenseitigen Wahrnehmung
- 3.1. Zwischenergebnis: strukturierte Verhältnisse in statu nascendi
- 4. Der Bedarf an kohärenten, religionspolitischen Entscheidungen vor dem Hintergrund des geltenden Europarechts?
- 5. Gegenwärtige Herausforderungen für die Verhältnisse Staat-Kirche: Prämissen einer „europäischen Religionspolitik“
- 6. Die Herausbildung einer politischen Ordnung Europas im Lichte der EU-Konstitutionalisierungsthese – Aussichten für die europäische Religionsrezeption
- 6.1. Konturen der EU-Konstitutionalisierungsthese
- 6.2. Perspektiven für die politische Ordnung Europas nach der Konstitutionalisierungsthese
- 7. Die katholische Kirche und der Vertrag über eine Verfassung für Europa
- 7.1. Die Stimme der Kirchen in der Verfassungsdebatte
- 7.2. Die Präsenz von Religion und Kirche in der EU-Verfassung
- 7.2.1. Aufwertung der kirchlichen Interessen in institutioneller Hinsicht und Rezeption der religiösen Dimension im Allgemeinen
- 7.2.2. Die Religionsrezeption als Werterahmen in dem Verfassungsvertrag im Zusammenhang mit der Frage der „europäischen Identität“
- 7.2.2.1. Exkurs: Identität als Prämisse einer demokratischen Ordnung und ihre Bedeutung für die politische Gemeinschaft Europas
- 7.2.2.2. Wertefundus und Identität im VVE - der Aufruf der katholischen Kirche zur europäischen Rezeption des Christentums
- 7.2.2.3. Die christliche Identität im gegenwärtigen Kontext der Säkularisierung und der religiösen Pluralität – Schlussfolgerungen für ein politisch verfasstes Europa
- 8. Fazit: zwischen dem modernen Staat und der Gegenwart Europas - Aussichten für die katholische Kirche
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Positionierung der katholischen Kirche im Kontext der europäischen Integration. Sie analysiert die wechselseitigen Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der Europäischen Union vor dem Hintergrund der Herausforderungen der europäischen Integration und der sich entwickelnden politischen Ordnung Europas. Die Arbeit untersucht insbesondere die Rolle der katholischen Kirche in der Verfassungsdebatte um den Vertrag über eine Verfassung für Europa und die Rezeption der religiösen Dimension in der europäischen Identität.
- Die Rolle der katholischen Kirche als Akteur im internationalen System
- Die Herausforderungen der europäischen Integration für die katholische Kirche
- Die Rezeption der religiösen Dimension in der europäischen Identität
- Die Bedeutung der christlichen Tradition für die politische Ordnung Europas
- Die Präsenz von Religion und Kirche in der EU-Verfassung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Problemstellung und den Überblick über die Thematik der Arbeit darstellt. Im zweiten Kapitel wird die europäische Integration und die Positionierung des Heiligen Stuhls als Akteur des internationalen Systems beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten der gegenseitigen Wahrnehmung zwischen der europäischen Integration und dem Heiligen Stuhl. Das vierte Kapitel untersucht den Bedarf an kohärenten, religionspolitischen Entscheidungen vor dem Hintergrund des geltenden Europarechts. Das fünfte Kapitel analysiert die gegenwärtigen Herausforderungen für die Verhältnisse Staat-Kirche und die Prämissen einer „europäischen Religionspolitik“. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Herausbildung einer politischen Ordnung Europas im Lichte der EU-Konstitutionalisierungsthese und den Aussichten für die europäische Religionsrezeption. Das siebte Kapitel untersucht die katholische Kirche und den Vertrag über eine Verfassung für Europa, insbesondere die Stimme der Kirchen in der Verfassungsdebatte und die Präsenz von Religion und Kirche in der EU-Verfassung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die katholische Kirche, die Europäische Union, die europäische Integration, die politische Ordnung Europas, die EU-Verfassung, die Religionsrezeption, die europäische Identität, die Säkularisierung, die Religionsfreiheit, die Staatskirchen, die politische Theologie, die politische Religion und die Zivilreligion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die katholische Kirche in der EU-Politik?
Die katholische Kirche tritt als Akteur im internationalen System auf und versucht, christliche Werte und Identität in den europäischen Integrationsprozess einzubringen.
Warum gab es Streit um den Gottesbezug in der EU-Verfassung?
Der Streit entzündete sich an der Frage der europäischen Identität: Während Kirchen einen expliziten Bezug auf Gott oder christliche Wurzeln forderten, plädierten andere für eine strikte religiöse Neutralität.
Was bedeutet "Säkularisierung" im europäischen Kontext?
Säkularisierung beschreibt den Prozess, in dem Religion an gesellschaftlicher und politischer Bedeutung verliert, was das traditionelle Verhältnis zwischen Staat und Kirche herausfordert.
Wie positioniert sich der Heilige Stuhl zur EU-Integration?
Der Heilige Stuhl nimmt eine beobachtende und beratende Rolle ein, wobei er die Integration kritisch-konstruktiv begleitet und die Wahrung religiöser Belange anmahnt.
Was ist die EU-Konstitutionalisierungsthese?
Diese These beschreibt den Prozess, durch den die EU zunehmend eine verfassungsähnliche Ordnung erhält, was neue Rahmenbedingungen für die Religionsrezeption schafft.
- Arbeit zitieren
- Michal Golanski (Autor:in), 2009, Die katholische Kirche in der Europäischen Union vor dem Hintergrund der Entstehung einer neuen politischen Ordnung Europas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141753