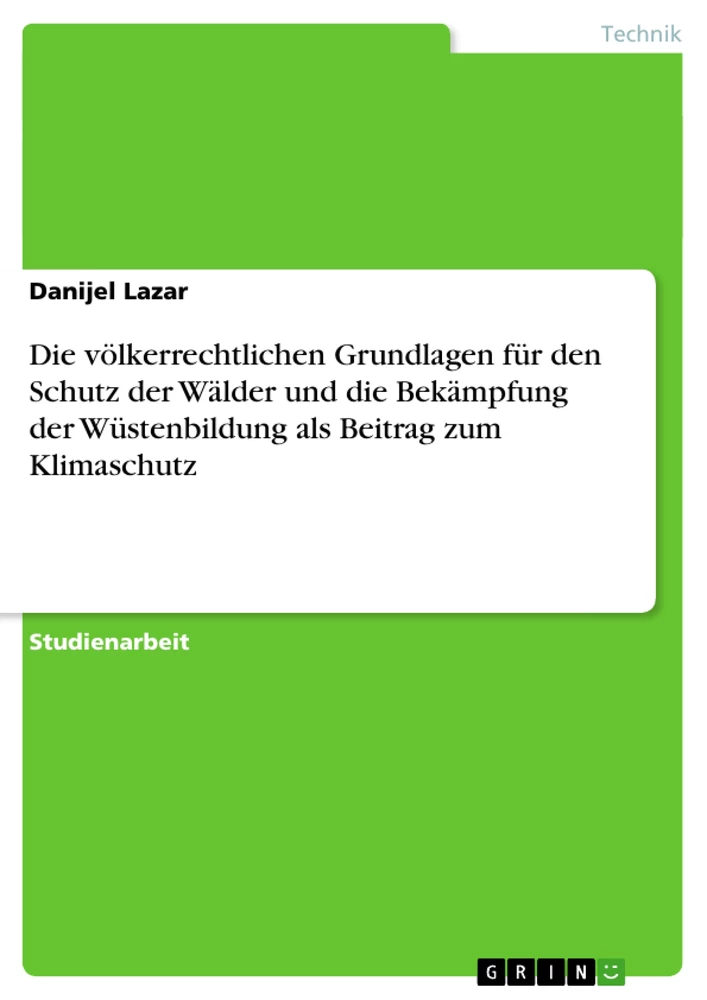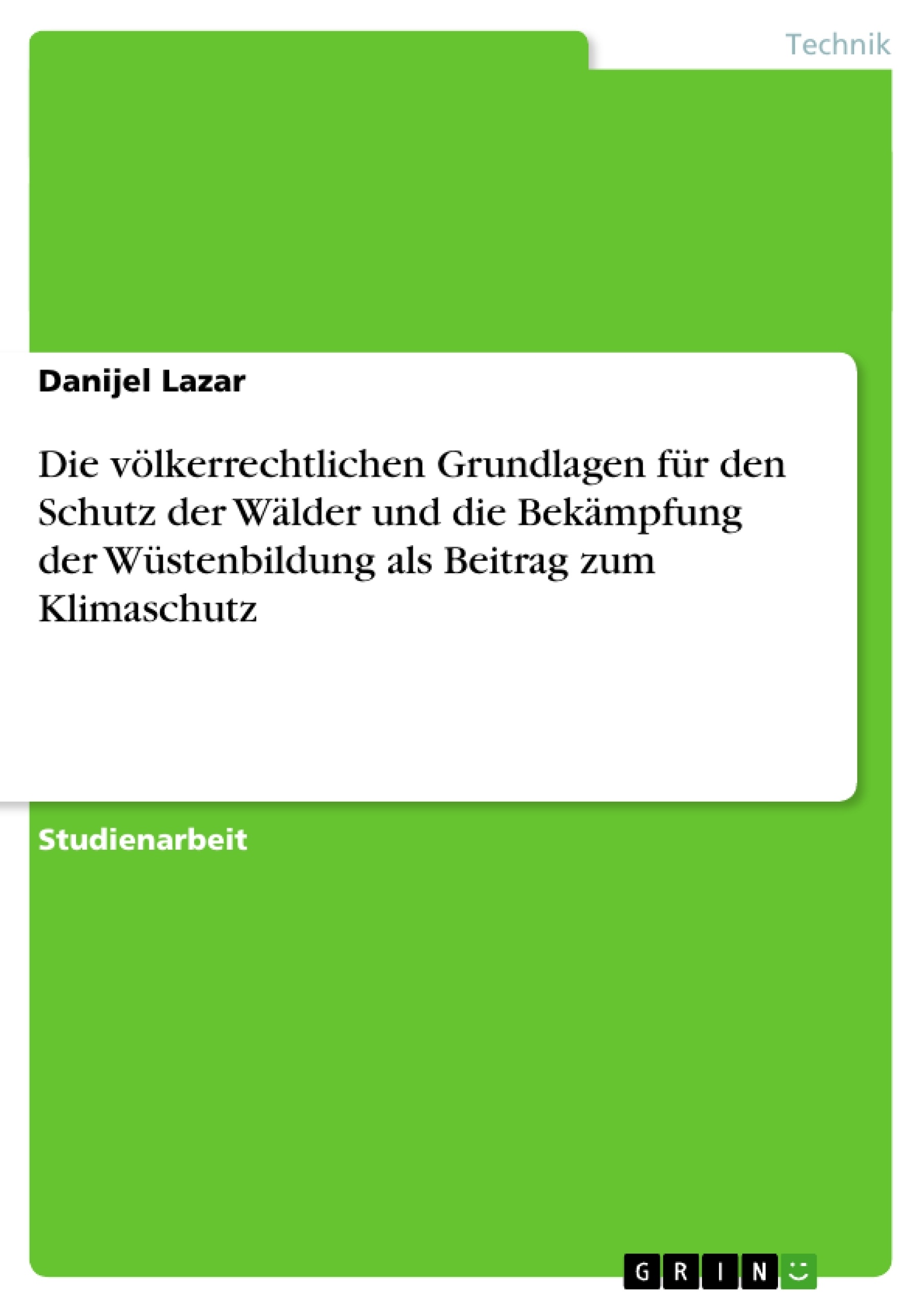Unsere Welt ist bedeckt von beinahe vier Milliarden Hektar Wald, was 30 Prozent der gesamten Landmasse entspricht. Zwischen den Jahren 1990 und 2005 sank die Zahl um 3 %, was einen durchschnittlichen jährlichen Verlust von 0,2 Prozent bedeutet. Laut OECD Prognosen droht bis zum Jahr 2030 ein weiterer Rückgang der Naturwaldflächen von bis zu 13 Prozent. Die Gründe der Entwaldung sind vielschichtig; der Hauptgrund liegt in der wachsenden Weltbevölkerung und der damit verbundenen gestiegenen Nachfrage nach Holz.
Unter Entwaldung versteht man, im Umkehrschluss zur Definition der Aufforstung des IPCC, die durch den Menschen direkt verursachte Veränderung der Nutzung einer Bodenfläche durch Wald zur anderweitigen Nutzung. Wälder sind auf Grund ihrer vielfältigen Funktionen, z.B. für den Schutz der Böden und des Grundwassers, als CO2-Speicher, als Lebensgrundlage oder als erneuerbare Rohstoffquelle ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebensgrundlage der Erde. Auf Grund dessen muss es eines der dringendsten Ziele der globalen Umwelt- und Klimapolitik sein, die Entwaldung zu stoppen und die Wälder wieder aufzuforsten.
Das nachfolgende Kapitel zeigt die völkerrechtlichen Grund-lagen der Staatengemeinschaften gegen die Entwaldung bzw. für den Schutz der Wälder auf. Da es bisher an einem internationalen rechtsverbindlichen Instrument, wie einer Waldkonvention, fehlt, wird lediglich auf die wichtigsten völkerrechtliche Verträge, Beschlüsse und Resolutionen internationaler Organisationen sowie auf regionale Initiativen und Programme eingegangen. Diese werden dabei chronologisch nach ihrem Abschlussdatum dargestellt.
Am 02.02.1971 wurde in Ramsar, Iran, das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung geschlossen. Es stellt das erste internationale Übereinkommen dar, welches bestimmte Ökosysteme auf globaler Ebene schützt. Dies geschieht allerdings nur indirekt durch Art. 1, wonach sich unter den Begriff Feuchtgebiet auch einige Waldökosysteme wie die Mangrovenwälder subsumieren lassen. Aktuell (Stand: Mai 2009) haben 159 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet, wodurch 1847 Feuchtgebiete mit einer Gesamtgröße von ca. 181 Mio. Hektar geschützt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- 1. Teil: Einleitung
- 2. Teil: Der Schutz der Wälder
- A. Begriffsdefinitionen und Gründe der Entwaldung
- B. Völkerrechtliche Grundlagen für den Schutz der Wälder
- I. Die Ramsar-Konvention
- II. Die UNO-Weltkonferenz in Stockholm
- III. Das ASEAN-Abkommen
- IV. Das PP-G7-Vorhaben
- V. Die Rio-Konferenz
- 1. Die Waldgrundsatzerklärung
- 2. Die Agenda 21
- 3. Die Rio-Deklaration
- 4. Die Biodiversitätenkonvention
- 5. Die Klimarahmenkonvention
- 6. Zwischenergebnis
- VI. Das Kyoto-Protokoll
- 3. Teil: Die Bekämpfung der Wüstenbildung
- A. Begriffsdefinitionen und Gründe der Wüstenbildung
- B. Völkerrechtliche Grundlagen für die Bekämpfung der Wüstenbildung
- I. Die United Nations Conference on Desertification in Nairobi
- II. Die Wüstenkonvention
- 4. Teil: Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den völkerrechtlichen Grundlagen für den Schutz der Wälder und die Bekämpfung der Wüstenbildung als Beitrag zum Klimaschutz. Sie analysiert die relevanten internationalen Abkommen und Konventionen, die sich mit diesen Themen befassen, und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Umsetzung dieser völkerrechtlichen Verpflichtungen ergeben.
- Völkerrechtliche Grundlagen für den Schutz der Wälder
- Bedeutung der Wälder für das globale Klima
- Ursachen und Folgen der Entwaldung
- Völkerrechtliche Grundlagen für die Bekämpfung der Wüstenbildung
- Herausforderungen und Chancen der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Klimaschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Klimaschutzes ein und erläutert die Bedeutung der Wälder und der Wüstenbildung für das globale Klima. Sie definiert die relevanten Begriffe und stellt die völkerrechtlichen Grundlagen dar, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit dem Schutz der Wälder. Er analysiert die Ursachen und Folgen der Entwaldung und stellt die wichtigsten völkerrechtlichen Abkommen und Konventionen zum Schutz der Wälder vor. Dabei wird deutlich, dass es an verbindlichen Instrumenten zum Schutz der Wälder mangelt.
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Bekämpfung der Wüstenbildung. Er definiert den Begriff der Wüstenbildung, erläutert die Ursachen und Folgen und stellt die völkerrechtlichen Grundlagen für die Bekämpfung der Wüstenbildung vor. Die Arbeit zeigt, dass die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wüstenbildung nicht ausreichend sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Schutz der Wälder, die Bekämpfung der Wüstenbildung, den Klimaschutz, völkerrechtliche Grundlagen, internationale Abkommen, Konventionen, Entwaldung, Desertifikation, Herausforderungen und Chancen der internationalen Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptgründe für die weltweite Entwaldung?
Der Hauptgrund liegt in der wachsenden Weltbevölkerung und der damit verbundenen gestiegenen Nachfrage nach Holz sowie der Umwandlung von Waldflächen in anderweitig genutzte Flächen.
Warum sind Wälder für den Klimaschutz unverzichtbar?
Wälder fungieren als wichtige CO2-Speicher, schützen die Böden und das Grundwasser und dienen als Lebensgrundlage sowie erneuerbare Rohstoffquelle.
Was ist die Ramsar-Konvention?
Die Ramsar-Konvention von 1971 ist das erste internationale Übereinkommen zum Schutz bestimmter Ökosysteme, primär Feuchtgebiete, die indirekt auch Waldökosysteme wie Mangrovenwälder schützen.
Gibt es ein rechtsverbindliches internationales Waldgesetz?
Bisher fehlt ein umfassendes international rechtsverbindliches Instrument wie eine Waldkonvention; der Schutz basiert auf verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen, Resolutionen und regionalen Initiativen.
Was versteht man unter dem Begriff Entwaldung laut IPCC?
Entwaldung ist die durch den Menschen direkt verursachte Veränderung der Nutzung einer Bodenfläche von Wald zu einer anderweitigen Nutzung.
Welche Rolle spielt das Kyoto-Protokoll beim Waldschutz?
Das Kyoto-Protokoll wird als eine der völkerrechtlichen Grundlagen herangezogen, um den Erhalt von Wäldern als Beitrag zur Emissionsreduktion zu regeln.
- Arbeit zitieren
- Danijel Lazar (Autor:in), 2009, Die völkerrechtlichen Grundlagen für den Schutz der Wälder und die Bekämpfung der Wüstenbildung als Beitrag zum Klimaschutz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141766