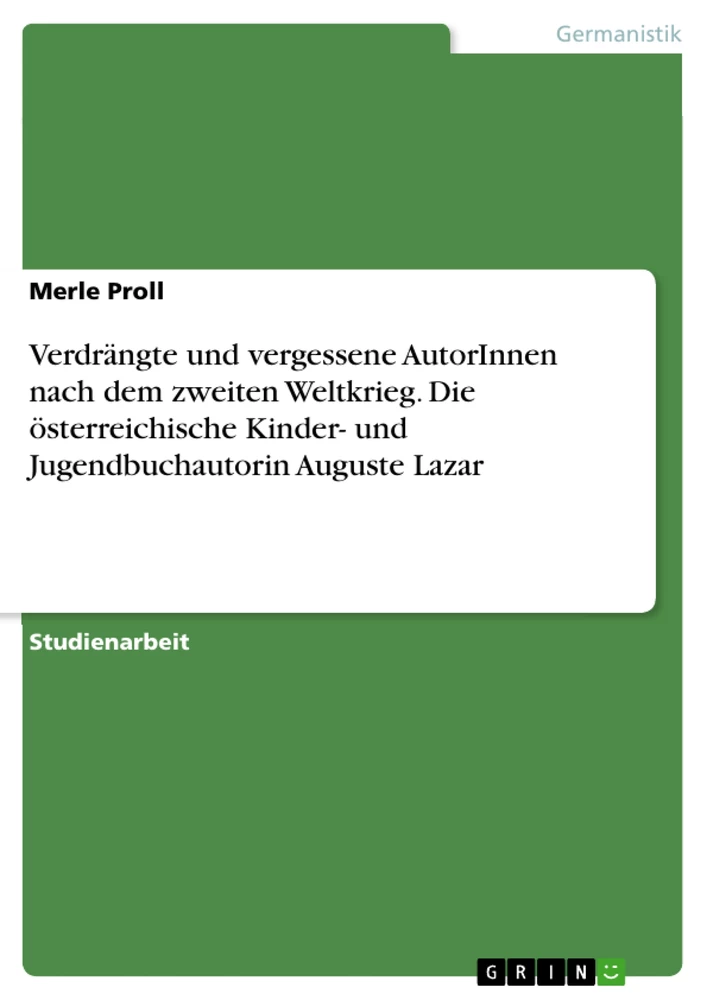Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, warum diverse Autor*innen, die während des zweiten Weltkrieges verboten waren, nach dem Krieg einfach verdrängt und vergessen wurden. Dabei dient Auguste Lazar, eine österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin, mit zwei ihrer Bücher "Sally Bleistift in Amerika" und "Jan auf der Zille" als Beispiel. Durch Lazar wird auch der feministische Blick geschärft, da auffällig ist, dass hauptsächlich Autorinnen aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis verbannt wurden.
Unter anderen als Antwort auf die deutsche Propaganda gingen viele Autorinnen und Autoren mit ihrer Kinder- und Jugendliteratur in den Widerstand und versuchten so, eine Sinnesänderung bei der Bevölkerung während des zweiten Weltkrieges zu bewirken. Viele schrieben dabei im Exil, einige sogar aus Deutschland oder Österreich heraus. Neben den vermittelten wichtigen Inhalten und dem Mut, den es zur aktiven Veröffentlichung erfordert, ist auch die hohe literarische Qualität zu betonen. Trotz dieser Leistungen sind ihre Namen und Werke auf dem Weg zur Gegenwart verloren gegangen. Ich versuche im Folgenden einige Aspekte zu beleuchten, die zum Vergessen dieser SchriftstellerInnen und ihrer Werke geführt haben könnten und eine hypothetische Antwort darauf zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Erklärung der Forschungsfrage - Einleitung
- 2. Literaturverhältnisse im zweiten Weltkrieg
- 2.1 Schreiben in Deutschland
- 2.2 Schreiben im Exil
- 3. Frau und Schriftstellerin
- 4. Kinder- und Jugendliteratur im zweiten Weltkrieg
- 5. Kinder- und Jugendliteratur nach dem zweiten Weltkrieg
- 4.1 DDR
- 4.2 BRD
- 4.3 Österreich
- 5. Auguste Lazar
- 6. Beantwortung der Forschungsfrage
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für das Vergessen verbotener Autor*innen nach dem Zweiten Weltkrieg, am Beispiel der österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin Auguste Lazar. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die zur Verdrängung und zum Verschwinden dieser Schriftsteller*innen und ihrer Werke aus dem kulturellen Gedächtnis beigetragen haben.
- Die Literaturlandschaft im Zweiten Weltkrieg und die Auswirkungen der NS-Diktatur auf Schriftsteller*innen.
- Das Schreiben im Exil und die Herausforderungen für Autor*innen, die vor dem NS-Regime flohen.
- Der Einfluss von Gender auf die Wahrnehmung und den Erfolg von Schriftsteller*innen.
- Die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur während und nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, DDR).
- Das Werk und der Einfluss von Auguste Lazar auf die Kinder- und Jugendliteratur.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Erklärung der Forschungsfrage - Einleitung: Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein: Warum wurden verbotene Autor*innen nach dem Zweiten Weltkrieg verdrängt und vergessen? Sie verwendet ein Zitat von Auguste Lazar, um die Komplexität des Schreibens unter schwierigen Umständen zu verdeutlichen und die Motivation hinter dem Widerstand vieler Autor*innen gegen die NS-Propaganda hervorzuheben. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit, die Leistungen dieser Autor*innen zu würdigen und die Gründe für ihr Verschwinden aus dem öffentlichen Bewusstsein zu untersuchen.
2. Literaturverhältnisse im zweiten Weltkrieg: Dieses Kapitel analysiert die tiefgreifenden Veränderungen in der deutschen Literaturlandschaft unter dem NS-Regime. Es beschreibt die "Säuberung" von Bibliotheken und Buchhandlungen, die Bücherverbrennungen und die Errichtung der Reichsschrifttumskammer. Der Fokus liegt auf der Unterdrückung von Autor*innen, die sich dem Regime widersetzten, sowohl durch aktive Verweigerung als auch durch passive "innere Emigration". Das Kapitel beleuchtet auch die Bedingungen, unter denen Schriftsteller*innen im Dienst der NS-Propaganda arbeiteten, und die unterschiedlichen Reaktionen von Autor*innen auf den Druck des Regimes.
2.1 Schreiben in Deutschland: Dieser Abschnitt beschreibt die Repressionen und Zensurmaßnahmen des NS-Regimes gegenüber Schriftsteller*innen in Deutschland. Er erläutert die Folgen der Gleichschaltung und die Einrichtung der Reichsschrifttumskammer, die die Kontrolle über die Literatur übernahm. Es wird der Widerstand von Autor*innen, sowohl aktiv als auch passiv ("innere Emigration"), detailliert dargestellt, einschließlich der Herausforderungen, unter denen sie arbeiteten und der unterschiedlichen Strategien, die sie anwendeten.
2.2 Schreiben im Exil: Dieses Kapitel beschreibt die Erfahrungen von Autor*innen im Exil. Es beleuchtet die Gründe für die Emigration (Berufsverbote, Zensur, Bedrohung) und den Prozess der Emigration, besonders um 1939-1940. Es wird der Beitrag der Exilautor*innen zum Widerstand gegen das NS-Regime betont, einschließlich ihrer Versuche, die heimische Bevölkerung aufzuklären und vor dem Regime zu warnen. Der Abschnitt beleuchtet die materiellen und psychischen Schwierigkeiten der Exilautor*innen und die Auswirkungen des Exils auf ihr Schreiben.
3. Frau und Schriftstellerin: Dieser Abschnitt analysiert die besonderen Herausforderungen, denen Frauen als Schriftstellerinnen während und nach dem Zweiten Weltkrieg begegneten. Es wird die Überlagerung von Geschlechterrollen und den Anforderungen des politischen Umfelds untersucht.
4. Kinder- und Jugendliteratur im zweiten Weltkrieg: Dieses Kapitel untersucht die Kinder- und Jugendliteratur während des Zweiten Weltkriegs. Es beleuchtet die Rolle der Literatur in der NS-Propaganda und den Versuch einiger Autor*innen, durch ihre Werke dem entgegenzuwirken.
5. Kinder- und Jugendliteratur nach dem zweiten Weltkrieg: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, BRD und Österreich, wobei der Fokus auf den unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Kontexten und deren Einfluss auf die Literatur liegt.
5. Auguste Lazar: Dieses Kapitel widmet sich der Biographie und dem Werk von Auguste Lazar. Es analysiert ihre literarischen Beiträge, ihren Schreibstil und ihre Position innerhalb der Kinder- und Jugendliteratur, sowie die Gründe, warum ihr Werk möglicherweise vergessen wurde.
Schlüsselwörter
Verbotene Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, Österreich, Zweiter Weltkrieg, NS-Regime, Exil, Widerstand, Auguste Lazar, Vergessen, Verdrängung, Frauen in der Literatur, Propaganda.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über verbotene Autor*innen nach dem Zweiten Weltkrieg
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gründe für das Vergessen verbotener Autor*innen nach dem Zweiten Weltkrieg, am Beispiel der österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin Auguste Lazar. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Faktoren führten zur Verdrängung und zum Verschwinden dieser Schriftsteller*innen und ihrer Werke aus dem kulturellen Gedächtnis?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Themen, darunter die Literaturlandschaft im Zweiten Weltkrieg und die Auswirkungen der NS-Diktatur auf Schriftsteller*innen; das Schreiben im Exil und die Herausforderungen für Autor*innen, die vor dem NS-Regime flohen; den Einfluss von Gender auf die Wahrnehmung und den Erfolg von Schriftsteller*innen; die Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur während und nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Ländern (Deutschland, Österreich, DDR); und das Werk und der Einfluss von Auguste Lazar auf die Kinder- und Jugendliteratur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Erklärung der Forschungsfrage - Einleitung; 2. Literaturverhältnisse im zweiten Weltkrieg (inkl. 2.1 Schreiben in Deutschland und 2.2 Schreiben im Exil); 3. Frau und Schriftstellerin; 4. Kinder- und Jugendliteratur im zweiten Weltkrieg; 5. Kinder- und Jugendliteratur nach dem zweiten Weltkrieg (inkl. 4.1 DDR, 4.2 BRD, 4.3 Österreich); 5. Auguste Lazar; 6. Beantwortung der Forschungsfrage; 7. Fazit.
Wie wird die Forschungsfrage im Laufe der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit beginnt mit der Einführung der Forschungsfrage und einer Einleitung, die die Relevanz des Themas unterstreicht. Die folgenden Kapitel analysieren systematisch die verschiedenen Faktoren, die zum Vergessen von Autor*innen wie Auguste Lazar beitrugen. Dies beinhaltet die Untersuchung der NS-Zeit, des Exils, der Rolle von Frauen in der Literatur und der Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur in verschiedenen Nachkriegsstaaten. Das Kapitel über Auguste Lazar bietet eine detaillierte Fallstudie, um die theoretischen Überlegungen zu veranschaulichen. Schließlich wird im Fazit die Forschungsfrage umfassend beantwortet.
Welche Rolle spielt Auguste Lazar in dieser Arbeit?
Auguste Lazar dient als Fallstudie. Die Arbeit analysiert ihre Biografie, ihr Werk und ihren Einfluss auf die Kinder- und Jugendliteratur, um die generellen Mechanismen des Vergessens verbotener Autor*innen zu veranschaulichen und zu erklären, warum ihr Werk in Vergessenheit geraten ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Verbotene Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, Österreich, Zweiter Weltkrieg, NS-Regime, Exil, Widerstand, Auguste Lazar, Vergessen, Verdrängung, Frauen in der Literatur, Propaganda.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht und zielt auf eine strukturierte und professionelle Analyse der Thematik ab. Sie eignet sich für Studierende, Forschende und alle, die sich für die Geschichte der Literatur, die Auswirkungen des Nationalsozialismus und die Rolle von Frauen in der Literatur interessieren.
- Citar trabajo
- Merle Proll (Autor), 2022, Verdrängte und vergessene AutorInnen nach dem zweiten Weltkrieg. Die österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin Auguste Lazar, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1418296