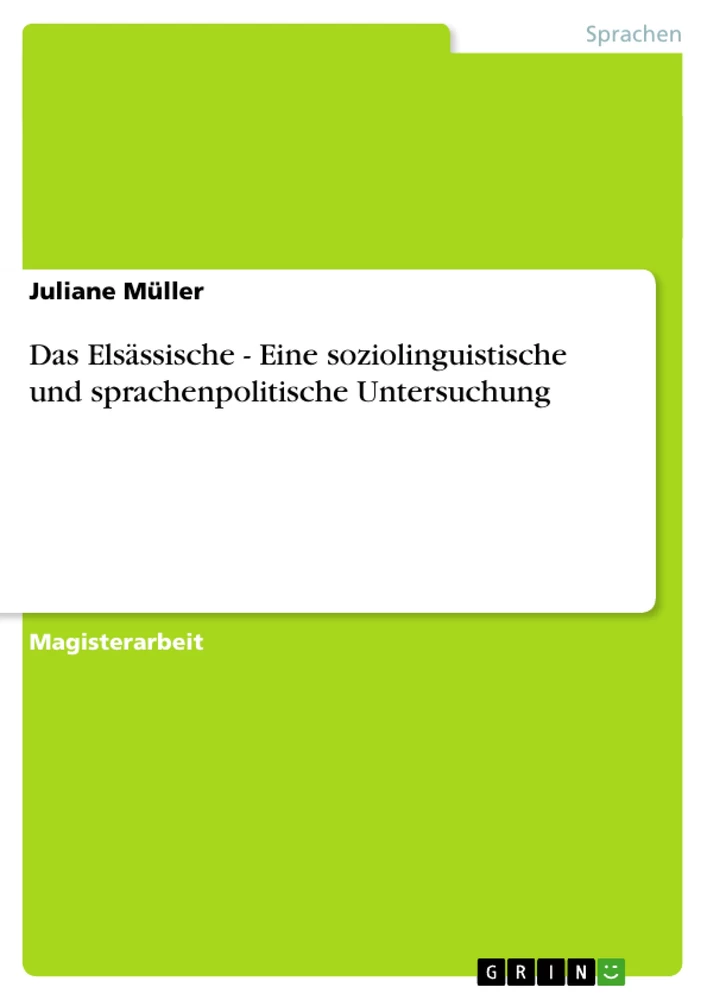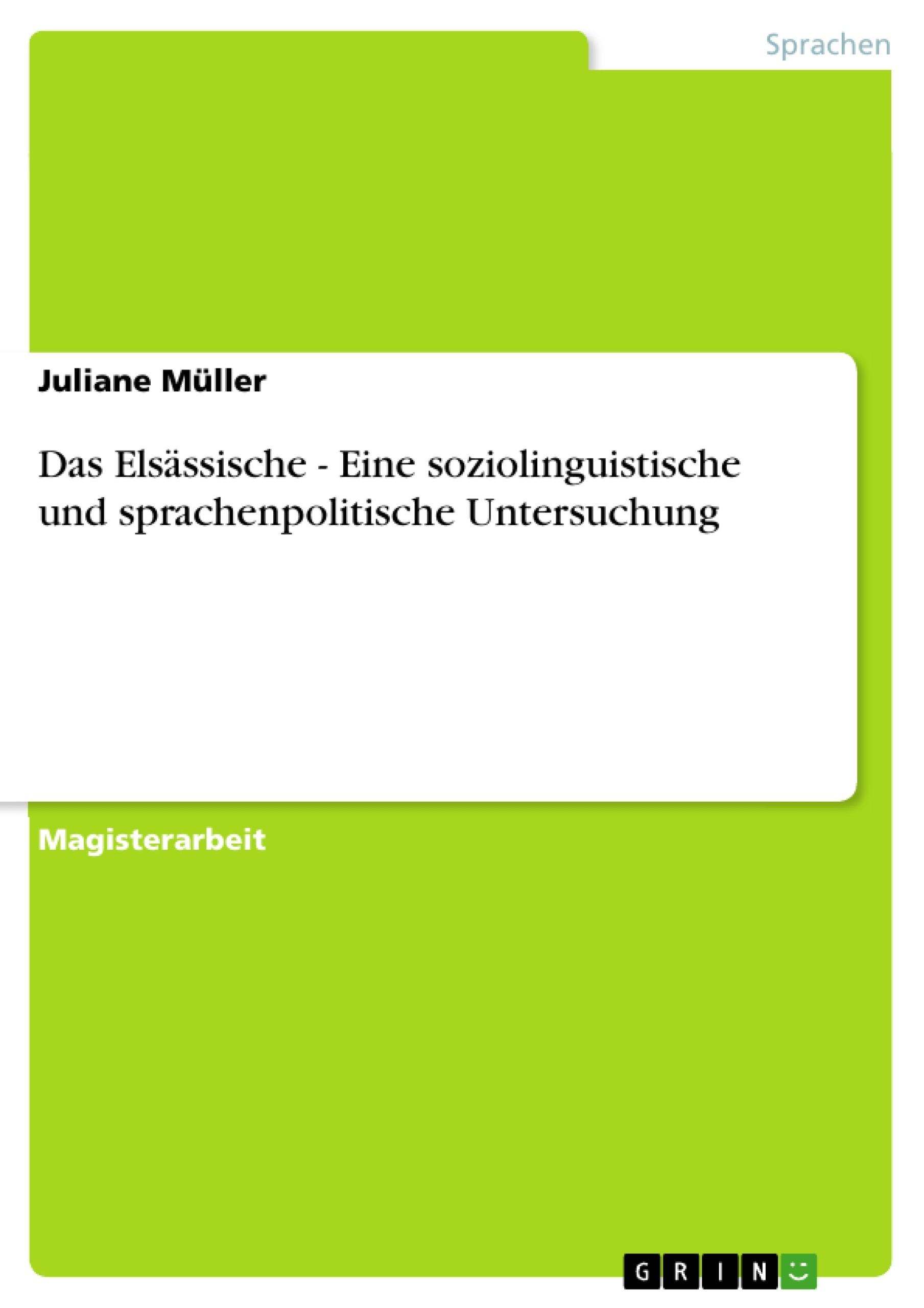Sprache ist in Frankreich schon immer Staatsangelegenheit gewesen. Neben der Nationalsprache Französisch wird innerhalb des Staatsgebiets eine große Anzahl an weiteren Sprachen gesprochen, darunter befinden sich sowohl romanische Sprachen, germanische
Varietäten, eine keltische als auch eine nichtindogermanische Sprache. Dazu kommen einige Kreolsprachen in den Überseegebieten.
Seit 1969 ist besonders in Frankreich die Tendenz zu beobachten, dass die Bevölkerung immer mehr den Wunsch verspürt, ihre Regionalsprachen zu schützen und zu fördern.
Doch die französische Verfassung erkannte erst 2008 den offiziellen Status der Regionalsprachen an. Allerdings nicht im berühmten Artikel 2 „la langue de la république est le français“, sondern in einem neueingeführten Artikel 75, der lautet: „Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.” (Loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008, Article 75-1). Die Regionalsprachen sind der Nationalsprache also
eindeutig untergeordnet und dementsprechend sind sie vom Aussterben bedroht. Empirisch bewiesen ist, dass immer weniger junge Menschen ihre Regionalsprache sprechen und sie zudem immer weniger gut lernen. Außerdem lässt sich eine massive sprachliche
Substitution erkennen. Von diesem Phänomen sind viele mehrsprachige Gebiete betroffen.
Die Sprachwahl der Sprecher hängt von einem komplexen Gefüge aus historischen, politischen, sozialen und kulturellen Variabeln ab und somit kann der Staat durch massive sprach- und sprachenpolitische Maßnahmen sowohl die Sprachwahl als auch das Sprachbewusstsein einer Bevölkerung beeinflussen.
Im Elsass existieren drei Sprach- und Kommunikationssysteme: die französische Nationalsprache, die hochdeutsche Standardsprache und die elsässischen Varietäten. Französisch nimmt bei dieser Konstellation die offizielle Prestigesprache, Hochdeutsch die mehrfach geschriebene und Elsässisch die überwiegend gesprochene Sprache ein.
Dieses Sprachkontinuum lässt sich einerseits durch die geographische Lage und andererseits durch den geschichtlichen Hintergrund erklären. So hat das Elsass beispielsweise vier Mal innerhalb eines dreiviertel Jahrhunderts die Staatsangehörigkeit gewechselt und dabei haben sowohl die deutschen als auch die französischen Staatsherren versucht durch sprachenpolitische Maßnahmen in die Sprachgewohnheiten einzugreifen.
Die Bilanz zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist ernüchternd. Weniger als 40% der erwachsenen Bevölkerung sprechen noch Elsässisch.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Vorbemerkungen
- 2.1 Terminologische Grundlagen
- 2.2 Landeskundliche Grundlagen
- 2.3 Sprachliche Situation und Grundlagen
- 3. Sprachgeschichtliche und -politische Rahmenbedingungen
- 3.1 Vom Mittelalter bis 1789
- 3.2 Sprachenpolitik in der Französischen Revolution
- 3.2.1 Bekämpfung sprachlicher Divergenzen
- 3.2.2 Sprachenpolitik der Jakobiner
- 3.2.3 Auswirkungen der Revolution auf das Elsässische
- 3.3 Sprachenpolitik nach der Französischen Revolution
- 3.3.1 Sprachenpolitische Maßnahmen Frankreichs
- 3.3.2 Sprachenpolitik im Elsass
- 3.4 Sprachenpolitische Maßnahmen von 1945 bis heute
- 3.4.1 Die Situation nach dem Krieg
- 3.4.2 Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit
- 3.4.3 Auswirkungen auf das Elsässische
- 4. Soziolinguistische und sprachenpolitische Untersuchung
- 4.1 Bisheriger Forschungsstand
- 4.2 Funktionen und Einflussfaktoren des Elsässischen
- 4.2.1 Linguistische Einflussfaktoren
- 4.2.2 Sprachkontaktsituation und Multilinguismus
- 4.2.3 Funktion und Einfluss der Medien
- 4.2.4 Funktion und Einfluss der Bildungspolitik
- 4.3 Bestimmungen der Variablen und Durchführung der Untersuchung
- 4.3.1 Der Fragebogen
- 4.3.2 Durchführung der Untersuchung
- 5. Statistische Auswertungen
- 5.1 Sprachkenntnisse
- 5.2 Sprachgebrauch
- 5.2.1 Familie und Freunde
- 5.2.2 Beruf, Öffentlichkeit und Freizeit
- 5.3 Sprachliche Selbsteinschätzung und Bewertung
- 5.4 Sprachenpolitisches Bewusstsein
- 5.5 Lineare Regressionsanalysen
- 5.5.1 Regressionen des Sprachgebrauchs
- 5.5.2 Regressionen der sprachlichen Selbsteinschätzung und Bewertung
- 5.5.3 Regressionen des sprachenpolitischen Bewusstseins
- 5.6 Logarithmische Regressionsanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die soziolinguistische Situation und die sprachpolitischen Rahmenbedingungen des Elsässischen. Ziel ist es, die Entwicklung und den gegenwärtigen Status dieser Sprache zu analysieren und zukünftige Tendenzen aufzuzeigen. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten, die mittels Fragebögen erhoben wurden.
- Sprachgeschichtliche Entwicklung des Elsässischen
- Einfluss der französischen Sprachenpolitik auf das Elsässische
- Soziolinguistische Faktoren, die den Gebrauch des Elsässischen beeinflussen
- Sprachgebrauch in verschiedenen Kontexten (Familie, Beruf, Freizeit)
- Sprachenpolitisches Bewusstsein der Bevölkerung im Elsass
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und umreißt die Forschungsfrage und die Methodik der Untersuchung. Sie begründet die Relevanz der Thematik und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird der Fokus auf die soziolinguistische und sprachenpolitische Situation des Elsässischen gelegt.
2. Allgemeine Vorbemerkungen: Dieses Kapitel legt die terminologischen, landeskundlichen und sprachlichen Grundlagen für die weitere Arbeit fest. Es definiert wichtige Begriffe, beschreibt das geographische Gebiet des Elsass und beleuchtet die vielschichtige sprachliche Situation vor dem Hintergrund des Mehrsprachigkeitskontextes. Dies dient als notwendige Basis für die Analyse der sprachgeschichtlichen und sprachpolitischen Entwicklung.
3. Sprachgeschichtliche und -politische Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel analysiert die sprachpolitische Entwicklung des Elsass von mittelalterlichen Zeiten bis zur Gegenwart. Es beleuchtet die Einflüsse verschiedener politischer Systeme und Regime, insbesondere der Französischen Revolution und der Nachkriegszeit, auf die Stellung des Elsässischen. Der Schwerpunkt liegt auf den Maßnahmen zur Förderung oder Unterdrückung der Sprache und den Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Sprachgemeinschaft. Die Kapitel 3.2 und 3.3 untersuchen explizit verschiedene sprachpolitische Maßnahmen und deren Implikationen für die elsässische Sprache und Identität.
4. Soziolinguistische und sprachenpolitische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es präsentiert den bisherigen Forschungsstand zum Elsässischen und erläutert die ausgewählten Variablen sowie die Durchführung der Studie mit Hilfe von Fragebögen. Die detaillierte Darstellung der Fragebogenkonstruktion und der Erhebungsmethode gewährleistet die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
5. Statistische Auswertungen: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Analyse umfasst Sprachkenntnisse, Sprachgebrauch in verschiedenen Bereichen (Familie, Beruf, Freizeit), sprachliche Selbsteinschätzung und das sprachenpolitische Bewusstsein der Befragten. Mithilfe linearer und logarithmischer Regressionsanalysen werden Zusammenhänge zwischen den Variablen untersucht und die Ergebnisse werden detailliert erläutert. Die verschiedenen Tabellen präsentieren quantitative Daten zur jeweiligen Fragestellung.
Schlüsselwörter
Elsässisch, Soziolinguistik, Sprachpolitik, Frankreich, Mehrsprachigkeit, Sprachgebrauch, Sprachwandel, Empirische Forschung, Fragebogen, Regressionsanalyse, Sprachgeschichte, Minderheitensprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Soziolinguistische Situation und Sprachpolitik des Elsässischen
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die soziolinguistische Situation und die sprachpolitischen Rahmenbedingungen des Elsässischen. Ziel ist die Analyse der Entwicklung und des gegenwärtigen Status dieser Sprache sowie die Aufzeigung zukünftiger Tendenzen. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten, die mittels Fragebögen erhoben wurden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachgeschichtliche Entwicklung des Elsässischen, den Einfluss der französischen Sprachenpolitik, soziolinguistische Einflussfaktoren auf den Elsässischgebrauch, den Sprachgebrauch in verschiedenen Kontexten (Familie, Beruf, Freizeit) und das sprachenpolitische Bewusstsein der Bevölkerung im Elsass.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Allgemeine Vorbemerkungen (terminologische, landeskundliche und sprachliche Grundlagen), Sprachgeschichtliche und -politische Rahmenbedingungen (vom Mittelalter bis heute), Soziolinguistische und sprachenpolitische Untersuchung (Methodik, Fragebogen, Erhebung) und Statistische Auswertungen (Sprachkenntnisse, Sprachgebrauch, Selbsteinschätzung, sprachenpolitisches Bewusstsein, Regressionsanalysen).
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Die Daten wurden mittels Fragebögen erhoben und anschließend statistisch ausgewertet (lineare und logarithmische Regressionsanalysen). Der Fragebogen und die Erhebungsmethode werden detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die statistischen Auswertungen präsentieren Ergebnisse zu Sprachkenntnissen, Sprachgebrauch in verschiedenen Kontexten, sprachlicher Selbsteinschätzung, sprachenpolitischem Bewusstsein und Zusammenhängen zwischen diesen Variablen, analysiert mittels Regressionsanalysen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elsässisch, Soziolinguistik, Sprachpolitik, Frankreich, Mehrsprachigkeit, Sprachgebrauch, Sprachwandel, Empirische Forschung, Fragebogen, Regressionsanalyse, Sprachgeschichte, Minderheitensprache.
Welche Zeiträume werden in der sprachgeschichtlichen Analyse betrachtet?
Die sprachgeschichtliche und sprachpolitische Analyse umfasst den Zeitraum vom Mittelalter bis zur Gegenwart, mit besonderem Fokus auf die Französische Revolution und die Nachkriegszeit.
Welche Aspekte der französischen Sprachenpolitik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener französischer Sprachenpolitiken auf das Elsässische, insbesondere die Maßnahmen zur Förderung oder Unterdrückung der Sprache und deren Folgen für die Sprachgemeinschaft.
Wie wird der Sprachgebrauch in verschiedenen Kontexten untersucht?
Der Sprachgebrauch wird in den Kontexten Familie, Beruf und Freizeit untersucht, um den Einfluss des jeweiligen Kontextes auf die Sprachwahl aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt das sprachenpolitische Bewusstsein in der Arbeit?
Das sprachenpolitische Bewusstsein der Bevölkerung im Elsass wird untersucht, um die Einstellungen und Meinungen zur Sprache und ihrer Rolle in der Gesellschaft zu erfassen.
- Quote paper
- Dipl. Hdl. Juliane Müller (Author), 2009, Das Elsässische - Eine soziolinguistische und sprachenpolitische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141845