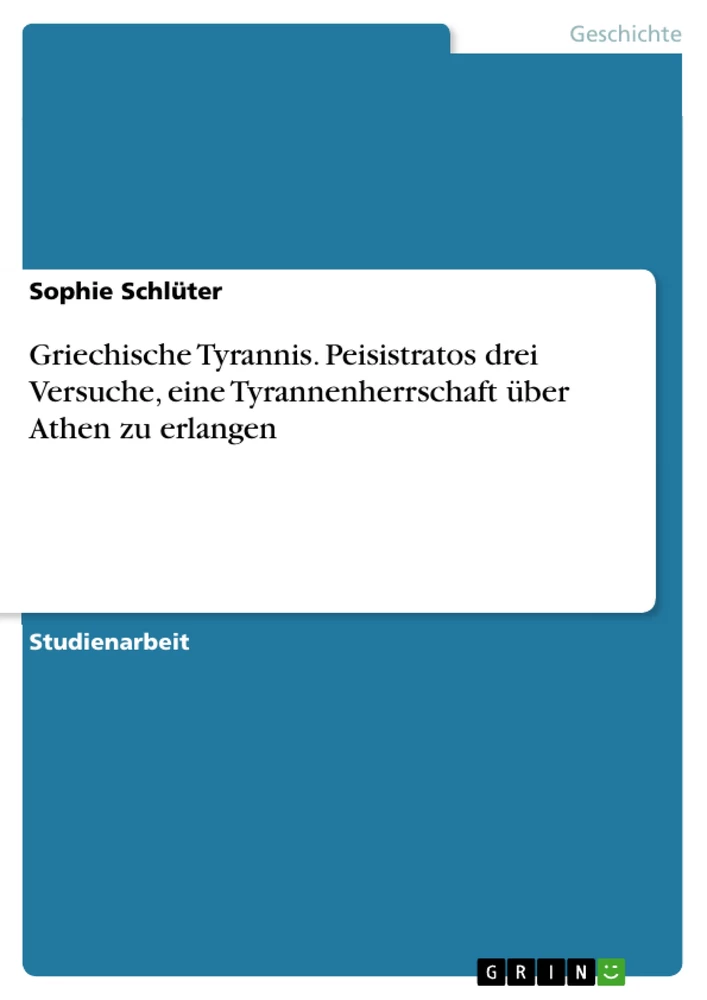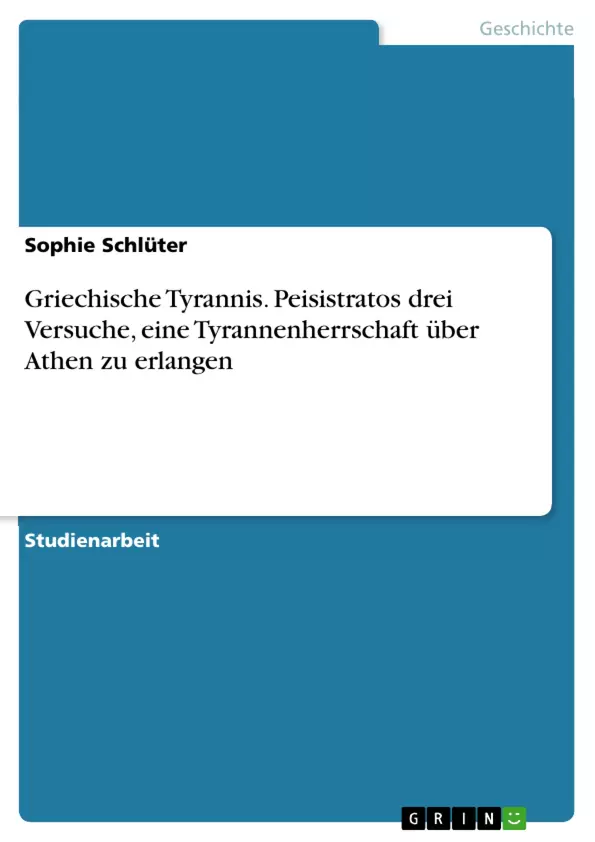Im Laufe dieser Arbeit soll die Leitfrage "Inwiefern verhalfen Peisistratos' Mittel der Legitimation zur Errichtung seiner drei Tyrannis über Athen?" beantwortet werden. Hierbei soll ebenso erläutert werden, ob er heimlich vorging oder ob er sein Handeln öffentlich demonstrierte, um als Tyrann in Athen 'Fuß zu fassen'. Daher ist das Ziel dieser Arbeit herauszufinden, wie Peisistratos trotz zweier Niederlagen die Herrschaft erlangen konnte und welche Mittel er für seine Legitimation nutzte.
Die Unzufriedenheit der Bevölkerung, Rivalitäten zwischen Aristokraten und soziale und wirtschaftliche Missstände waren in der Archaik an der Tagesordnung und stellten begünstigende Faktoren für die Errichtung einer Tyrannis dar. Tyrannen erlangten dabei keinesfalls, wie es bei den Königen üblich war, durch legitime und gesetzeskonforme Mittel die Macht, sondern griffen auf Gewalt und Listen zur Etablierung ihrer Tyrannis zurück. Exemplarisch war dafür die Unterstützung von Söldnern oder eine geschickte Selbstinszenierung vor dem Volk. Peisistratos bemühte sich drei Mal die Macht über Athen zu ergreifen, was ihm bei seinem letzten Versuch durch die Hilfe von Söldnern und Unterstützern gelang. Durch sein mehrmaliges Bestreben und die unterschiedlichen Arten, um seine Tyrannis durchzusetzen, bietet Peisistratos den idealen Untersuchungsgegenstand meiner Leitfrage.
Um die Fragestellung zu beantworten, bilden Herodot und Aristoteles meine Quellengrundlage, da beide die drei Tyrannenherrschaften des Peisistratos beschrieben. Thukydides äußerte sich lediglich zum Ende der Tyrannis von Peisistratos über ihn und widmete sich anschließend eher seinen Söhnen, weshalb dieser für die Hausarbeit nicht von großer Relevanz ist. Auch in der modernen Forschung stellen Aristoteles und Herodot die Hauptquellen für die Tyrannis von Peisistratos dar, jedoch wurden hierbei auch einige Schilderungen kritisch beleuchtet. Besonders in Bezug auf die drei Gruppierungen, welche sich laut Aristoteles durch lokale und verfassungspolitische Merkmale unterschieden, wird von einem Anachronismus gesprochen. Daher ist es für diese Leitfrage von besonderer Bedeutsamkeit die Quellen kritisch zu hinterfragen und mithilfe der modernen Literatur ein Urteil zu entwickeln. Diese Arbeit wird zuerst das Wesen der Tyrannis ausführlich beschreiben, um die Merkmale und Besonderheiten dieser herauszufinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbeschreibung Tyrannis
- Ausgangslage in Athen
- Krise der archaischen Zeit
- Der Reformer Solon
- Peisistratos drei Versuche, die Tyrannenherrschaft zu erlangen
- Selbstinszenierung und Keulenträger
- Legitimation durch die Stadtgöttin Athene
- Beteiligung von auswärtigen Söldnern und Unterstützern
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Peisistratos trotz zweier gescheiterter Versuche die Tyrannis in Athen erlangte und welche Legitimationsmittel er dabei einsetzte. Die Analyse basiert auf den Quellen Herodots und Aristoteles, wobei deren Schilderungen kritisch hinterfragt werden. Das Ziel ist es, die Strategien Peisistratos' zur Machtergreifung und seine Methoden der Legitimation zu verstehen.
- Die Definition und Merkmale der griechischen Tyrannis
- Die politische und soziale Krise Athens in der archaischen Zeit
- Die Rolle Solons und seine Reformen im Kontext der späteren Tyrannis
- Peisistratos' drei Versuche der Machtergreifung und seine unterschiedlichen Strategien
- Die Bedeutung von Legitimationsmitteln (Selbstinszenierung, Unterstützung, religiöse Elemente) für den Erfolg Peisistratos'
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage: Inwiefern verhalfen Peisistratos' Legitimationsmittel zur Errichtung seiner Tyrannis über Athen? Sie benennt Herodot und Aristoteles als Hauptquellen und kündigt den Aufbau der Arbeit an, der die Begriffsbeschreibung der Tyrannis, die historische Ausgangslage in Athen und die Analyse von Peisistratos' drei Machtergreifungsversuchen umfasst.
Begriffsbeschreibung Tyrannis: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Tyrannis“ und seine Bedeutung im antiken Griechenland. Es werden verschiedene antike Autoren wie Xenophon, Platon, Aristoteles und Thukydides herangezogen, um verschiedene Perspektiven auf die Tyrannis und ihre Merkmale zu beleuchten. Die Autoren betonen meist die gewaltsame und gesetzeswidrige Machtergreifung sowie den egoistischen Charakter der Tyrannenherrschaft. Die Diskussion beinhaltet auch die unterschiedliche Bewertung der Tyrannis in der modernen Forschung und die Herausforderungen bei der Interpretation der antiken Quellen.
Ausgangslage in Athen: Dieses Kapitel beschreibt die politische, soziale und wirtschaftliche Krise Athens in der archaischen Zeit, die als Nährboden für den Aufstieg von Tyrannen diente. Es beleuchtet die sozialen Spannungen und wirtschaftlichen Ungleichheiten als Faktoren für die Instabilität des athenischen Staates. Die Reformen Solons werden als Versuch der Krisenbewältigung dargestellt, wobei betont wird, dass seine Maßnahmen nicht alle Probleme lösen konnten und somit den Weg für Peisistratos ebneten.
Peisistratos drei Versuche, die Tyrannenherrschaft zu erlangen: Dieses Kapitel analysiert detailliert die drei Versuche Peisistratos', die Macht in Athen zu ergreifen. Es beleuchtet seine Strategien, die von Selbstinszenierung und geschickter Propaganda bis hin zur Nutzung von Söldnern reichten, und untersucht, wie er in seinen unterschiedlichen Ansätzen die Schwächen des athenischen Systems ausnutzte. Das Kapitel konzentriert sich darauf, wie diese Strategien zum letztendlichen Erfolg seines dritten Versuchs beitrugen.
Selbstinszenierung und Keulenträger: Dieses Kapitel analysiert Peisistratos' geschickte Selbstinszenierung und die strategische Verwendung der „Keulenträger“ (bewaffnete Anhänger) als Mittel zur Machtergreifung. Es untersucht die psychologischen und politischen Aspekte dieser Taktik, die eine Mischung aus Einschüchterung, Propaganda und dem Aufbau eines Gefolges umfasste. Der Fokus liegt darauf, wie Peisistratos diese Mittel nutzte, um die Zustimmung oder zumindest die Duldung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu gewinnen.
Legitimation durch die Stadtgöttin Athene: Dieses Kapitel untersucht, wie Peisistratos religiöse und mythologische Elemente für seine Legitimation einsetzte, insbesondere die Verbindung zu Athene, der Schutzgöttin Athens. Es analysiert die propagandistische Nutzung dieser religiösen Elemente, um die Akzeptanz seiner Herrschaft zu fördern und sich als von den Göttern auserwählt darzustellen. Die Bedeutung der religiösen Legitimation im antiken Kontext wird hier detailliert erörtert.
Beteiligung von auswärtigen Söldnern und Unterstützern: Dieses Kapitel beschreibt die Rolle auswärtiger Söldner und Unterstützer in Peisistratos' Machtergreifung. Es analysiert die strategische Bedeutung dieser militärischen und politischen Allianzen für seinen Erfolg und untersucht die verschiedenen Motive und Interessen dieser Gruppen. Die Bedeutung von strategischen Partnerschaften und die Ausnutzung externer Ressourcen werden hier im Detail dargestellt.
Schlüsselwörter
Griechische Tyrannis, Peisistratos, Athen, archaische Zeit, Solon, Legitimation, Machtergreifung, Selbstinszenierung, Söldner, Herodot, Aristoteles, Quellenkritik, politische Krise, soziale Unruhen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Machtergreifung des Peisistratos in Athen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Machtergreifung des Peisistratos in Athen und untersucht insbesondere seine Strategien und Legitimationsmittel. Der Fokus liegt auf der Beantwortung der Frage, wie Peisistratos trotz zweier gescheiterter Versuche die Tyrannis etablieren konnte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert hauptsächlich auf den Schriften von Herodot und Aristoteles, wobei deren Darstellungen kritisch hinterfragt werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Definition und Merkmale der griechischen Tyrannis, die politische und soziale Krise Athens in der archaischen Zeit, die Rolle Solons und seiner Reformen, Peisistratos' drei Machtergreifungsversuche und seine Strategien (Selbstinszenierung, Propaganda, Nutzung von Söldnern), die Bedeutung von Legitimationsmitteln (religiöse Elemente, Unterstützung durch Bevölkerungsgruppen), und die Rolle auswärtiger Unterstützer.
Wie wird der Begriff „Tyrannis“ definiert?
Das Kapitel „Begriffsbeschreibung Tyrannis“ analysiert den Begriff „Tyrannis“ im antiken Griechenland anhand verschiedener Autoren (Xenophon, Platon, Aristoteles, Thukydides) und beleuchtet unterschiedliche Perspektiven und Interpretationen. Es wird die gewaltsame und gesetzeswidrige Machtergreifung sowie der egoistische Charakter der Tyrannenherrschaft betont. Die unterschiedliche Bewertung in der modernen Forschung wird ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielte die Krise der archaischen Zeit in Athen?
Das Kapitel „Ausgangslage in Athen“ beschreibt die politische, soziale und wirtschaftliche Krise als Grundlage für den Aufstieg Peisistratos. Soziale Spannungen und wirtschaftliche Ungleichheiten werden als Faktoren für die Instabilität des athenischen Staates hervorgehoben. Die Reformen Solons werden als Versuch der Krisenbewältigung dargestellt, der jedoch nicht alle Probleme lösen konnte.
Wie werden Peisistratos' drei Machtergreifungsversuche analysiert?
Das Kapitel „Peisistratos drei Versuche, die Tyrannenherrschaft zu erlangen“ analysiert detailliert die drei Versuche, seine Strategien (von Selbstinszenierung bis zur Nutzung von Söldnern), und wie er die Schwächen des athenischen Systems ausnutzte. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die zum Erfolg seines dritten Versuchs beitrugen.
Welche Rolle spielten Selbstinszenierung und die „Keulenträger“?
Das Kapitel „Selbstinszenierung und Keulenträger“ analysiert Peisistratos' geschickte Selbstinszenierung und den strategischen Einsatz bewaffneter Anhänger. Es untersucht die psychologischen und politischen Aspekte dieser Taktik, die Einschüchterung, Propaganda und den Aufbau eines Gefolges umfasste. Der Fokus liegt darauf, wie er die Zustimmung bestimmter Bevölkerungsgruppen gewann.
Welche Bedeutung hatte die religiöse Legitimation?
Das Kapitel „Legitimation durch die Stadtgöttin Athene“ untersucht die Nutzung religiöser und mythologischer Elemente, insbesondere die Verbindung zu Athene, zur Legitimation seiner Herrschaft. Die propagandistische Nutzung religiöser Elemente zur Förderung der Akzeptanz und zur Darstellung als von den Göttern auserwählt wird analysiert.
Welche Rolle spielten auswärtige Söldner und Unterstützer?
Das Kapitel „Beteiligung von auswärtigen Söldnern und Unterstützern“ beschreibt die Rolle auswärtiger Söldner und Unterstützer bei Peisistratos' Machtergreifung. Die strategische Bedeutung dieser militärischen und politischen Allianzen und die Motive der beteiligten Gruppen werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Griechische Tyrannis, Peisistratos, Athen, archaische Zeit, Solon, Legitimation, Machtergreifung, Selbstinszenierung, Söldner, Herodot, Aristoteles, Quellenkritik, politische Krise, soziale Unruhen.
- Quote paper
- Sophie Schlüter (Author), 2023, Griechische Tyrannis. Peisistratos drei Versuche, eine Tyrannenherrschaft über Athen zu erlangen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1418698