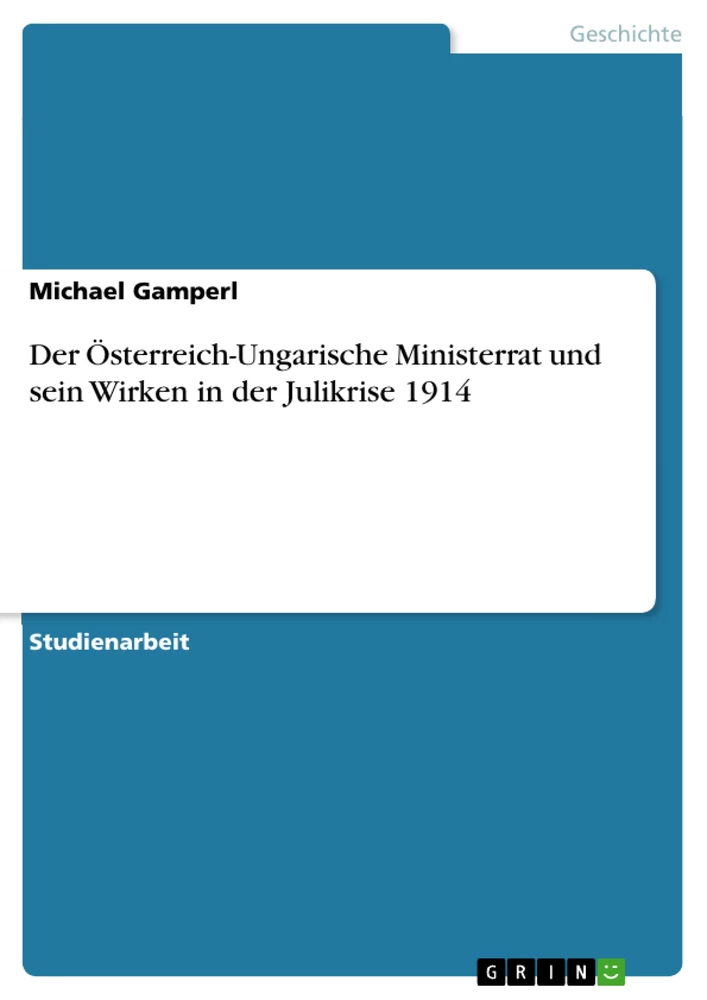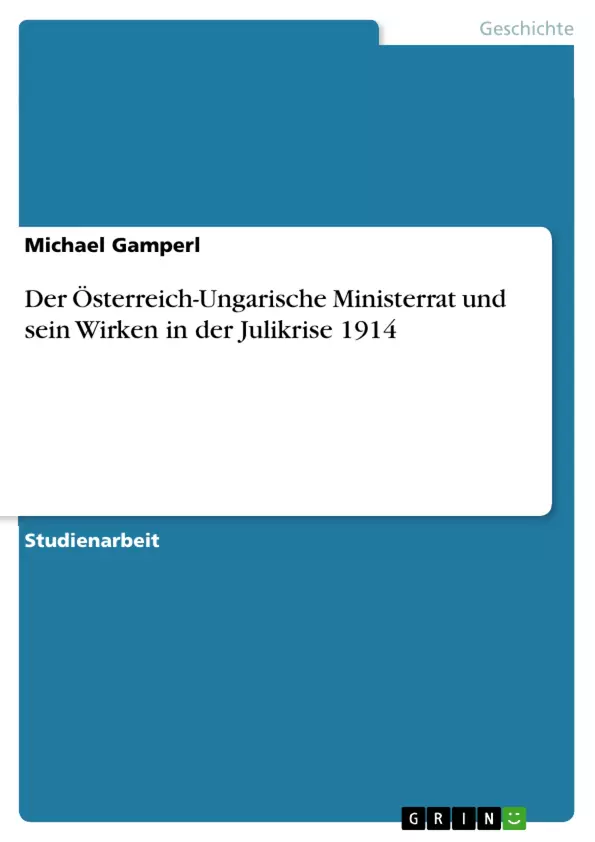Die Entfesselung des 1. Weltkrieges wird in der deutschen Wahrnehmung hauptsächlich mit dem Blankoscheck des Kaisers und der damit einhergehenden Kriegsschuld des Kaiserreiches in Verbindung gebracht, spätestens seit der Fischer-Kontroverse in den sechziger Jahren. Trotz der Unbestrittenheit des deutschen Anteils am Ausbruch des Krieges erscheint es ebenso ratsam den Fokus auf die Habsburgermonarchie Österreich-Ungarn zu richten. Gerade das österreichische Ultimatum an Serbien kann als eine Art Meilenstein für den Kriegsausbruch gelten. Jedoch liegt zwischen dem Grund des Ultimatums, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz-Ferdinand am 28.06.1914 in Sarajevo, und der Aussendung des Ultimatums an die serbische Regierung fast ein ganzer Monat. Als Dreh- und Angelpunkt eines österreichischen Entscheidungsfindungsprozess ist qua definitionem der gemeinsame Ministerrat anzusehen. Ihm sass der vom Kaiser persönlich ernannte Außenminister vor, was natürlich eine in der Regel enge Beziehung zwischen beiden nahelegt. Häufige Teilnehmer waren weiterhin die beiden anderen gemeinsamen Minister Österreich-Ungarns, der Finanz- und der Kriegsminister. Ferner sprachen die beiden Ministerpräsidenten für ihre jeweiligen Länder. Je nach Verhandlungsgegenstand war es auch höheren Beamten oder sonstigen Beamten erlaubt an den Sitzungen teilzunehmen. Der Ministerrat war dazu gedacht, die Außenpolitik dem Kaiser als Prärogativ vorzubehalten.
Ziel dieser Arbeit wird es sein, die tatsächliche Bedeutung dieses Gremiums herauszuarbeiten. War der Ministerrat in der Julikrise 1914 eine noch vom Kaiser gelenkte Institution oder war dem Kaiser das Zepter bereits entglitten, sprich gaben schon andere Personengruppen die Richtung vor? Die Abhängigkeit des Ministerrates von Deutschland in bezug auf die vielfach vorgetragene Theorie, dass Österreich-Ungarn nur als ausführender Agent des deutschen Reiches zu sehen sei, soll zudem untersucht werden. Ebenso sollen die singulären Entscheidungsträger des Ministerrates beleuchtet werden. War die Stimmung im Ministerrat bereits kurz nach dem Attentat auf Krieg ausgerichtet, oder war die Entscheidung für das Vorgehen gegen Serbien ein eher konsensualer und rationaler Prozeß, der sich im Verlaufe des Julis mehr und mehr herauskristallisierte? Unterschiedliche Auffassungen, wechselnde Stimmungslagen und offen zutage tretende Differenzen sollen hervorgehoben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Lage Österreich-Ungarns am Vorabend des Attentats
- 3. Das Attentat und seine ersten Folgen
- 4. Die Hoyos Mission
- 5. Die Sitzung des Ministerrates am 07. Juli
- 6. Der Meinungsumschwung Tiszas
- 7. Die erste Fassung des Ultimatums
- 8. Der Ministerrat des 19. Juli
- 7. Die letzten Hürden
- 8. Schlußbetrachtung
- 9. Quellenverzeichnis
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des österreich-ungarischen Ministerrates während der Julikrise 1914. Es wird analysiert, inwieweit der Ministerrat tatsächlich vom Kaiser gelenkt wurde oder ob andere Akteure die Richtung vorgaben. Die Abhängigkeit Österreich-Ungarns von Deutschland und die individuellen Entscheidungsprozesse innerhalb des Ministerrates werden ebenfalls beleuchtet.
- Die Bedeutung des österreich-ungarischen Ministerrates in der Julikrise 1914
- Der Einfluss des Kaisers und anderer Akteure auf die Entscheidungsfindung
- Die Abhängigkeit Österreich-Ungarns von Deutschland
- Individuelle Entscheidungsprozesse innerhalb des Ministerrates
- Die Stimmung im Ministerrat und die Entwicklung der Entscheidung für ein Vorgehen gegen Serbien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die gängige deutsche Wahrnehmung des Ersten Weltkriegsausbruchs und betont die Bedeutung des österreichischen Ultimatums an Serbien. Sie führt den österreich-ungarischen Ministerrat als zentralen Entscheidungsfindungsprozess ein und beschreibt dessen Zusammensetzung und Funktion. Das Hauptziel der Arbeit ist die Untersuchung der tatsächlichen Bedeutung des Ministerrates während der Julikrise, der Einfluss des Kaisers, die Abhängigkeit von Deutschland und die individuellen Entscheidungsträger werden näher beleuchtet. Die Methodik der Arbeit, basierend auf der Auswertung von Ministerratsprotokollen und Sekundärliteratur, wird ebenfalls erläutert. Wichtige Grundlagenwerke und die Fülle an Literatur zum Thema werden genannt.
2. Die Lage Österreich-Ungarns am Vorabend des Attentats: Dieses Kapitel beschreibt die innen- und außenpolitische Lage Österreich-Ungarns im Jahr 1914. Die Doppelmonarchie wird als formale Großmacht dargestellt, die von innenpolitischen Spannungen (nationalistische Aufwallungen, Meinungsverschiedenheiten zwischen Österreich und Ungarn, Reformunfähigkeit) und außenpolitischem Druck (wachsende Macht Serbiens auf dem Balkan, gestörte Beziehungen zu Serbien) geplagt war. Es wird die Entwicklung der Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Serbien geschildert, die durch die bosnische Annexionskrise und die Balkankriege belastet wurden. Die Bemühungen Berchtolds um eine neue Strategie zur Stärkung der Macht Österreich-Ungarns und zur Entziehung von Bündnispartnern Serbiens, sowie das dazugehörige Memorandum Matschekos mit dem Ziel einer engeren Bindung an Deutschland, werden detailliert analysiert. Die Debatte in der Literatur über die militärische oder diplomatische Ausrichtung dieses Dokuments wird angesprochen, aber der allgemeine Konsens, dass die österreichischen Entscheidungsträger Handlungsdruck erkannten, wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer engen Abstimmung mit Deutschland wird unterstrichen.
3. Das Attentat und seine ersten Folgen: Dieses Kapitel behandelt die Ermordung Erzherzog Franz Ferdinands am 28. Juni 1914. Obwohl die genauen Umstände des Attentats nicht detailliert behandelt werden, wird betont, dass ein von höchster serbischer Stelle gesteuertes Attentat unwahrscheinlich war. Der Fokus liegt auf den unmittelbaren Folgen des Attentats und dem Beginn des Prozesses, der zum Ultimatum an Serbien führen sollte. Der Zusammenhang zum darauffolgenden Handeln des österreichischen Ministerrats wird angedeutet, ohne die Details der Entscheidungsfindung vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Österreich-Ungarn, Julikrise 1914, Ministerrat, Kaiser Wilhelm II., Franz Ferdinand, Serbien, Ultimatum, Deutschland, Kriegseintritt, Entscheidungsprozesse, Innenpolitik, Außenpolitik, Nationalismus, Balkan.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Die Rolle des österreich-ungarischen Ministerrates während der Julikrise 1914
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle des österreich-ungarischen Ministerrates während der Julikrise 1914. Im Fokus steht die Analyse der Entscheidungsfindung innerhalb des Ministerrates, der Einfluss des Kaisers und anderer Akteure, die Abhängigkeit Österreich-Ungarns von Deutschland sowie die individuellen Entscheidungsprozesse.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Ministerrates in der Julikrise, den Einfluss des Kaisers und anderer Akteure auf die Entscheidungsfindung, die Abhängigkeit Österreich-Ungarns von Deutschland, die individuellen Entscheidungsprozesse innerhalb des Ministerrates und die Entwicklung der Entscheidung für ein Vorgehen gegen Serbien.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält Kapitel zur Einleitung, zur Lage Österreich-Ungarns vor dem Attentat, zum Attentat und seinen Folgen, zur Hoyos-Mission, zur Ministerratssitzung am 7. Juli, zum Meinungsumschwung Tiszas, zur ersten Fassung des Ultimatums, zum Ministerrat vom 19. Juli, zu den letzten Hürden, einer Schlussbetrachtung, sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis.
Wie wird die Lage Österreich-Ungarns vor dem Attentat dargestellt?
Das Dokument beschreibt Österreich-Ungarn als eine Großmacht, die von innenpolitischen Spannungen (nationalistische Aufwallungen, Meinungsverschiedenheiten zwischen Österreich und Ungarn, Reformunfähigkeit) und außenpolitischem Druck (wachsende Macht Serbiens, gestörte Beziehungen zu Serbien) geplagt war. Die Beziehungen zu Serbien waren durch die bosnische Annexionskrise und die Balkankriege belastet. Die Bemühungen Berchtolds um eine neue Strategie und die enge Bindung an Deutschland werden detailliert analysiert.
Wie wird das Attentat von Sarajevo behandelt?
Das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand wird erwähnt, jedoch nicht im Detail. Der Fokus liegt auf den unmittelbaren Folgen und dem Beginn des Prozesses, der zum Ultimatum an Serbien führte. Der Zusammenhang zum Handeln des österreichischen Ministerrates wird angedeutet.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Auswertung von Ministerratsprotokollen und Sekundärliteratur. Genannt werden wichtige Grundlagenwerke und die Fülle an Literatur zum Thema.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die Schlussfolgerungen sind nicht explizit in den FAQs zusammengefasst, da sie im Kapitel "Schlussbetrachtung" des Dokuments selbst zu finden sind.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Österreich-Ungarn, Julikrise 1914, Ministerrat, Kaiser Wilhelm II., Franz Ferdinand, Serbien, Ultimatum, Deutschland, Kriegseintritt, Entscheidungsprozesse, Innenpolitik, Außenpolitik, Nationalismus, Balkan.
- Quote paper
- Michael Gamperl (Author), 2008, Der Österreich-Ungarische Ministerrat und sein Wirken in der Julikrise 1914, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/141920