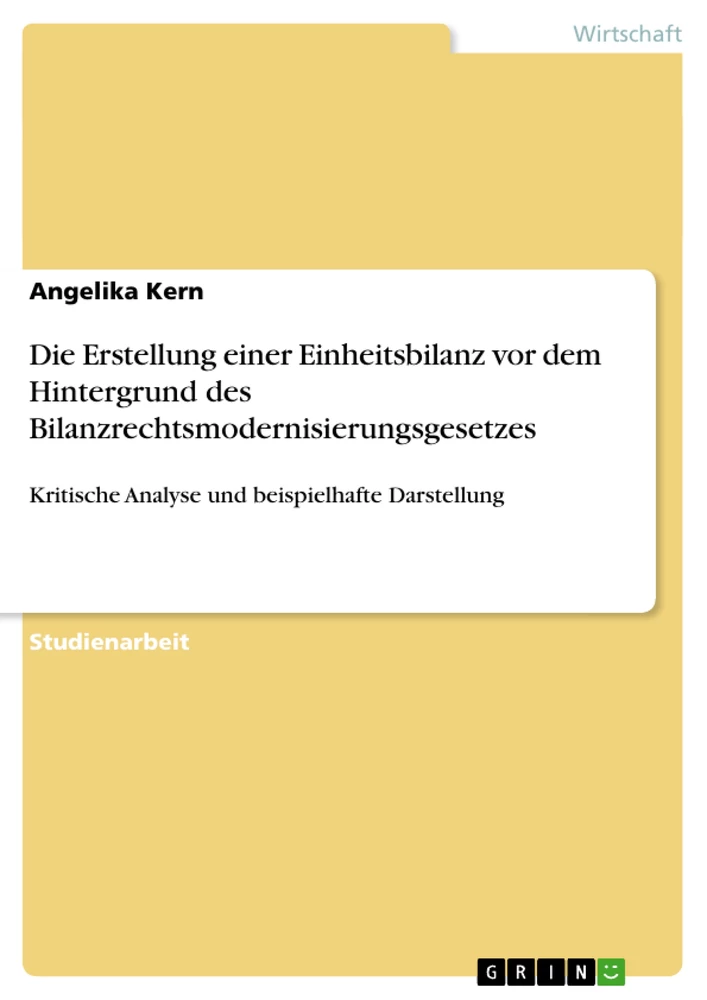Mit der Zustimmung des Bundesrats am 03.04.2009 hat der lange Weg einer Modernisierung des Bilanzrechts ein vorläufiges Ende gefunden und das Gesetz konnte am 29.05.2009 in Kraft treten. Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (nachfolgend: BilMoG) soll eine vollwertige, jedoch einfachere und kostengünstigere Alternative des HGB zu den internationalen Rechnungslegungsstandards (hier: IFRS) geschaffen werden, welche zwischen dem bisherigen HGB und den IFRS anzutreffen ist. Im Zentrum der Überlegungen zur Änderung des HGB stehen die Verbesserung des Informationsgehalts handelsrechtlicher Jahres- und Konzernabschlüsse sowie die Deregulierung und grundlegende Modernisierung der handels-rechtlichen Rechnungslegung. Die zahlreichen Modifikationen durch das BilMoG im HGB zeigen, dass das BilMoG auch für den Mittelstand von enormer Bedeutung ist. Es bleibt dabei, dass der handelsrechtliche Jahresabschluss Grundlage der Ausschüttungsbemessung und für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich ist. Die Änderungen betreffen alle Bereiche des Bilanzrechts und die künftigen Abweichungen zwischen der Handels- und Steuerbilanz werden zunehmen. Trotz der Bestrebung des Gesetzgebers an der Einheitsbilanz festzuhalten, verringern sich die Möglichkeiten zur Aufstellung einer einheitlichen Handels- und Steuerbilanz, da u. a. auch das EStG unausweichliche Änderungen erfährt.
Die Erstellung einer Einheitsbilanz nach dem BilMoG soll in der nachfolgenden Arbeit unter-sucht werden, indem im zweiten Kapitel die Begrifflichkeiten der Einheitsbilanz dargestellt werden. Anschließend wird in Kapitel 3 das fundamentale Prinzip der Maßgeblichkeit und dessen Ausprägungen erläutert. Daraufhin leitet Kapitel 4 auf die Modifikationen durch das BilMoG über, bestehend aus den Änderungen bzgl. des Maßgeblichkeitsprinzips und einzelner Ansatz- und Bewertungsvorschriften. In Kapitel 5 wird eruiert, inwieweit eine Einheitsbilanz noch möglich ist und welche allgemeinen Alternativlösungen zum Konzept der Einheitsbilanz zur Verfügung stehen. Die Analyse schließt in Kapitel 6 mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
- Anlagenverzeichnis
- Einleitung
- Die Einheitsbilanz
- Der Begriff der Einheitsbilanz
- Die historische Entwicklung der Einheitsbilanz
- Die Voraussetzungen zur Erstellung einer Einheitsbilanz
- Die Handelsbilanz – Definition, Grundsätze und Ziele
- Die Steuerbilanz – Definition, Grundsätze und Ziele
- Die Verzahnung von Handels- und Steuerbilanz
- Das Prinzip der Maßgeblichkeit und dessen Ausprägungen
- Die materielle Maßgeblichkeit
- Die formelle und die umgekehrte Maßgeblichkeit
- Die Änderungen durch das neue Bilanzrecht im Hinblick auf die Erstellung einer Einheitsbilanz
- Die Änderungen in Bezug auf das Prinzip der Maßgeblichkeit
- Die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit
- Das Maßgeblichkeitsprinzip nach BilMoG
- Die Auswirkungen auf die Einheitsbilanz
- Die Änderungen wesentlicher Ansatzvorschriften
- Die Änderungen im Rahmen allgemeiner Bilanzierungsgrundsätze
- Die selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- Das Verrechnungsgebot nach § 246 Abs. 2 HGB
- Die sonstigen Ansatzvorschriften
- Die Änderungen wesentlicher Bewertungsvorschriften
- Die Bewertung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Abschreibung und Zuschreibung
- Die Bewertung der Herstellungskosten
- Die Bewertung von Rückstellungen
- Die sonstigen Bewertungsvorschriften
- Die Änderungen in Bezug auf das Prinzip der Maßgeblichkeit
- Kritische Analyse bezüglich der Erstellung einer Einheitsbilanz
- Die Möglichkeit zur Erstellung einer Einheitsbilanz
- Die Alternativlösungen zur Einheitsbilanz
- Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Erstellung einer Einheitsbilanz vor dem Hintergrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Sie analysiert kritisch die Auswirkungen des neuen Bilanzrechts auf die Erstellung einer Einheitsbilanz und zeigt anhand von Beispielen die Herausforderungen und Möglichkeiten auf.
- Das Prinzip der Maßgeblichkeit und dessen Ausprägungen im Kontext der Einheitsbilanz
- Die Änderungen des Bilanzrechts durch das BilMoG und deren Einfluss auf die Einheitsbilanz
- Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Rückstellungen unter dem BilMoG
- Die Möglichkeiten und Grenzen der Erstellung einer Einheitsbilanz im aktuellen Rechtsrahmen
- Alternativlösungen zur Einheitsbilanz
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Einheitsbilanz ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des BilMoG.
- Kapitel 2 definiert den Begriff der Einheitsbilanz, beleuchtet ihre historische Entwicklung und skizziert die Voraussetzungen für ihre Erstellung. Dabei werden die Handels- und Steuerbilanz mit ihren jeweiligen Zielen und Grundsätzen vorgestellt.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem Prinzip der Maßgeblichkeit und seinen verschiedenen Ausprägungen, insbesondere der materiellen und der formalen Maßgeblichkeit.
- Kapitel 4 untersucht die Änderungen des Bilanzrechts durch das BilMoG im Hinblick auf die Erstellung einer Einheitsbilanz. Dabei werden die Auswirkungen des BilMoG auf das Prinzip der Maßgeblichkeit, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften im Detail beleuchtet.
- Kapitel 5 bietet eine kritische Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der Erstellung einer Einheitsbilanz im aktuellen Rechtsrahmen. Es werden auch alternative Lösungen zur Einheitsbilanz vorgestellt.
Schlüsselwörter
Einheitsbilanz, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Prinzip der Maßgeblichkeit, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Ansatzvorschriften, Bewertungsvorschriften, Vermögensgegenstände, Rückstellungen, alternative Lösungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Einheitsbilanz?
Eine Einheitsbilanz ist ein Jahresabschluss, der gleichzeitig die Anforderungen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz erfüllt, um den Aufwand der doppelten Buchführung zu vermeiden.
Wie hat das BilMoG die Erstellung der Einheitsbilanz verändert?
Durch das BilMoG wurden viele handelsrechtliche Wahlrechte abgeschafft oder geändert, was zu einer Zunahme von Abweichungen zwischen Handels- und Steuerrecht führt.
Was bedeutet das Prinzip der Maßgeblichkeit?
Es besagt, dass die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgebend sind.
Was ist die "umgekehrte Maßgeblichkeit"?
Die umgekehrte Maßgeblichkeit erlaubte es, steuerliche Sonderabschreibungen in die Handelsbilanz zu übernehmen. Diese wurde durch das BilMoG abgeschafft.
Ist eine Einheitsbilanz heute noch möglich?
Die Arbeit untersucht kritisch, dass die Möglichkeiten zur Aufstellung einer Einheitsbilanz schwinden, da die künftigen Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz zunehmen.
- Citar trabajo
- Angelika Kern (Autor), 2009, Die Erstellung einer Einheitsbilanz vor dem Hintergrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/142001